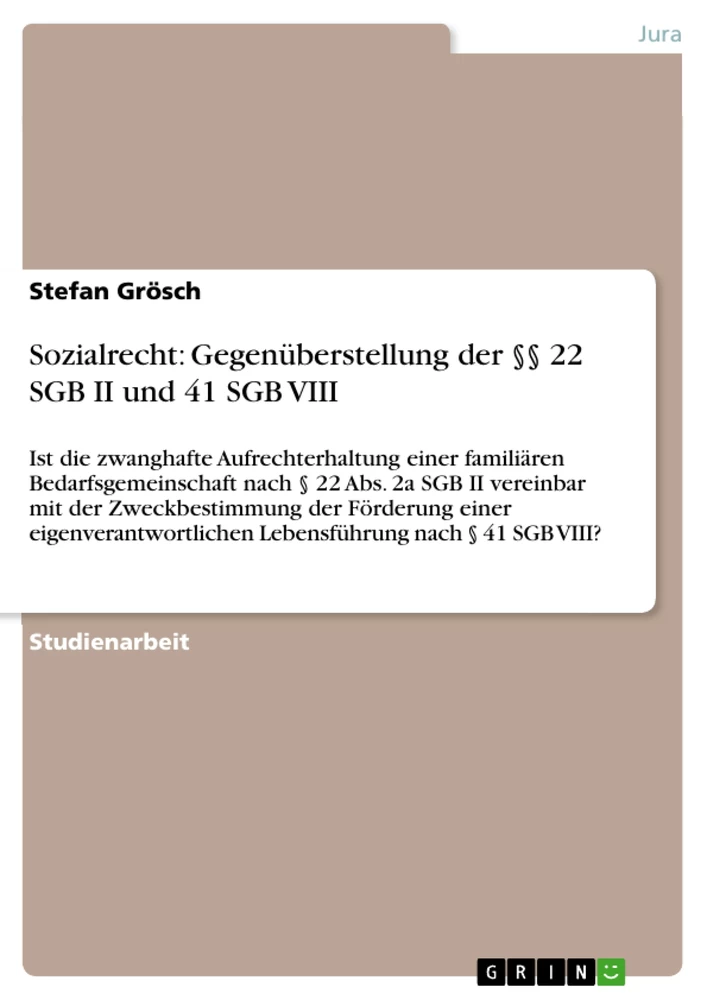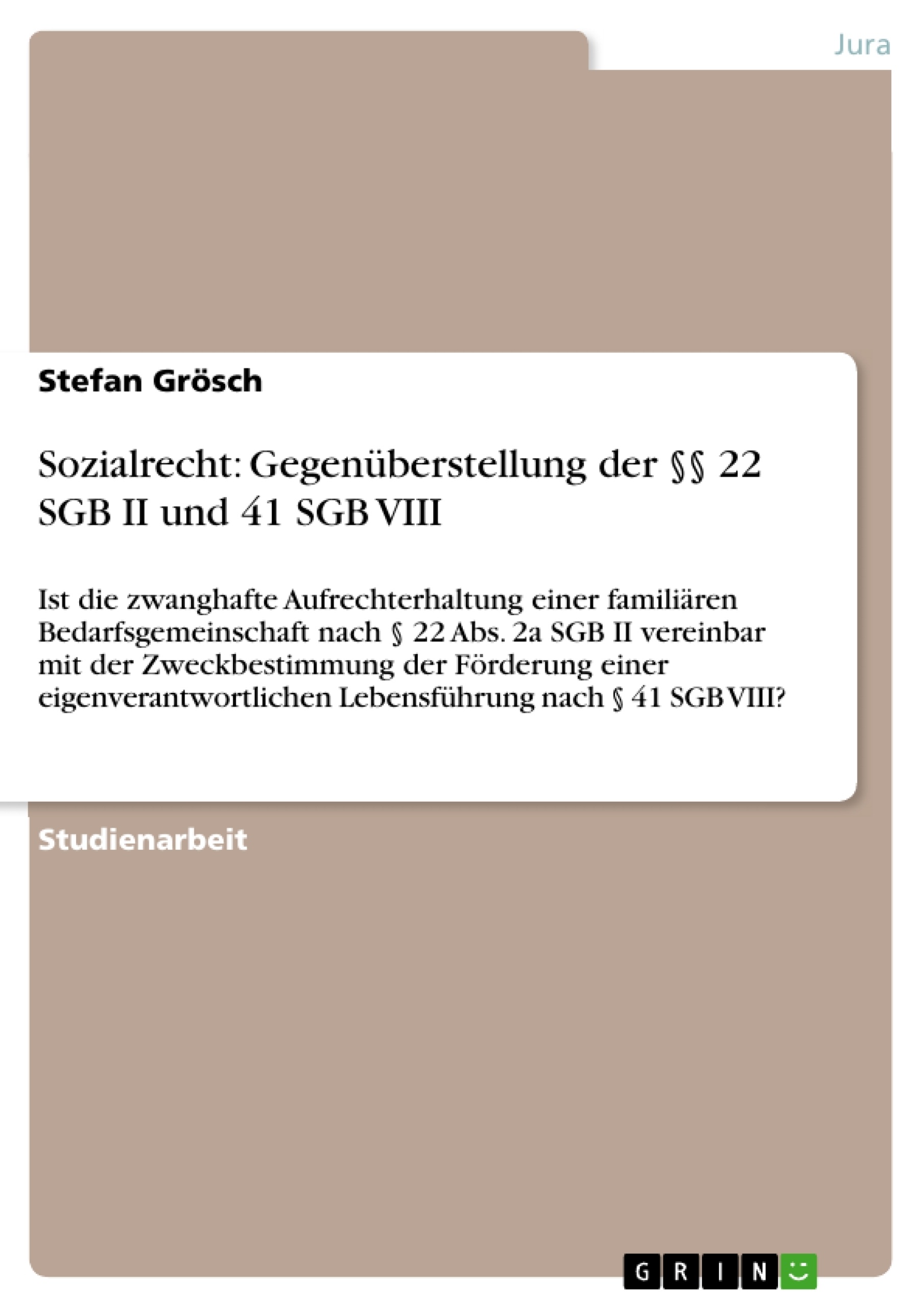Die Einführung des SGB II am 01.01.2005 bedeutete eine Verschärfung der Gesetzeslage für junge Menschen unter 25 Jahre. Eine verschärfte Form von Sanktionen findet sich in § 31 Abs 5 und 6 SGB II, worin den jungen Menschen bei Verstoß oder nicht Einhaltung gesetzlicher Vorgaben die Regelleistung, incl. möglicher Mehrbedarfe auf bis zu 3 Monate gestrichen werden kann. Eine möglicherweise gewährte Mietzahlung erfolgt direkt an den Vermieter. Die Konsequenz einer Pflichtverletzung nach diesem Gesetzbuch ist ein erheblicher Eingriff in die Persönlichkeitsrechte von Betroffenen. Die Begründung für die komplette Streichung der Regelleistung bewirbt der Gesetzgeber damit, dass die „Bringschuld“ des Staates, jedem Jugendlichen einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz, oder eine Arbeitsgelegenheit mit Qualifizierungsmaßnahme anbieten zu müssen, sehr hoch und teuer ist. Wird einem Jugendlichen oder jungen Heranwachsenden von Seiten der Arbeitsgemeinschaft etwas Integrierendes in den Arbeitsmarkt angeboten, so hat die hilfebedürftige Person dem entsprechend Folge zu leisten. Da sich die Lage auf dem Ausbildungsmarkt in den letzten Jahren stetig verschlechtert hat (die auf dem Arbeitsmarkt ebenso), waren, bzw. sind die Angebote der Arbeitsagenturen oftmals unfreiwillige Lückenbüßer, um eine ungewollt tätigkeitslose Zeit zu überbrücken. Erfolgt nach dem Schulabschluss jedoch nicht zeitnah ein Übergang in eine geregelte Arbeits-, bzw. Ausbildungsumgebung, droht Frust und eine Verschlechterung der sozialen Lage. Möglicherweise belasten schlechte schulische Leistungen die Beziehung zu den Eltern, möglicherweise sind es jedoch Mitglieder der peer-group, welche einen schlechten Einfluss auf den oder die Jugendliche vermuten lassen. Adoleszenzkrisen zehren an den Nerven. Familien stehen in dieser Phase oft am Rand ihrer Handlungsfähigkeit, geringe Aussichten auf einen positiven Übertritt in das Erwerbsleben durch fehlende Ausbildungsstellen erschweren die Lage erheblich.
Kann hier die (regelrechte) kombinierte Anwendung der §§ 22 SGB II und 41 SGB VIII zu einer Entspannung der Lage beitragen? Oder passen die beiden Vorschriften nicht zueinander?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. SGB VIII
- 2.1 Allgemeines
- 2.2 Inhaltliche Verbindung SGB VIII zu SGB II
- 2.3 § 41 SGB VIII
- 2.3.1 Grundlage für die Vorschrift
- 2.3.2 Anspruchsberechtigte/Rechtsanspruch
- 2.3.3 Gesetzlicher Umfang der Leistungen
- 2.3.4 Kosten
- 2.3.5 Fallzahlen
- 3. SGB II
- 3.1 Allgemeines
- 3.2 Relevante Gesetzestexte des SGB II
- 3.2.1 Berechtigte
- 3.2.2 § 22 Abs. 2a SGB II, und § 31 Abs. 5 SGB II
- 4. Arbeitsanweisung der Arge Limburg-Weilburg zum Auszug U25jähriger
- 5. Statistischer Wert zum Auszug in Limburg-Weilburg
- 6. Falldarstellung
- 7. Anwendungsmöglichkeit der entsprechenden Vorschriften des SGB II und SGB VIII und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht den potenziellen Widerspruch zwischen § 41 SGB VIII (Förderung eigenverantwortlicher Lebensführung) und § 22 Abs. 2a SGB II (Aufrechterhaltung der familiären Bedarfsgemeinschaft). Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der SGB II-Regelungen auf junge Menschen unter 25 Jahren und fragt nach der Vereinbarkeit mit dem Ziel der Verselbständigung nach § 41 SGB VIII.
- Auswirkungen des SGB II auf junge Menschen unter 25 Jahren
- Der potenzielle Konflikt zwischen § 41 SGB VIII und § 22 Abs. 2a SGB II
- Die Bedeutung eigenverantwortlicher Lebensführung für junge Erwachsene
- Die Rolle der Familie und die Herausforderungen des Übergangs ins Erwachsenenleben
- Möglichkeiten der ergänzenden Handhabung beider Vorschriften
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Verschärfung der Gesetzeslage für junge Menschen unter 25 Jahren durch das SGB II, insbesondere die Sanktionsmöglichkeiten nach § 31 Abs. 5 und 6 SGB II. Sie hebt die potenzielle Unverhältnismäßigkeit dieser Sanktionen hervor und stellt die Problematik des Übergangs von der Schule in den Arbeitsmarkt dar, wobei die schwierige Situation auf dem Ausbildungsmarkt in Limburg-Weilburg im Jahr 2007 als Beispiel genannt wird. Die Einleitung verdeutlicht die Herausforderungen für Familien und junge Menschen in dieser Phase und kündigt die zentrale Forschungsfrage der Arbeit an: den Widerspruch zwischen § 41 SGB VIII und § 22 Abs. 2a SGB II.
2. SGB VIII: Dieses Kapitel behandelt das SGB VIII, insbesondere § 41, der die Förderung einer eigenverantwortlichen Lebensführung junger Menschen zum Ziel hat. Es erläutert die rechtlichen Grundlagen, Anspruchsberechtigten und den Umfang der Leistungen nach § 41 SGB VIII, beleuchtet die Kosten und Fallzahlen und analysiert den Zusammenhang zwischen SGB VIII und SGB II. Der Schwerpunkt liegt auf der Förderung der Selbstständigkeit und der Unterstützung junger Menschen bei ihrem Übergang ins Erwachsenenleben.
3. SGB II: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das SGB II und die für die Arbeit relevanten Gesetzestexte, insbesondere § 22 Abs. 2a und § 31 Abs. 5 SGB II. Es beschreibt die Berechtigten nach SGB II und analysiert die Regelungen zur Aufrechterhaltung der familiären Bedarfsgemeinschaft und die Sanktionen bei Pflichtverletzungen. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen dieser Regelungen auf junge Menschen unter 25 Jahren und ihrem potenziellen Konflikt mit den Zielen des SGB VIII.
4. Arbeitsanweisung der Arge Limburg-Weilburg zum Auszug U25jähriger: Dieses Kapitel beschreibt die konkrete Arbeitsanweisung der Arbeitsgemeinschaft (Arge) in Limburg-Weilburg bezüglich des Auszugs junger Menschen unter 25 Jahren. Es beleuchtet die praktische Umsetzung der gesetzlichen Regelungen und zeigt mögliche Konflikte zwischen den Vorschriften des SGB II und SGB VIII auf der lokalen Ebene.
5. Statistischer Wert zum Auszug in Limburg-Weilburg: Dieses Kapitel präsentiert statistische Daten zum Auszug junger Menschen in Limburg-Weilburg, die im Kontext der gesetzlichen Regelungen und der Arbeitsanweisung der Arge interpretiert werden. Diese Daten dienen als empirische Grundlage für die Argumentation der Arbeit.
6. Falldarstellung: Dieses Kapitel präsentiert einen oder mehrere Fallbeispiele, die die beschriebenen Problematiken und den potenziellen Konflikt zwischen SGB II und SGB VIII veranschaulichen. Die Falldarstellung dient der Veranschaulichung der theoretischen Überlegungen.
Schlüsselwörter
SGB VIII, SGB II, § 41 SGB VIII, § 22 Abs. 2a SGB II, § 31 Abs. 5 SGB II, junge Erwachsene, Verselbständigung, familiäre Bedarfsgemeinschaft, Sanktionen, eigenverantwortliche Lebensführung, Jugendhilfe, Arbeitsmarkt, Ausbildung, psychosoziale Begleitung, Limburg-Weilburg, Profi-Team U25.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studienarbeit: Widerspruch zwischen SGB VIII und SGB II
Was ist der Gegenstand dieser Studienarbeit?
Die Studienarbeit untersucht den potenziellen Widerspruch zwischen § 41 SGB VIII (Förderung eigenverantwortlicher Lebensführung) und § 22 Abs. 2a SGB II (Aufrechterhaltung der familiären Bedarfsgemeinschaft). Im Fokus steht die Auswirkung der SGB II-Regelungen auf junge Menschen unter 25 Jahren und deren Vereinbarkeit mit dem Ziel der Verselbständigung nach § 41 SGB VIII.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Auswirkungen des SGB II auf junge Menschen unter 25, den Konflikt zwischen § 41 SGB VIII und § 22 Abs. 2a SGB II, die Bedeutung eigenverantwortlicher Lebensführung, die Rolle der Familie beim Übergang ins Erwachsenenleben und Möglichkeiten der ergänzenden Handhabung beider Vorschriften. Sie analysiert die gesetzlichen Grundlagen beider Sozialgesetzbücher, die praktische Umsetzung in Limburg-Weilburg (inkl. statistischer Daten) und veranschaulicht die Problematik anhand von Fallbeispielen.
Welche Gesetzestexte stehen im Mittelpunkt der Analyse?
Die zentralen Gesetzestexte sind § 41 SGB VIII (Förderung eigenverantwortlicher Lebensführung), § 22 Abs. 2a SGB II (Aufrechterhaltung der familiären Bedarfsgemeinschaft) und § 31 Abs. 5 SGB II (Sanktionen). Die Arbeit untersucht, wie diese Paragraphen im Kontext des Übergangs junger Erwachsener in die Selbstständigkeit interagieren und welche Konflikte daraus entstehen können.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, SGB VIII (mit Fokus auf § 41), SGB II (mit Fokus auf § 22 Abs. 2a und § 31 Abs. 5), die Arbeitsanweisung der Arge Limburg-Weilburg zum Auszug von U25-Jährigen, statistische Daten zum Auszug in Limburg-Weilburg, eine Falldarstellung und abschließend eine Zusammenfassung mit Fazit zur Anwendungsmöglichkeit der entsprechenden Vorschriften.
Welche Rolle spielen die statistischen Daten?
Statistische Daten zum Auszug junger Menschen in Limburg-Weilburg werden präsentiert und im Kontext der gesetzlichen Regelungen und der Arbeitsanweisung der Arge interpretiert. Sie liefern eine empirische Grundlage für die Argumentation der Arbeit.
Welche konkreten Probleme werden anhand von Fallbeispielen veranschaulicht?
Die Falldarstellung dient dazu, die theoretischen Überlegungen und den potenziellen Konflikt zwischen SGB II und SGB VIII anhand konkreter Beispiele zu veranschaulichen. Die Beispiele zeigen die Herausforderungen, vor denen junge Menschen im Übergang ins Erwachsenenleben stehen, wenn sie die Vorschriften beider Sozialgesetzbücher berücksichtigen müssen.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und zieht Schlussfolgerungen zur Anwendungsmöglichkeit der entsprechenden Vorschriften des SGB II und SGB VIII. Es bewertet den potenziellen Widerspruch zwischen den Zielen der Förderung eigenverantwortlicher Lebensführung und der Aufrechterhaltung der familiären Bedarfsgemeinschaft.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: SGB VIII, SGB II, § 41 SGB VIII, § 22 Abs. 2a SGB II, § 31 Abs. 5 SGB II, junge Erwachsene, Verselbständigung, familiäre Bedarfsgemeinschaft, Sanktionen, eigenverantwortliche Lebensführung, Jugendhilfe, Arbeitsmarkt, Ausbildung, psychosoziale Begleitung, Limburg-Weilburg.
- Quote paper
- Stefan Grösch (Author), 2007, Sozialrecht: Gegenüberstellung der §§ 22 SGB II und 41 SGB VIII, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131173