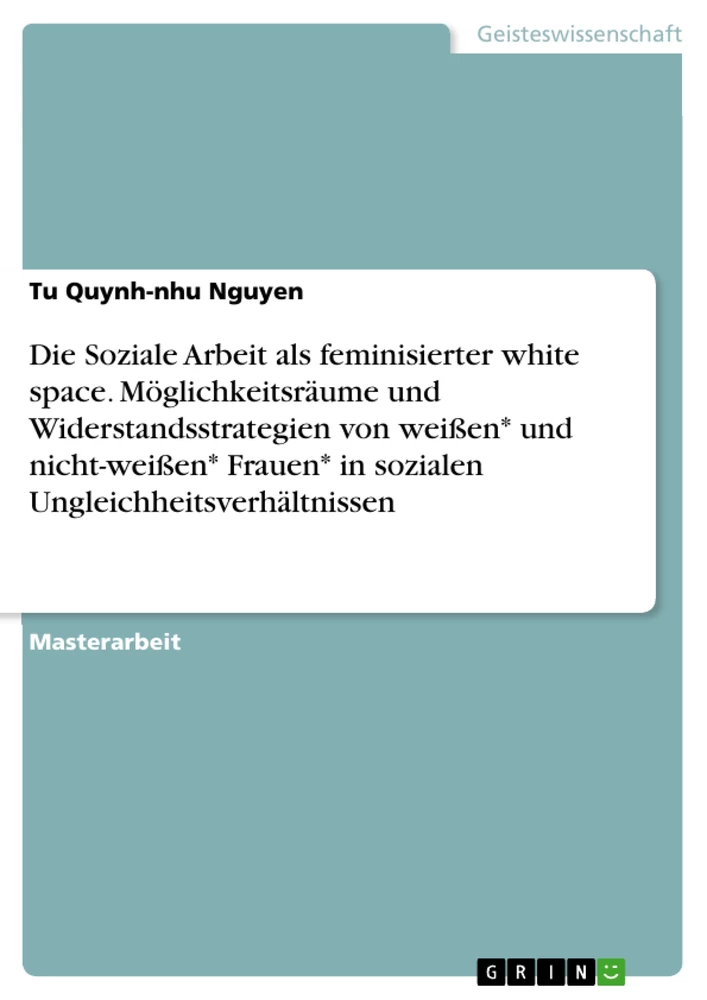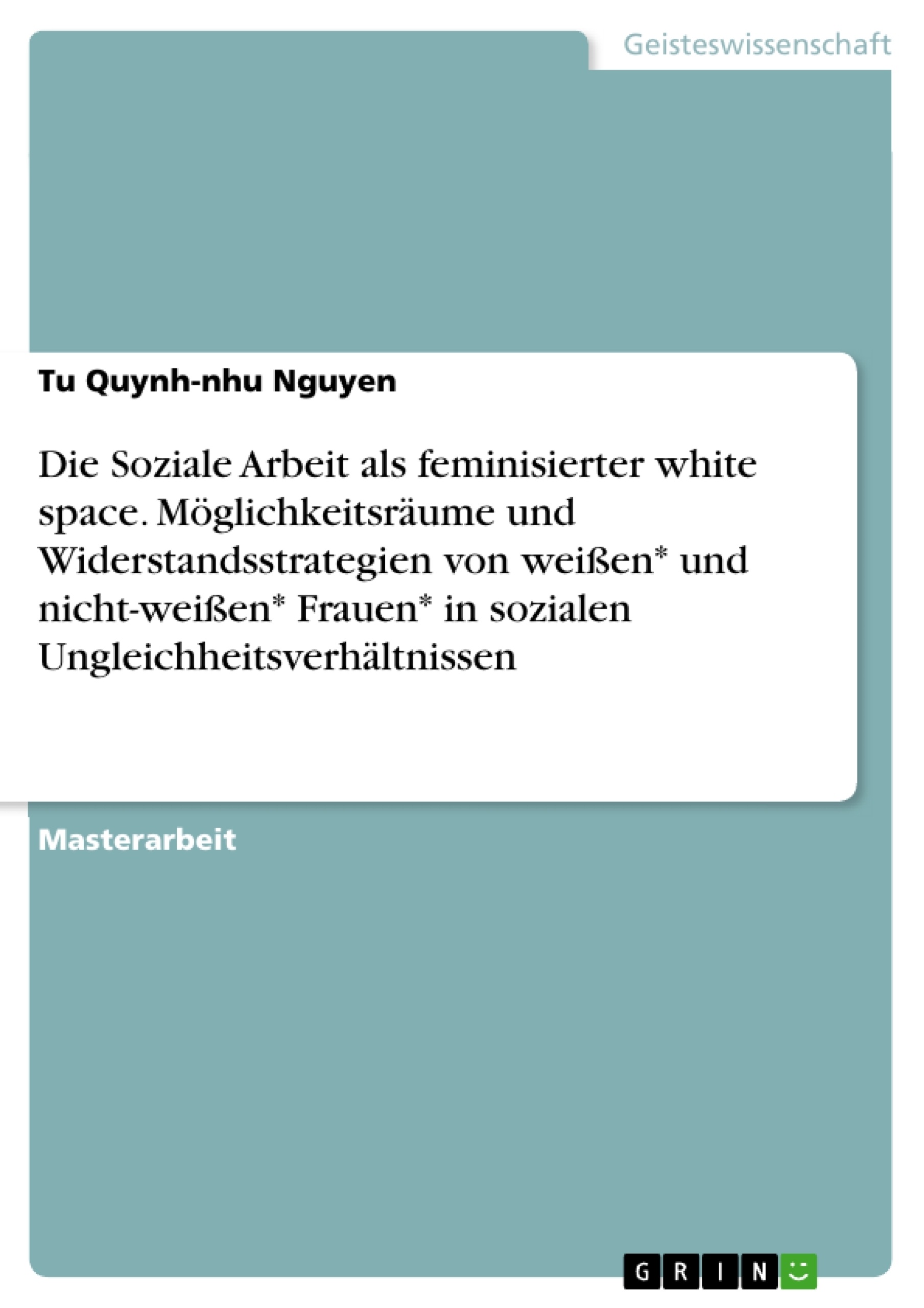Diese Arbeit beschäftigt sich mit Verschränkungen von patriarchalen und rassistischen Ungleichheitsverhältnissen und dessen Auswirkungen auf der Professionsebene der Sozialen Arbeit. Die Arbeit zeichnet nach, inwiefern die Soziale Arbeit sich als ein feminisierter white space herausbildet. Es werden die Perspektiven und Erfahrungshorizonte jener Frauen* in den Blick genommen, die als professionelle Sozialarbeiterinnen* selbst Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen machen. Besonders im Fokus stehen dabei (widerständige) Umgangsweisen von schwarzen Pädagoginnen und Pädagoginnen of Color.
Die Soziale Arbeit gilt als die Menschenrechtsprofession, deren Legitimation sich auf das Fundament der sozialen Gerechtigkeit stützt. Wenn sich eine Berufsgruppe dafür heiligspricht, dass sie sich um die Rechte von marginalisierten Personen(gruppen) ‚kümmert‘, dann die der Sozialarbeiter:innen. Sie geben vor, ständig für Gerechtigkeit zu kämpfen und vermeintlich sichere Orte für von Diskriminierung betroffene Adressat:innen zu schaffen. Dementsprechend glauben sich Sozialarbeiter:innen als Professionelle einer Menschenrechtsprofession per se auf der ‚guten Seite‘ der Gesellschaft. Umso schwieriger wird es – insbesondere für weiße* Professionelle – sich vorzustellen, dass sie selbst Teil ausschließender, rassistischer Strukturen sein könnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die berufliche Geschlechtersegregation auf dem Arbeitsmarkt
- Ursachen der beruflichen Geschlechtersegregation
- Ökonomische Faktoren
- Sozialisatorische Faktoren
- Institutionelle Rahmenbedingungen
- Wohlfahrtsstaatliche Interventionen und Familien- und Sozialpolitik
- Wertewandel
- Doing Gender und stereotype Geschlechtskonstruktion
- Folgen der beruflichen Geschlechtersegregation
- Soziale Arbeit als Frauen*beruf im Kontext von patriarchalen und sexistischen Macht- und Herrschaftsverhältnissen
- Die Entwicklung der Sozialen Arbeit als Frauen*beruf
- Soziale Arbeit im Spannungsfeld von Sozialpolitik als Geschlechterpolitik
- Die Konstruktion von Weiblichkeit* in der Sozialen Arbeit und deren Abwertung
- Diskurs um migrantische Care-Arbeit
- Koloniale Logik der Arbeitsmigration im imperialen Deutschland – Historischer Abriss
- Institutioneller Rassismus
- Ausgrenzende Praktiken der Sozialen Arbeit als staatliche Institution – am Beispiel von Berufsberatungen
- Im Spannungsverhältnis von Anerkennung und Illegitimierung von Diversität
- Strukturen der Sozialen Arbeit als weißes* und akademisiertes Berufsfeld
- Soziale Arbeit als weiße* Kompliz:innenschaft
- Herstellung der (Nicht-) Adressat:innen
- Integration als koloniale Praxis
- Die irritierende Präsenz von Pädagog:innen of Color
- Intersektionale Perspektive
- Subjektive Handlungsfähigkeit als Analysekategorie
- Methoden und Methodologie
- Herleitung der Forschungsfragestellung
- Methode der Datenerhebung
- Biografietheoretische Überlegungen
- Biografisch-narratives Interview
- Datenerhebung
- Sampling und Feldzugang
- Durchführung der Interviews
- Methode der Datenauswertung
- Methodologie der Grounded Theory
- Mehrebenenanalyse nach Christine Riegel
- Prozesse der Subjektbildung - zwischen Widerstand, Selbstermächtigung und hegemonialen Anrufungen
- Berufsmotivation von Schwarzen Frauen*, Frauen* of Color und weißen* Frauen* in sozialen Ungleichheitsverhältnissen
- Weiblichkeits* konzeptionen als relevanter Aspekt der Motivation für soziale Berufe
- Herstellung von sozialen Berufen als rassismusfreie Orte
- Kollektive Erfahrungs- und Verletzungshorizonte - Soziale Arbeit als Empowerment
- Erfahrungen von Schwarzen Frauen*, Frauen* of Color und weißen* Frauen* auf dem Weg zur und in der Sozialen Arbeit als feminisierter white space
- Wirksamkeit als relevante Erfahrung für berufliches Handeln
- Erfahrungen von zu- und abgesprochener Kompetenz
- Erfahrungen von (Un-) Sichtbarkeit
- Erfahrungen der (Nicht-)Zugehörigkeit
- (Widerständige) Umgangsweisen von Schwarzen Pädagoginnen, Pädagoginnen of Color und weißen* Pädagoginnen
- Zwischen (Selbst-) Normalisierung und Denormalisierung von Diskriminierung
- Aneignung von Wissen als Hervorbringung kritischer Handlungsfähigkeit - Transformationsprozesse von Selbst-Weltverhältnissen
- Sprache als Aneignung von Räumen
- Ergebnisdiskussion
- Soziale Praxen sozialer Institutionen - Zwischen Anerkennung, Festschreibung, Verwertung und Ausbeutung
- Subjektiv begründete Strategien des Widerstandes – Zwischen Empowerment, (Selbst-)Normalisierung und Dekonstruktion
- Verteidigung der,Andersheit zur Teilnahme am Universellen (EN)
- Dekonstruktion von, Andersheit zur Einschreibung in die Normalität (ND)
- Erhebung der Gegenstimmen zur machtvollen Normalität (DE)
- Reflexion des Forschungsprozesses
- Reflexion des gemeinsamen Forschungsprozesses
- Reflexion T. Q. Nguyễn
- Reflexion J. Kiebel
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit der Sozialen Arbeit als feminisierter white space und untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen für Frauen* in sozialen Ungleichheitsverhältnissen, insbesondere für Frauen* of Color und schwarze Frauen*. Die Arbeit analysiert die intersektionale Dimension von Geschlecht, Rasse und Klasse in der Sozialen Arbeit und beleuchtet die beruflichen Erfahrungen und Widerstandsstrategien der Protagonistinnen.
- Geschlechtersegregation auf dem Arbeitsmarkt und ihre Folgen für Frauen* in der Sozialen Arbeit
- Rassismus und Diskriminierung in der Sozialen Arbeit
- Die Konstruktion von Weiblichkeit* in der Sozialen Arbeit und deren Abwertung
- Die Rolle der Sozialen Arbeit im Kontext von kolonialen Machtstrukturen und Arbeitsmigration
- Intersektionale Perspektiven auf die Subjektbildung und Handlungsfähigkeit von Frauen* in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Sozialen Arbeit als feminisierter white space ein und erläutert die Relevanz der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die Ursachen und Folgen der beruflichen Geschlechtersegregation am Arbeitsmarkt, während Kapitel 3 die Entwicklung der Sozialen Arbeit als Frauen*beruf im Kontext von patriarchalen Machtverhältnissen diskutiert. In Kapitel 4 und 5 wird der Diskurs um migrantische Care-Arbeit sowie die koloniale Logik der Arbeitsmigration im imperialen Deutschland behandelt. Kapitel 6 analysiert den institutionellen Rassismus in der Sozialen Arbeit am Beispiel von Berufsberatungen. Kapitel 7 widmet sich den Strukturen der Sozialen Arbeit als weißes* und akademisiertes Berufsfeld und beleuchtet die weiße* Kompliz:innenschaft. In Kapitel 8 wird die intersektionale Perspektive eingeführt, und Kapitel 9 behandelt die subjektive Handlungsfähigkeit als Analysekategorie. Kapitel 10 erläutert die Methoden und Methodologie der Arbeit, wobei die biografie-theoretischen Überlegungen und das biografisch-narrative Interview im Mittelpunkt stehen. Kapitel 11 untersucht die Prozesse der Subjektbildung und die Erfahrungen von Frauen* in der Sozialen Arbeit als feminisierter white space. In Kapitel 12 werden die (widerständigen) Umgangsweisen von Frauen* in der Sozialen Arbeit beleuchtet. Kapitel 13 beinhaltet die Ergebnisdiskussion und Kapitel 14 die Reflexion des Forschungsprozesses. Das Fazit und der Ausblick schließen die Arbeit ab.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der Sozialen Arbeit, Geschlechtersegregation, Rassismus, Diskriminierung, Weiblichkeit, Care-Arbeit, Kolonialismus, Arbeitsmigration, institutionelle Strukturen, Intersektionalität, Subjektivität, Handlungsfähigkeit, Widerstand und Empowerment.
- Quote paper
- Tu Quynh-nhu Nguyen (Author), 2021, Die Soziale Arbeit als feminisierter white space. Möglichkeitsräume und Widerstandsstrategien von weißen* und nicht-weißen* Frauen* in sozialen Ungleichheitsverhältnissen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1311570