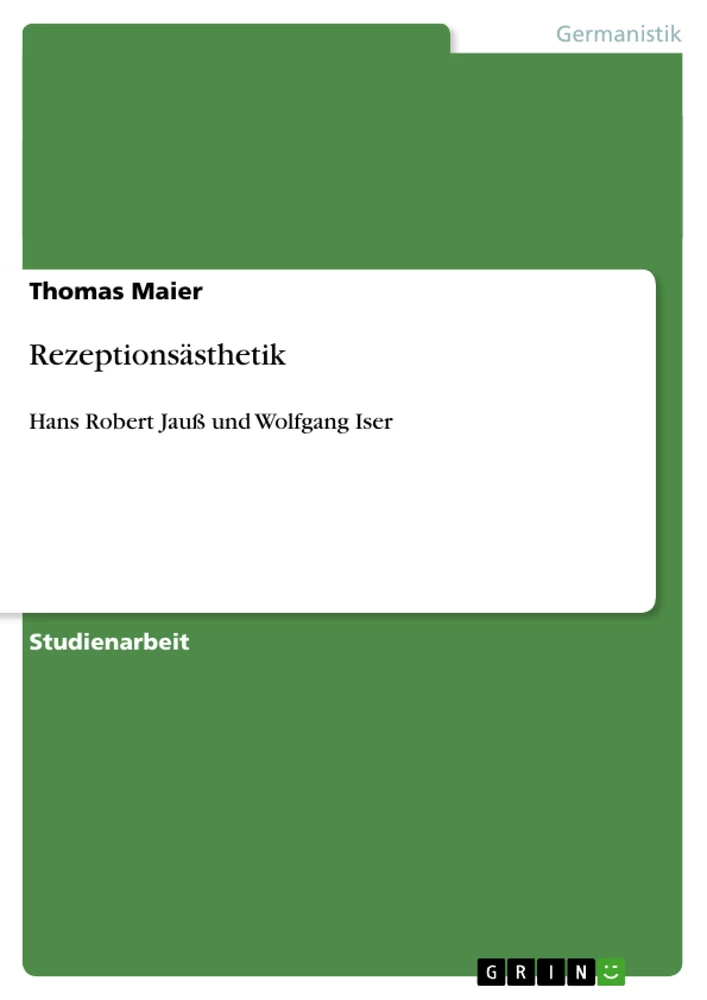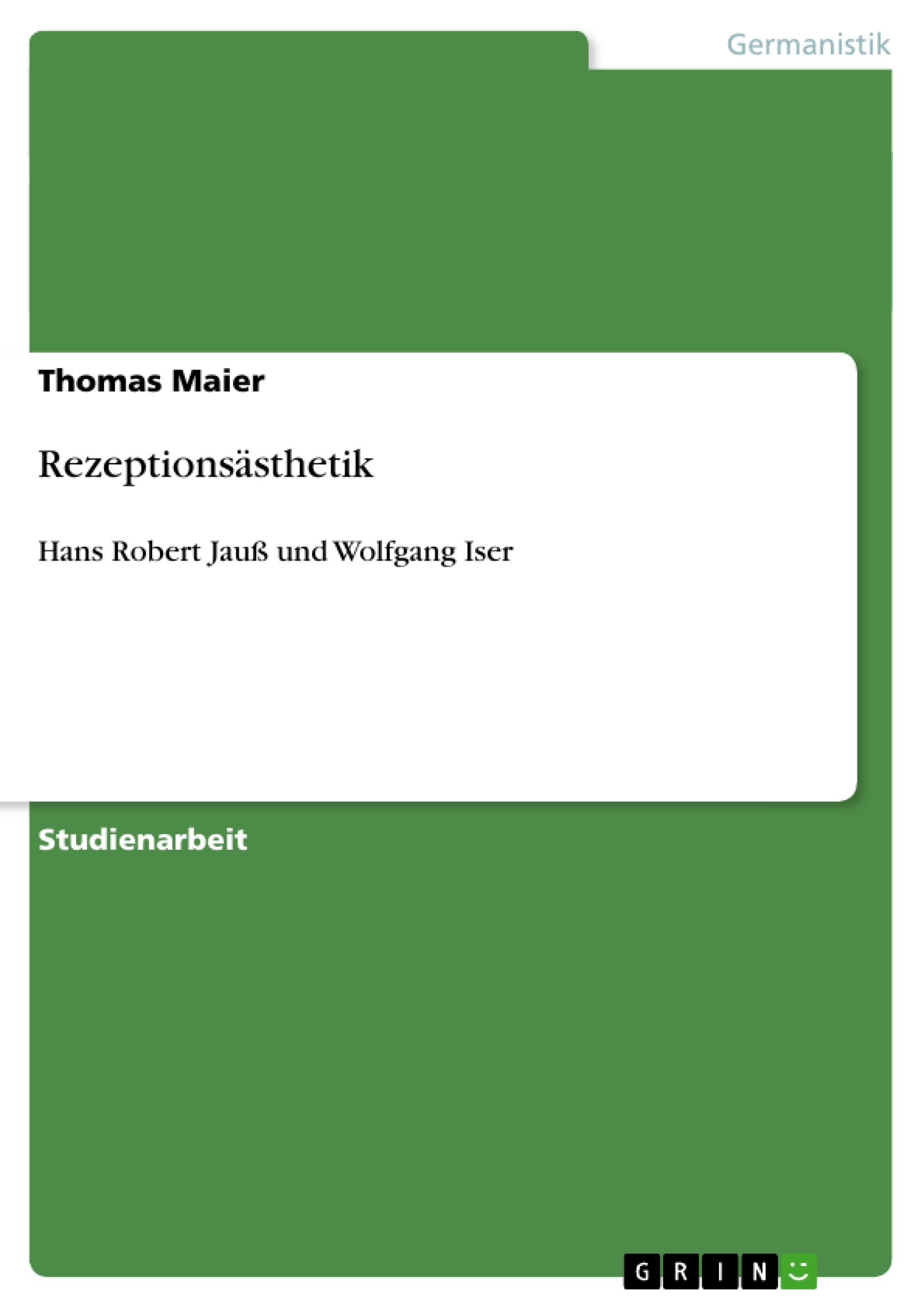Die vorliegende Arbeit zeigt, wo die Diskussion zur literarischen Hermeneutik in den 1960er Jahren angekommen war und zu diesem Zweck werden die Ideen der Begründer der Konstanzer Schule,
Hans Robert Jauß und Wolfgang Iser, vorgestellt. Ihre Rezeptions- bzw. Wirkungsästhetik baut auf der Idee auf, dass ein Text für ein Publikum geschrieben ist, seien es auch Kritiker, andere Autoren oder Zuhörer bzw. Zuschauer, jedoch schreibt kein Autor für die Philologen. Damit geht einher, dass der Leser nicht mehr als jemand beschrieben wird, der die ihm vorliegenden Texte studieren und interpretieren will. Die Philologen sollten sich dementsprechend vermehrt mit der Aufnahme von Werken bei den Lesern beschäftigen.
Inhaltsverzeichnis
- Rezeptionsästhetik
- A. Hans Robert Jauß
- These 1
- These 2
- These 3
- These 4
- These 5
- These 6
- These 7
- B. Wolfgang Iser
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Rezeptionsästhetik, einem wichtigen Zweig der Literaturwissenschaft, der die Bedeutung des Lesers für die Interpretation und Wirkung von Texten betont. Die Arbeit stellt die Ideen von Hans Robert Jauß und Wolfgang Iser vor, die als Begründer der Konstanzer Schule gelten und die Rezeptionsästhetik maßgeblich geprägt haben.
- Die Rolle des Lesers in der Interpretation von Texten
- Die Bedeutung des Erwartungshorizonts für die Rezeption von Literatur
- Die Entwicklung der Literaturgeschichte aus der Perspektive der Rezeptionsästhetik
- Die Aktualisierung von Texten durch den Leser
- Die gesellschaftsbildende Funktion von Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Einführung in die Rezeptionsästhetik und erläutert die historischen Wurzeln der literarischen Hermeneutik. Anschließend werden die 7 Thesen von Hans Robert Jauß vorgestellt, die die Grundprinzipien der Rezeptionsästhetik darlegen. Jauß argumentiert, dass die Literaturgeschichte nicht nur aus den Werken selbst, sondern auch aus deren Rezeption durch die Leser besteht. Er betont die Bedeutung des Erwartungshorizonts, der durch das Vorwissen des Lesers, die Gattung des Werkes und den Kontext der literarischen Epoche geprägt ist. Jauß zeigt, wie der Kunstcharakter eines Werkes durch die Wirkung auf das Publikum bestimmt wird und wie sich die Rezeption eines Werkes im Laufe der Zeit verändert.
Im zweiten Teil des Textes werden die Ideen von Wolfgang Iser vorgestellt, der die Rezeptionsästhetik weiterentwickelt hat. Iser argumentiert, dass Texte keine immanente Bedeutung haben, sondern diese erst durch den Leser aktualisiert wird. Er betont die Bedeutung des „Akt des Lesens“ und die Rolle des Lesers bei der Konstruktion der Bedeutung eines Textes. Iser zeigt, wie die Rezeption eines Textes von der individuellen Erfahrung und dem Vorwissen des Lesers abhängt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Rezeptionsästhetik, die Konstanzer Schule, Hans Robert Jauß, Wolfgang Iser, Erwartungshorizont, Wirkungsästhetik, Literaturgeschichte, Leser, Textinterpretation, Aktualisierung, Kunstcharakter, Literatur und Gesellschaft.
- Arbeit zitieren
- BA Thomas Maier (Autor:in), 2007, Rezeptionsästhetik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131009