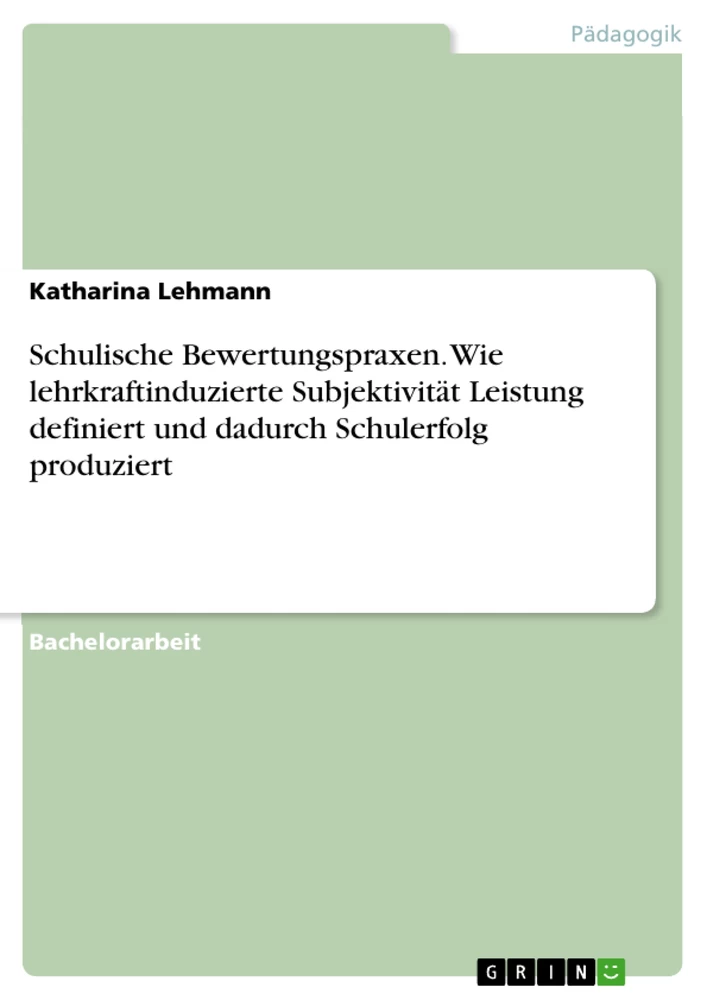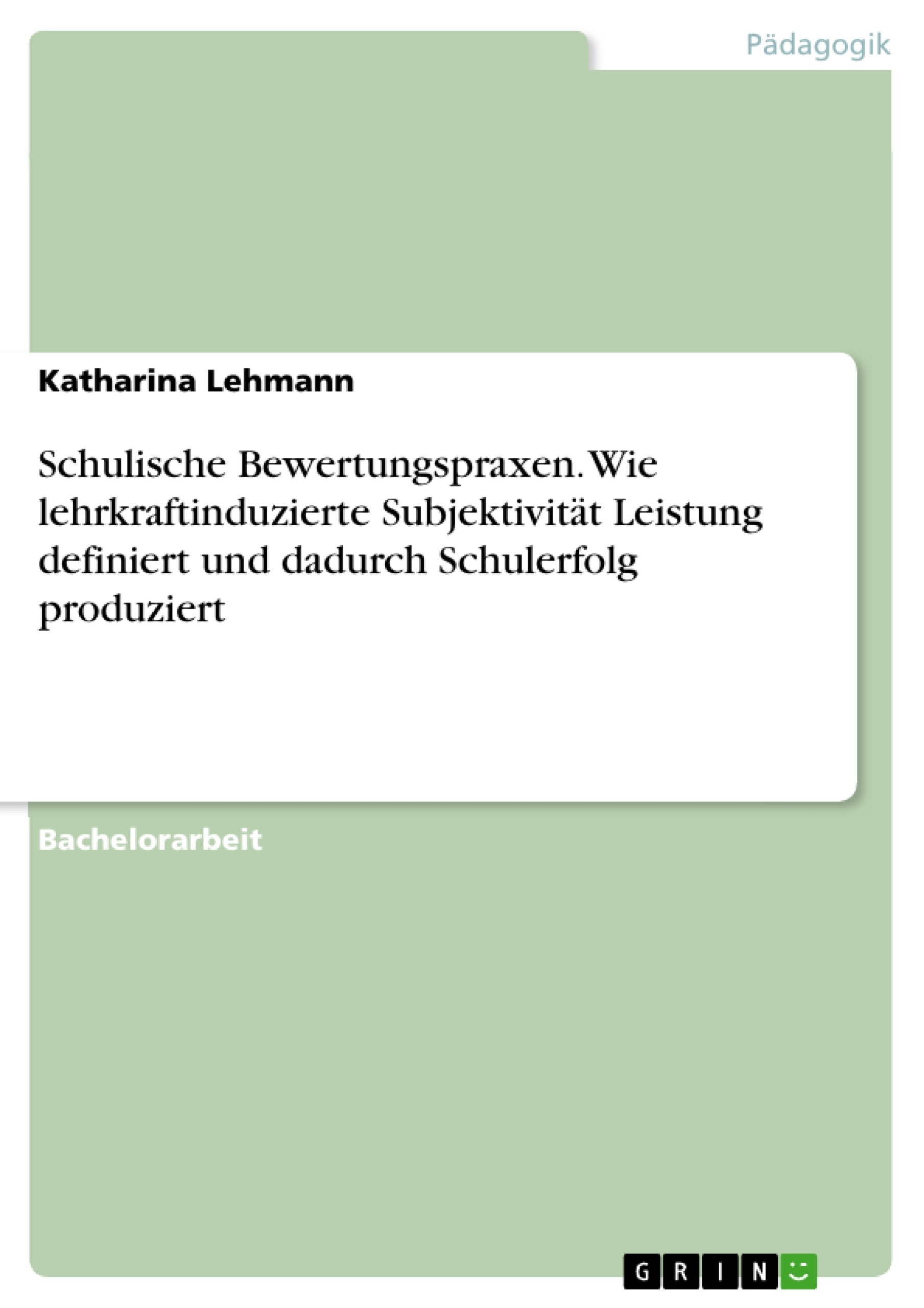Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, darzustellen, wie und in welcher Form lehrkraftinduzierte Subjektivität in der tatsächlichen Praxis der Bewertung wirkt und in welches Verhältnis diese Praxis mit den institutionellen Vorstellungen der Schule tritt. Zur Einführung in das Themenfeld der Bewertungsforschung soll zunächst eruiert werden, wo der Leistungsgedanke seinen Ursprung hat und wie er schließlich in schulischen Kontexten Anwendung fand. Im Zuge dessen sollen Schulnoten als gewählte Möglichkeit der Operationalisierung von Leistung betrachtet und ein kurzer historischer Überblick über die die Einführung von Ziffernnoten dargeboten werden.
Um die übergreifende Bedeutung von Schule für das gesellschaftliche System zu veranschaulichen, sollen zudem aus strukturfunktionalistischer Perspektive die sozialen Funktionen von Schule erläutert werden. Im Rahmen dieser Betrachtung von Schule als gesellschaftsdienlicher Sozialisationsinstanz soll eine Auseinandersetzung mit dem Konzept der Meritokratie erfolgen. In diesem Zusammenhang soll auch in Kürze erläutert werden, inwiefern eine Leistungsgesellschaft Schule als System in ihren Funktionen für sich beansprucht und wie die entsprechende Leistung in der Schule konstruiert und anerkannt wird. In dem Verständnis von Leistung als Konstrukt soll vertiefend die Funktion von Leistung in der Gesellschaft im Allgemeinen und der Schule im Besonderen erfasst und im Sinne des Doing Difference-Ansatzes näher ausgeführt werden. Innerhalb dieses Prozesses der Humandifferenzierung sollen die Rollen und Aufgaben von Schüler*innen und Lehrer*innen bestimmt und beschrieben werden.
Zur Verknüpfung von Theorie und Praxis soll im Folgenden anhand gesetzlicher Vorgaben und regulativer Normen überprüft werden, inwiefern das theoretische Leistungskonzept in der Praxis – zumindest qua Vorschrift – Anwendung finden kann. Die institutionellen Anleitungen der Makroebene werden so den in dieser Arbeit analysierten tatsächlichen Praktiken der Mikroebene gegenübergestellt; es erfolgt also gleichsam eine Überprüfung der Umsetzung des vorgegebenen Ideals.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Auseinandersetzung mit dem Leistungsbegriff in schulischen Kontexten
- Historische Genese der Leistungsidee
- Zum Konzept Schule und der Operationalisierung von schulischer Leistung durch Noten
- Sozialkonstruktivistisches Verständnis in der Soziologie
- Praktische Umsetzung des Leistungskonzepts
- Empirische Analyse: Konstruktion schulischer Leistung in der Überprüfung und Bewertung durch Lehrkräfte
- Leistungsbewertung im Rahmen der Klausurkorrektur
- Leistungsbewertung im Rahmen der mündlichen Abiturprüfung
- Leistungsbewertung im Rahmen der Notenbesprechung mit Schüler*innen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Konstruktion von schulischer Leistung im Bewertungsprozess und untersucht, wie lehrkraftinduzierte Subjektivität diese beeinflusst und damit den Schulerfolg von Schüler*innen produziert.
- Historische Genese des Leistungsbegriffs und seine Anwendung im schulischen Kontext
- Konzept der Meritokratie und die Rolle der Schule als Sozialisationsinstanz
- Sozialkonstruktivistisches Verständnis von Leistung und die Funktion von Lehrkräften im Bewertungsprozess
- Empirische Analyse von verschiedenen Bewertungssituationen (Klausurkorrektur, mündliche Abiturprüfung, Notenbesprechung)
- Die Auswirkungen lehrkraftinduzierter Subjektivität auf die Produktion schulischen Erfolgs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Forschungsgegenstand der Arbeit vor, skizziert den aktuellen Forschungsstand und erläutert den methodischen Ansatz. Sie beschreibt die Bedeutung von lehrkraftinduzierter Subjektivität im Kontext der Konstruktion von schulischer Leistung und zeigt die Relevanz des Themas für das Verständnis von Schule als Sozialisationsinstanz und Reproduktionsmechanismus sozialer Ungleichheit.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Leistungsbegriff und seiner historischen Entwicklung. Dabei werden die Operationalisierung von Leistung durch Noten, die sozialen Funktionen von Schule und die Bedeutung der Meritokratie für das Verständnis von Leistung in der Gesellschaft behandelt. Das Kapitel analysiert das sozialkonstruktivistische Verständnis von Leistung und die Rolle der Lehrkraft im Bewertungsprozess.
Im dritten Kapitel wird die empirische Analyse vorgestellt, die anhand von drei verschiedenen Bewertungssituationen – Klausurkorrektur, mündliche Abiturprüfung und Notenbesprechung – die lehrkraftinduzierte Subjektivität im Bewertungsvorgang untersucht. Dabei wird gezeigt, wie Lehrkräfte in die Konstruktion der Schüler*innenleistung eingebunden sind und welche Auswirkungen ihr Handeln auf die Produktion von Schulerfolg hat.
Das Fazit fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen und zeigt die Implikationen für die Praxis schulischer Bewertung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der schulischen Bewertungspraxis und den sie prägenden Konzepten. Zu den wichtigsten Schlüsselwörtern zählen: lehrkraftinduzierte Subjektivität, schulische Leistung, Bewertungsprozess, Konstruktion von Leistung, Schulerfolg, Sozialisation, Meritokratie, Doing Difference-Ansatz.
- Quote paper
- Katharina Lehmann (Author), 2022, Schulische Bewertungspraxen. Wie lehrkraftinduzierte Subjektivität Leistung definiert und dadurch Schulerfolg produziert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1309518