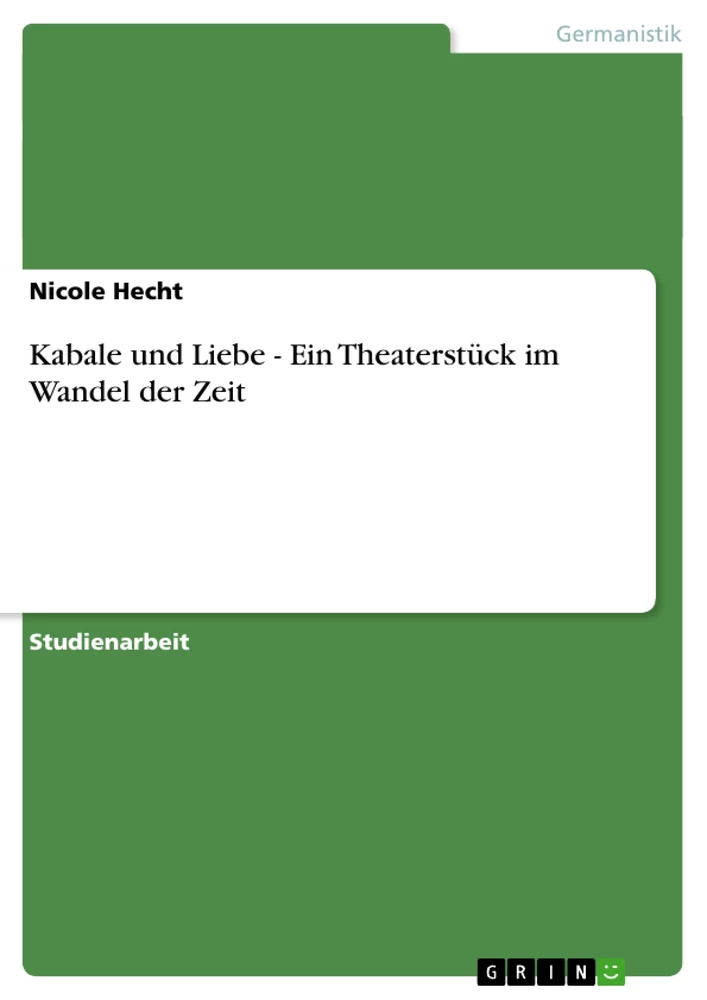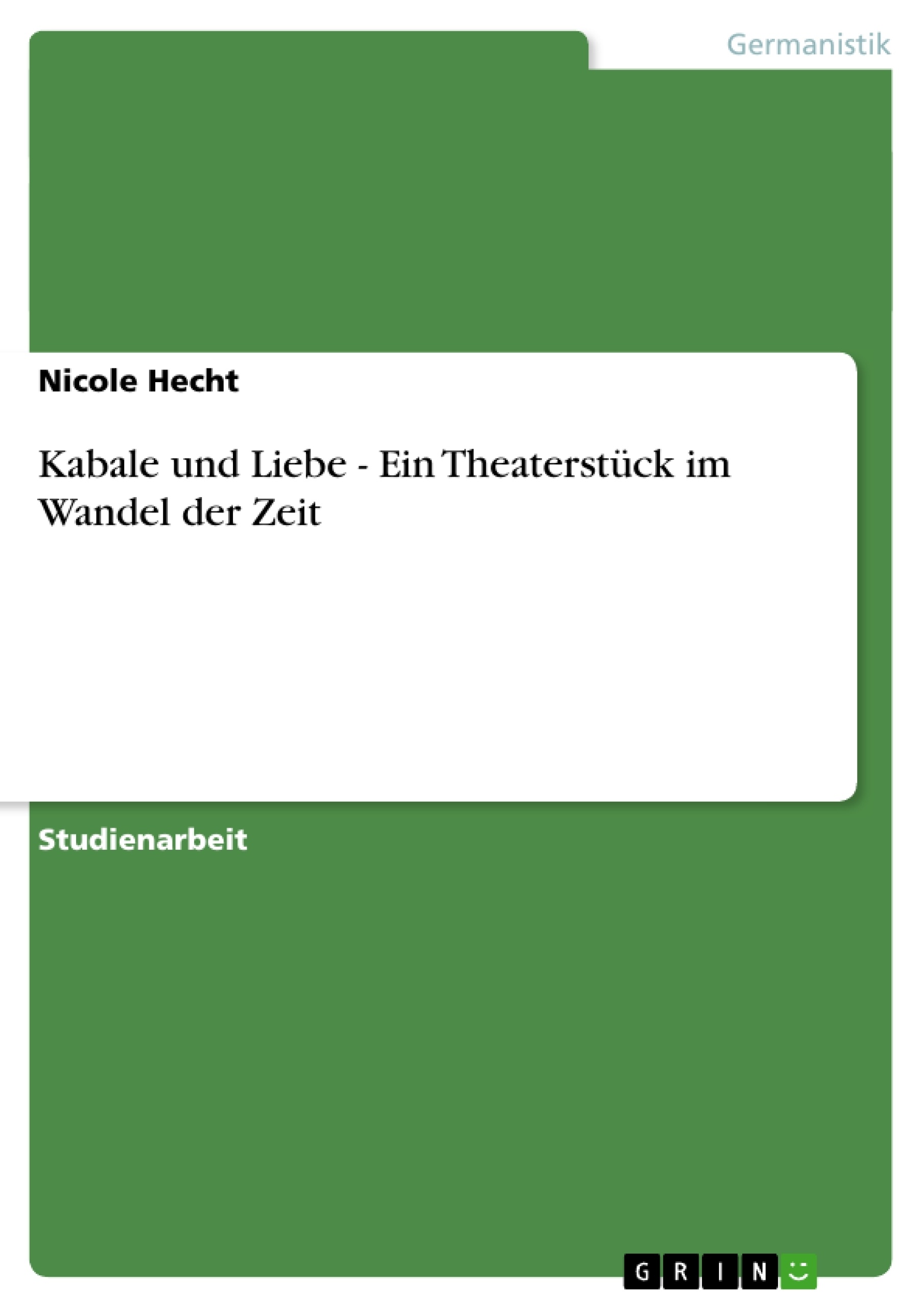„Kabale und Liebe“ ist eines der meistgespielten Stücke Schillers.
Obwohl die Materie dieses bürgerlichen Trauerspiels zunächst fremd und wie aus einer anderen Zeit anmutet, ist sie dennoch zeitlos. Allerdings haben sich mit dem Wandel der Zeit haben sich auch die Inszenierungen dieses Theaterstücks geändert. Längst nicht jeder Regisseur hält sich an Schillers Vorgaben und versucht dadurch „Kabale und Liebe“ dem Strom der Zeit anzupassen. Aber nicht jede moderne Inszenierung wird ein Erfolg, denn Erwartungshaltungen werden enttäuscht, Kritik an der modernen Auffassung des Regisseurs wird laut – ein Theaterskandal entsteht.
In dieser Arbeit sollen drei Inszenierungen untersucht werden die zu ihrer Zeit als skandalös galten: Gustav Lindemanns Inszenierung 1925 in Düsseldorf, Fritz Kortners 1965 in München und Jürgen Kruses Inszenierung 1996 in Bochum.
Nachdem im ersten Teil kurz die Entstehungsgeschichte und eine Inhaltsangabe von „Kabale und Liebe“ gegeben worden sind, werden im zweiten Punkt die drei Inszenierungen ausführlich untersucht und besprochen. Dieser Untersuchung folgt im dritten Teil ein Vergleich der die Unterschiede herausstellen soll und somit den Wandel dieses Theaterstücks deutlich macht. Dies geschieht erst allgemein und dann wird der Wandel nochmals durch den Vergleich der verschiedenen Rollenauffassungen der Figur „Wurm“ gezeigt.
Es soll auch versucht werden, eine Erklärung abzugeben weshalb diese Stücke zu einem Skandal wurden, da diese Arbeit jedoch hauptsächlich Theaterrezensionen als Grundlage benutzt, können meistens nur Vermutungen geäußert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- 1. Allgemeines über „Kabale und Liebe“
- 1.1 Entstehungsgeschichte von Schillers „Kabale und Liebe“
- 1.2 Inhalt des bürgerlichen Trauerspiels „Kabale und Liebe“
- 2. Untersuchung von „Kabale und Liebe“-Inszenierungen
- 2.1 Gustav Lindemanns Inszenierung 1925 in Düsseldorf
- 2.1.1 Die Regie Gustav Lindemanns
- 2.1.2 Das Bühnenbild von Eduard Sturm
- 2.1.3 Die Rollenauffassung 1925
- 2.2 Fritz Kortners Inszenierung 1965 in München
- 2.2.1 Die Regie Fritz Kortners
- 2.2.2 Das Bühnenbild von H.W. Lenneweit
- 2.2.3 Die Rollenauffassung 1965
- 2.3 Jürgen Kruses Inszenierung 1996 in Bochum
- 2.3.1 Die Regie Jürgen Kruses
- 2.3.2 Das Bühnenbild von Franz Koppendorfer
- 2.3.3 Die Rollenauffassung 1996
- 2.1 Gustav Lindemanns Inszenierung 1925 in Düsseldorf
- 3. Vergleich der Inszenierungen
- 3.1 Der Wandel, dargestellt im allgemeinen Vergleich
- 3.2 Der Wandel, dargestellt am Wandel der Figur „Wurm“
- 1. Allgemeines über „Kabale und Liebe“
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Inszenierungsgeschichte von Schillers „Kabale und Liebe“ anhand dreier Aufführungen, die jeweils für Skandale sorgten. Ziel ist es, den Wandel der Interpretation und Inszenierung dieses Stücks im Laufe der Zeit zu beleuchten und die Gründe für die jeweiligen Kontroversen zu analysieren.
- Der Wandel der Inszenierung von Schillers „Kabale und Liebe“ im 20. Jahrhundert.
- Analyse der jeweiligen Regiekonzepte, Bühnenbilder und Rollenauffassungen.
- Untersuchung der gesellschaftlichen und kulturellen Kontexte der Aufführungen.
- Die Rolle der Figur „Wurm“ in den verschiedenen Inszenierungen.
- Der Einfluss von gesellschaftlichen Veränderungen auf die Rezeption des Stücks.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Relevanz von Schillers „Kabale und Liebe“ als zeitloses Stück trotz seines historischen Kontextes. Sie benennt die drei untersuchten Inszenierungen und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich auf die Entstehungsgeschichte des Stücks, die Analyse der drei Inszenierungen und einen Vergleich konzentriert, um den Wandel des Theaterstücks aufzuzeigen. Die Arbeit versucht auch, die Gründe für die Skandale um die Aufführungen zu beleuchten, wobei sie sich auf Theaterkritiken und Vermutungen stützt.
1. Allgemeines über „Kabale und Liebe“: Dieses Kapitel behandelt zunächst die Entstehungsgeschichte von Schillers Drama, beginnend mit der Idee während Schillers Arrest im Jahr 1782 bis hin zur Erstaufführung. Die Darstellung beleuchtet Schillers schwieriges Verhältnis zum Herzog Karl Eugen, den Einfluss des württembergischen Hofes auf die Handlung und Schillers Reise nach Mannheim und Oggersheim. Das Kapitel geht auch auf die Inspiration durch die Verhältnisse an absolutistischen Höfen ein und analysiert die Verwendung von historischen Vorlagen für Figuren wie Lady Milford, in Bezug auf die Mätressen am Hof.
2. Untersuchung von „Kabale und Liebe“-Inszenierungen: Dieses Kapitel analysiert detailliert drei unterschiedliche Inszenierungen von „Kabale und Liebe“: Lindemanns Inszenierung von 1925 in Düsseldorf, Kortners Inszenierung von 1965 in München und Kruses Inszenierung von 1996 in Bochum. Für jede Inszenierung wird die Regie, das Bühnenbild und die Rollenauffassung im Detail untersucht, wobei auf die spezifischen Merkmale jeder Inszenierung eingegangen wird, um die jeweiligen künstlerischen Entscheidungen und deren Wirkung auf das Publikum zu verstehen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Inszenierungsentscheidungen und ihrer Rezeption im jeweiligen historischen Kontext.
3. Vergleich der Inszenierungen: Der Vergleich der drei Inszenierungen zeigt den Wandel der Interpretation und Inszenierung von Schillers Drama über die Zeit auf. Der Vergleich konzentriert sich zunächst auf allgemeine Unterschiede im Ansatz der jeweiligen Regie, in den Bühnenbildern und der Gesamtwirkung der Aufführungen. Anschließend wird der Wandel detailliert an der Figur des „Wurm“ veranschaulicht, indem die unterschiedlichen Interpretationen dieser Figur in den drei Inszenierungen gegenübergestellt und analysiert werden, um aufzuzeigen, wie sich die Relevanz und Bedeutung dieser Figur im Laufe der Zeit verändert hat. Dies veranschaulicht den Einfluss von gesellschaftlichen Veränderungen auf die Inszenierung des Stücks.
Schlüsselwörter
Schiller, Kabale und Liebe, bürgerliches Trauerspiel, Theaterinszenierung, Regie, Bühnenbild, Rollenauffassung, Theaterskandal, Gustav Lindemann, Fritz Kortner, Jürgen Kruse, gesellschaftlicher Wandel, Zeitgeschichte, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen zu: Inszenierungsgeschichte von Schillers „Kabale und Liebe“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Inszenierungsgeschichte von Friedrich Schillers „Kabale und Liebe“ anhand dreier Aufführungen aus den Jahren 1925, 1965 und 1996. Der Fokus liegt auf dem Wandel der Interpretation und Inszenierung des Stücks im Laufe der Zeit und den Gründen für die jeweiligen Skandale um die Aufführungen.
Welche Inszenierungen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Inszenierungen von Gustav Lindemann (1925, Düsseldorf), Fritz Kortner (1965, München) und Jürgen Kruse (1996, Bochum). Für jede Inszenierung werden Regie, Bühnenbild und Rollenauffassung detailliert untersucht.
Welche Aspekte der Inszenierungen werden im Detail betrachtet?
Die Analyse umfasst die Regiekonzepte, die Bühnenbilder (inkl. der jeweiligen Bühnenbildner: Eduard Sturm, H.W. Lenneweit und Franz Koppendorfer), die Rollenauffassungen und die Rezeption der Aufführungen im jeweiligen historischen Kontext. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Wandel der Interpretation der Figur "Wurm".
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet den Wandel der Interpretation und Inszenierung von Schillers „Kabale und Liebe“ im 20. Jahrhundert. Sie analysiert die gesellschaftlichen und kulturellen Kontexte der Aufführungen und untersucht den Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf die Rezeption des Stücks.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil mit Kapiteln zur Entstehungsgeschichte von „Kabale und Liebe“, zur Analyse der drei Inszenierungen und einem Vergleich der Inszenierungen, sowie einem Schlusswort. Der Hauptteil beinhaltet auch eine detaillierte Betrachtung der Figur "Wurm" im Wandel der Zeit.
Welche Rolle spielt die Figur "Wurm" in der Analyse?
Die Figur "Wurm" dient als Beispiel, um den Wandel der Interpretation des Stücks über die Zeit zu veranschaulichen. Die Arbeit vergleicht die unterschiedlichen Interpretationen dieser Figur in den drei Inszenierungen und analysiert, wie sich ihre Relevanz und Bedeutung im Laufe der Zeit verändert hat.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schiller, Kabale und Liebe, bürgerliches Trauerspiel, Theaterinszenierung, Regie, Bühnenbild, Rollenauffassung, Theaterskandal, Gustav Lindemann, Fritz Kortner, Jürgen Kruse, gesellschaftlicher Wandel, Zeitgeschichte, Rezeption.
Warum wurden die ausgewählten Inszenierungen ausgewählt?
Die ausgewählten Inszenierungen wurden aufgrund ihrer jeweiligen Skandale und ihrer repräsentativen Bedeutung für den Wandel der Interpretation und Inszenierung von Schillers „Kabale und Liebe“ im 20. Jahrhundert ausgewählt. Die Arbeit stützt sich auf Theaterkritiken und Vermutungen, um die Gründe für diese Skandale zu beleuchten.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, beschreibt die Relevanz von Schillers „Kabale und Liebe“ und benennt die drei untersuchten Inszenierungen. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und beleuchtet die Bedeutung der Skandale um die Aufführungen.
Was wird im Kapitel über die Entstehungsgeschichte von "Kabale und Liebe" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte von Schillers Drama, beginnend mit seiner Entstehung während seines Arrestes bis hin zur Erstaufführung. Es behandelt Schillers Verhältnis zum Herzog Karl Eugen, den Einfluss des württembergischen Hofes und die Inspiration durch die Verhältnisse an absolutistischen Höfen.
Was wird im Schlusswort behandelt?
(Der Inhalt des Schlussworts wird in der Zusammenfassung nicht explizit genannt.)
- Quote paper
- M.A. Nicole Hecht (Author), 2002, Kabale und Liebe - Ein Theaterstück im Wandel der Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130919