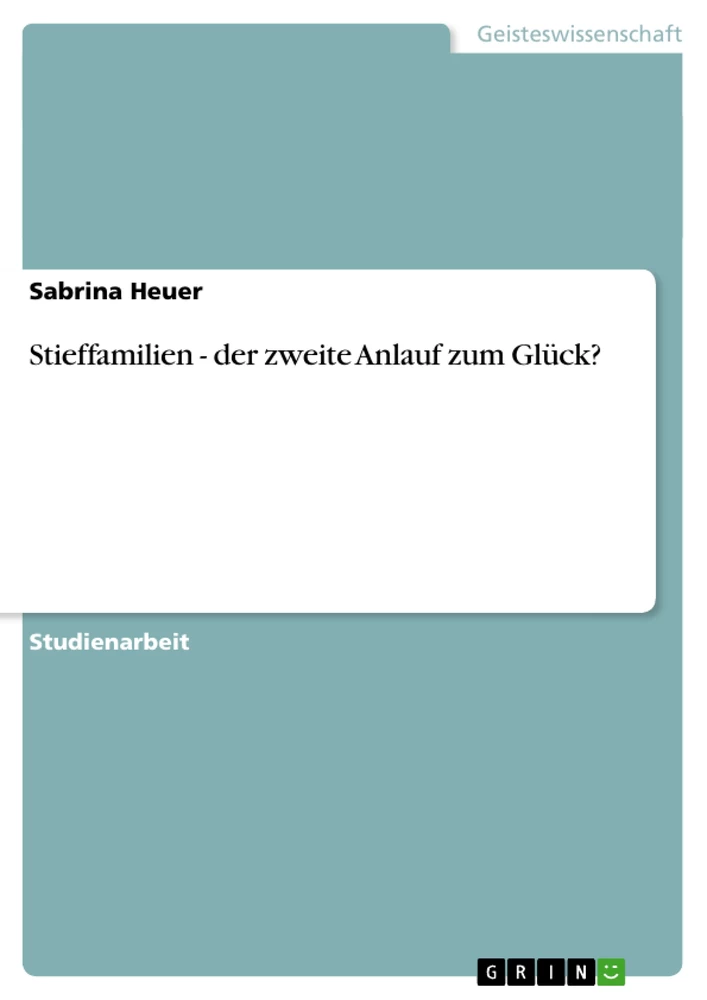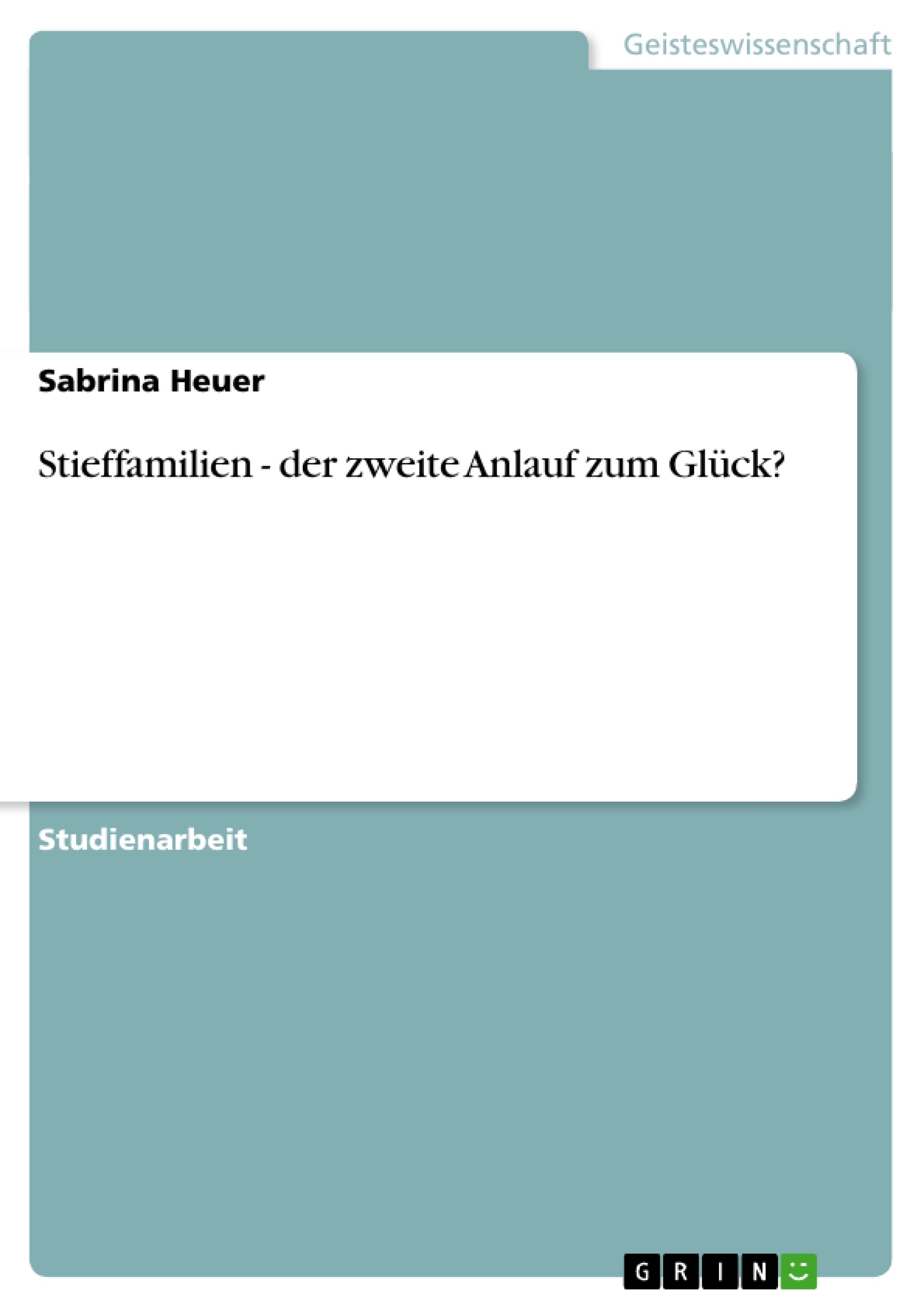Die uns vertraute traditionelle Kernfamilie, bestehend aus Vater, Mutter und mindes-tens einem Kind, hat Konkurrenz bekommen von einem Modell, das viele verschie-dene Namen trägt: Stieffamilie, Folgefamilie, Legofamilie oder Patchworkfamilie. Nach Schätzungen gibt es in Deutschland mittlerweile 2,6 Millionen solcher Famili-ensysteme, was ungefähr jedem 5. Haushalt entspricht und zahlenmäßig nur noch von der Kernfamilie sowie der Ein-Elternfamilie übertroffen wird.
Eine Erfindung der Neuzeit sind Stieffamilien dennoch nicht. Aufgrund der hohen Wochenbettsterblichkeit und infolge von Kriegen waren sie in früheren Zeiten eben-so verbreitet, sodass nach dem Zweiten Weltkrieg etwa ein Viertel der Kinder eine neue Partnerschaft eines Elternteils erlebte. Geändert haben sich allerdings die Ent-stehungshintergründe, denn während Stieffamilien bis in das 20. Jahrhundert in der Regel eine durch Schicksalsschläge erzwungene Lebensform darstellten, um das wirtschaftliche Überleben der Familie zu sichern, werden sie heute frei gewählt und entstehen meist nach einer Scheidung oder Trennung. Nur in 6 % der Fälle geht der Gründung einer Stieffamilie der Tod eines Ehepartners beziehungsweise Elternteils voraus, während in rund 88 % eine Trennung und in 8 % eine nichteheliche Geburt ursächlich für die Entstehung des neuen Familiensystems sind.
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Vorgehensweise und Zielsetzung
- Begriffsklärung
- Strukturen einer Stieffamilie
- Die Stiefvaterfamilie
- Die Stiefmutterfamilie
- Die zusammengesetzte Stieffamilie
- Die komplexe Stieffamilie
- Die Entwicklungsphasen einer Stieffamilie
- Rechtliche Grundlagen von Stieffamilien
- Problembereiche von Stieffamilien
- Anpassungs- und Konfliktbewältigungsstrategien von Stieffamilien
- Hilfen für Stieffamilien
- Die Stieffamilie als ein zweiter Anlauf zum Glück?
- Literaturnachweis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit dem Thema Stieffamilien und analysiert die Herausforderungen und Chancen dieser Familienform. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis für die verschiedenen Strukturen, Entwicklungsphasen und Problemfelder von Stieffamilien zu entwickeln. Dabei werden sowohl rechtliche Grundlagen als auch praktische Aspekte der Lebensgestaltung in Stieffamilien beleuchtet.
- Strukturen und Formen von Stieffamilien
- Entwicklungsphasen und Herausforderungen in Stieffamilien
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Besonderheiten
- Anpassungs- und Konfliktbewältigungsstrategien
- Hilfsangebote und Unterstützungsmöglichkeiten für Stieffamilien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Stieffamilien ein und beleuchtet die steigende Bedeutung dieser Familienform in der heutigen Gesellschaft. Die Problemstellung verdeutlicht die Notwendigkeit einer intensiven Auseinandersetzung mit den Besonderheiten und Herausforderungen von Stieffamilien. Die Zielsetzung der Arbeit wird dargelegt und die Vorgehensweise erläutert.
Das Kapitel "Begriffsklärung" definiert den Begriff der Stieffamilie und differenziert zwischen verschiedenen Strukturen und Formen, wie der Stiefvaterfamilie, der Stiefmutterfamilie, der zusammengesetzten Stieffamilie und der komplexen Stieffamilie. Die verschiedenen Familienmodelle werden anhand von Strukturbildern veranschaulicht.
Das Kapitel "Die Entwicklungsphasen einer Stieffamilie" analysiert die verschiedenen Phasen, die eine Stieffamilie durchläuft. Dabei werden die Herausforderungen und Chancen der einzelnen Phasen beleuchtet und die Bedeutung von Kommunikation und Anpassungsprozessen hervorgehoben.
Das Kapitel "Rechtliche Grundlagen von Stieffamilien" befasst sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen von Stieffamilien. Die rechtlichen Besonderheiten im Vergleich zur traditionellen Kernfamilie werden erläutert und die Bedeutung von Sorgerecht, Umgangsrecht und Unterhaltspflicht in Stieffamilien hervorgehoben.
Das Kapitel "Problembereiche von Stieffamilien" analysiert die Herausforderungen und Konflikte, die in Stieffamilien auftreten können. Dabei werden Themen wie die Integration von Stiefkindern, die Beziehung zwischen Stiefeltern und Stiefkindern, die Rolle der leiblichen Eltern und die Bewältigung von Verlusten und Trauerprozessen beleuchtet.
Das Kapitel "Anpassungs- und Konfliktbewältigungsstrategien von Stieffamilien" stellt verschiedene Strategien vor, die zur Bewältigung von Herausforderungen und Konflikten in Stieffamilien beitragen können. Dabei werden die Bedeutung von Kommunikation, Kompromissbereitschaft, Familientherapie und anderen Hilfsangeboten hervorgehoben.
Das Kapitel "Hilfen für Stieffamilien" stellt verschiedene Hilfsangebote und Unterstützungsmöglichkeiten für Stieffamilien vor. Dabei werden Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Familientherapie und andere Unterstützungsmöglichkeiten vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Stieffamilien, Folgefamilien, Legofamilien, Patchworkfamilien, Familienstrukturen, Entwicklungsphasen, rechtliche Grundlagen, Problembereiche, Anpassungsstrategien, Konfliktbewältigung, Hilfen für Stieffamilien, Integration von Stiefkindern, Beziehung zwischen Stiefeltern und Stiefkindern, Rolle der leiblichen Eltern, Verlustbewältigung, Trauerprozesse, Kommunikation, Kompromissbereitschaft, Familientherapie, Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen.
- Quote paper
- Sabrina Heuer (Author), 2006, Stieffamilien - der zweite Anlauf zum Glück?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130821