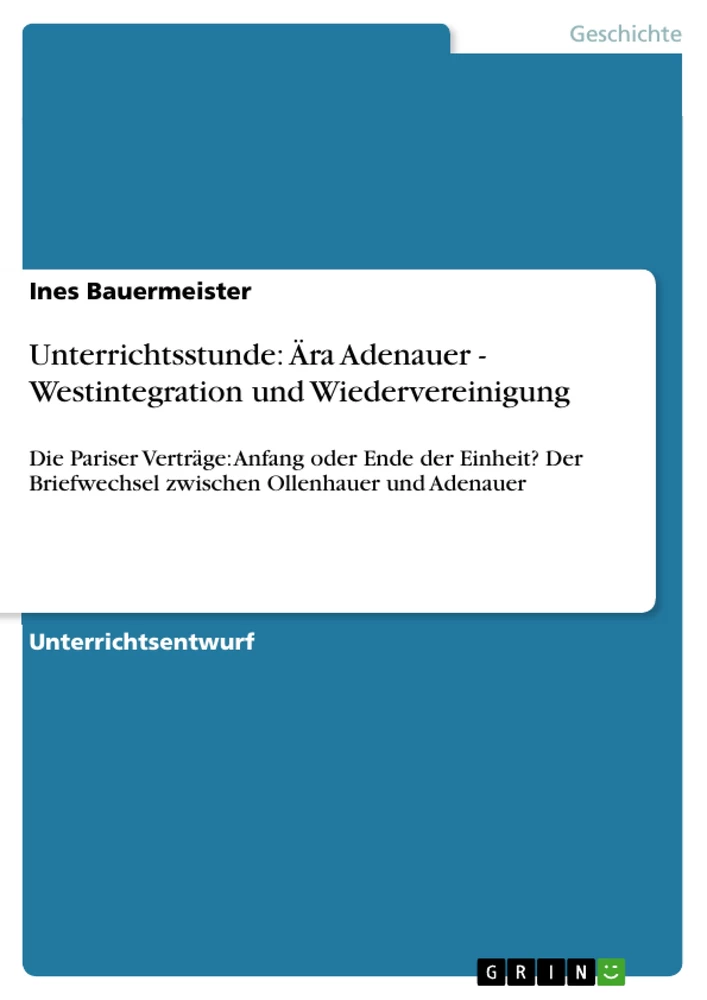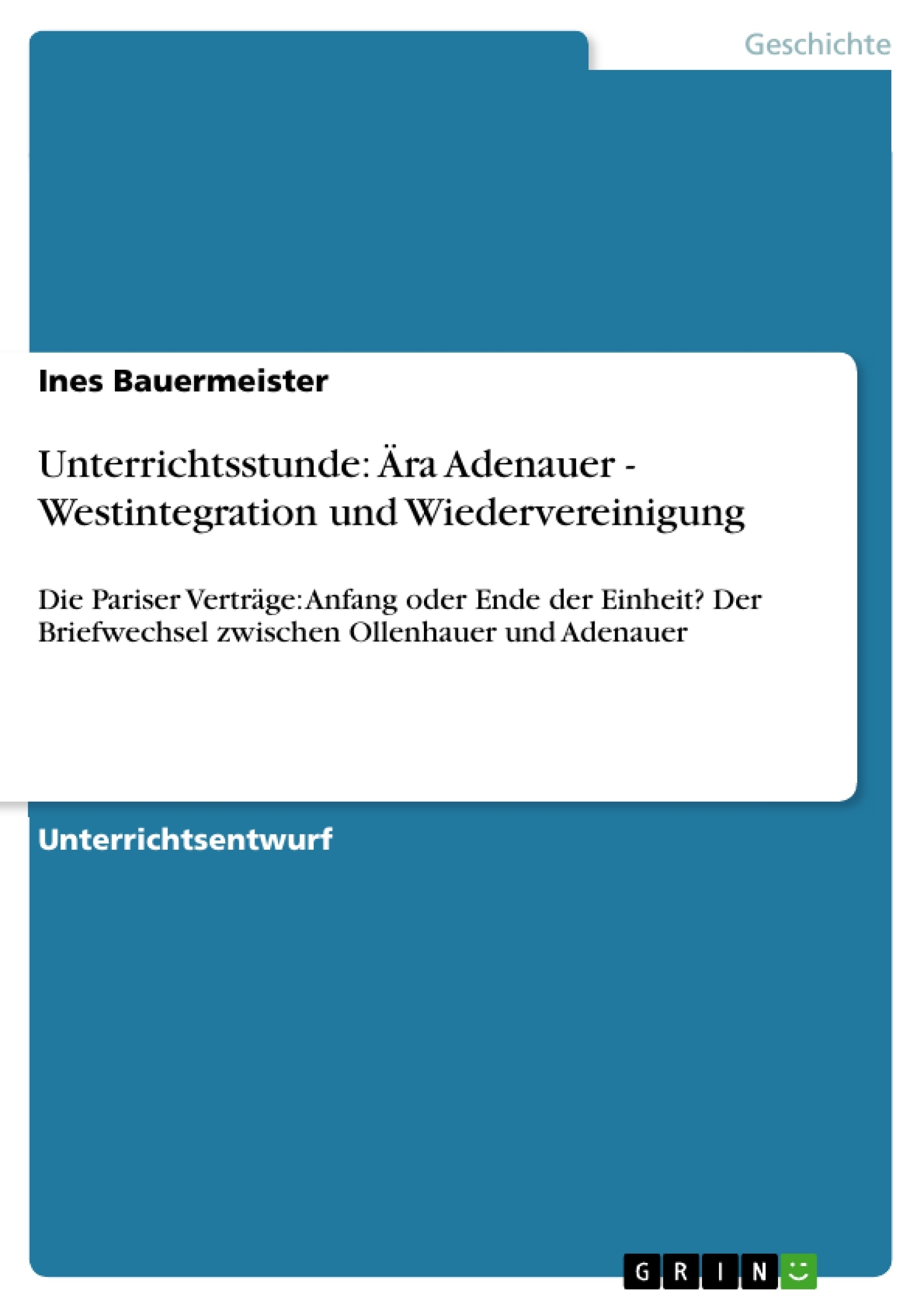Der Kurs mit dem Thema „Deutschland nach 1945“ ist darauf angelegt, den durch die Bedingungen des Kalten Krieges sowie das katastrophale Erbe der deutschen Geschichte begrenzten Spielraum für unabhängige Politik deutlich werden zu lassen. Die Wechselwirkung zwischen innenpolitischen Maßnahmen und außenpolitischen Rahmenbedingungen soll gleichsam als roter Faden sichtbar werden8. Um die Grundkenntnisse für das Verständnis des politischen Geschehens nach 1945 zu schaffen und die Kursmitglieder auf einen einheitlichen Wissensstand zu bringen9, wurde zu Beginn des Kurses der Verlauf der europäischen Geschichte von 1870- 1945 wiederholt. Dabei wurde das in dieser Zeit entstandene Bild Deutschlands im Ausland im Interesse des oben genannten Kontinuums besonders akzentuiert.10 Den ersten Schwerpunkt bildete die Besatzungspolitik der Alliierten ausgehend von der Potsdamer Konferenz und ihren Folgen. Daran anschließend wurde auf Anregung der Schüler11 ein als Längsschnitt durchgeführter Exkurs zur Rolle der USA in der Welt eingeschoben, in dessen Verlauf intensiv an Quellen gearbeitet wurde12. Von diesem gelang durch die Truman-Doktrin die Rückkehr zum Kursthema, indem nun die sich sukzessiv verschärfende ideologische Auseinandersetzung zwischen Ost und West mit ihren Konsequenzen für Deutschland bis zur Konstituierung der beiden deutschen Staaten behandelt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Bild der Lerngruppe
- Lernvoraussetzungen
- Inhaltlich
- Methodisch
- Einordnung in den Unterrichtszusammenhang
- Didaktisch- methodische Vorüberlegungen
- Sachanalyse
- Hausaufgabe zu der Stunde
- Geplanter Verlauf
- Aufgabe zur Folgestunde
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtseinheit zielt darauf ab, die Schüler mit den Pariser Verträgen und deren Bedeutung für die deutsche Geschichte nach 1945 vertraut zu machen. Der Fokus liegt auf der Analyse des Briefwechsels zwischen Erich Ollenhauer und Konrad Adenauer, um die unterschiedlichen Positionen zur Westintegration und Wiedervereinigung zu beleuchten.
- Die Pariser Verträge als Meilenstein der Westintegration
- Die Rolle der NATO-Mitgliedschaft für die BRD
- Die Kontroversen um die Wiedervereinigung
- Die unterschiedlichen Positionen von Adenauer und Ollenhauer
- Die Bedeutung des Briefwechsels für die deutsche Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Beschreibung der Lerngruppe und deren Lernvoraussetzungen. Die Schüler verfügen über unterschiedliche Vorkenntnisse und zeigen ein uneinheitliches Leistungsniveau. Im Bereich der historischen Grundkenntnisse und der Arbeit mit Textquellen bestehen Defizite, während sie bei der Arbeit mit bildlichen Quellen engagiert und methodisch korrekt vorgehen. Die Arbeitsatmosphäre ist überwiegend angenehm, die Schüler zeigen Interesse am Thema und sind bereitwillig zur Mitarbeit.
Im zweiten Kapitel werden die inhaltlichen und methodischen Lernvoraussetzungen für die Unterrichtseinheit zur Adenauer-Ära dargestellt. Die Schüler haben bereits die europäische Geschichte von 1870 bis 1945 wiederholt und sich mit der Besatzungspolitik der Alliierten sowie der Rolle der USA in der Welt auseinandergesetzt. Methodisch sind sie mit den Grundprinzipien der Quellenanalyse vertraut, benötigen aber weiterhin Unterstützung bei der Anwendung von Analysemethoden.
Das dritte Kapitel ordnet die Unterrichtseinheit in den Gesamtkontext des Geschichtsunterrichts ein. Die Schüler kennen verschiedene Positionen zur deutschen Frage und haben sich mit dem Alleinvertretungsanspruch der BRD beschäftigt. Die Pariser Verträge werden als Ersatzlösung für die gescheiterten EVG-Verhandlungen vorgestellt.
Im vierten Kapitel werden die Pariser Verträge als Sachanalyse dargestellt. Die Verträge garantierten der BRD fast die volle Souveränität und banden sie durch den NATO-Beitritt fest in das westliche Militärbündnis ein. Konrad Adenauer verfolgte mit seiner klaren Integrationspolitik das Ziel, der BRD aus der Position eines sicheren Westbündnisses heraus wirtschaftliche Konsolidierung, Sicherheit vor außenpolitischer Bedrohung und die Wiedervereinigung zu ermöglichen. Die Ausführungen Ollenhauers entsprechen der militärischen Integration der BRD ins Auge gefasst und Adenauer zu verstehen gegeben, dass sie von ihm aktive Schritte zu einer Westeinbindung erwarteten, sodass eine Existenz außerhalb der westeuropäischen Integration für die BRD ausgeschlossen war. Da Adenauer in einem Militärbündnis unter Führung der USA die einzig wirksame Verteidigung gegen die Bedrohung durch die UdSSR sah, bestand hier Interessenkongruenz(s. Herbst S. 35-59; Kleßmann, S. 208; K. Sontheimer, Die Adenauer-Ära. Grundlegung der Bundesrepublik, München² 1996, 159-170). Mit Ausnahme der Kommunisten bestand Konsens darüber, dass Deutschland sich gesellschafts- und kulturpolitisch sowie wirtschaftlich nach Westen orientieren, auf eine Versöhnung mit Frankreich und die Einigung Europas hinwirken müsse( s. Herbst, S. 105-111). 20 Adenauer beschränkte sich im Bereich der aktiven Deutschlandpolitik auf taktisches Hinhalten. Dabei waren der leicht mobilisierbare Antikommunismus sowie die politisch und materiellen Vorteile der Westintegration zwei ausschlaggebende Komponenten seines Erfolges. Den Wahlerfolg von 1953 konnte er dabei als Plebiszit für sein politisches Konzept werten(s. Herbst, S.125; Kleßmann, S. 234).
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Pariser Verträge, die Westintegration, die Wiedervereinigung, die NATO-Mitgliedschaft, die Adenauer-Ära, Erich Ollenhauer, Konrad Adenauer und die deutsche Frage. Der Text beleuchtet die unterschiedlichen Positionen zur deutschen Frage und die Kontroversen um die Westintegration und Wiedervereinigung im Kontext der Pariser Verträge.
- Quote paper
- Ines Bauermeister (Author), 2003, Unterrichtsstunde: Ära Adenauer - Westintegration und Wiedervereinigung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130791