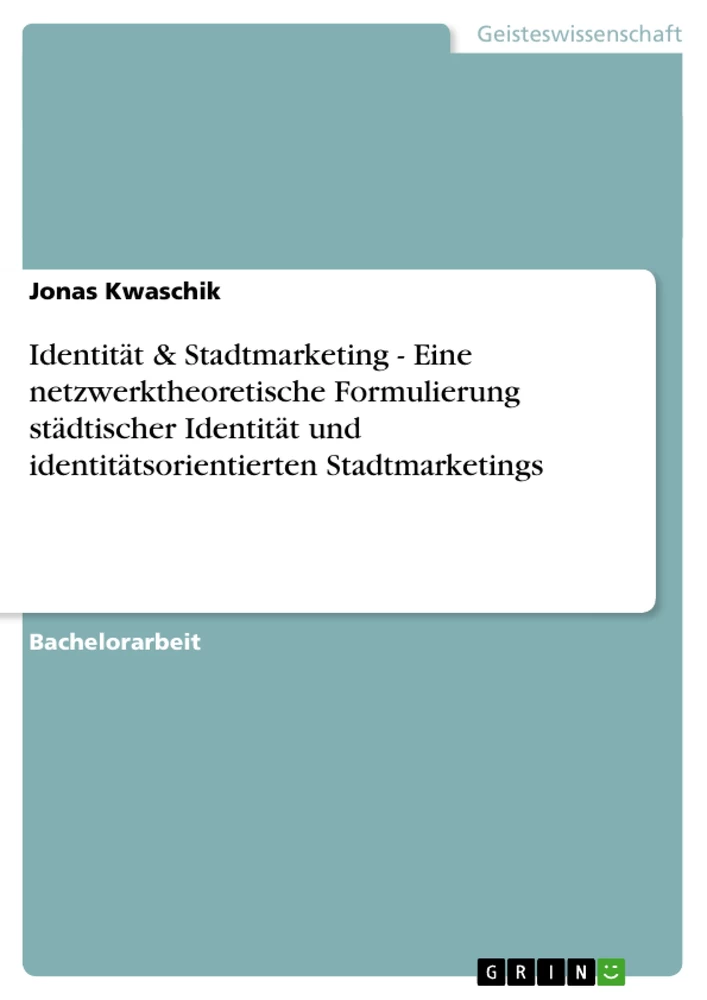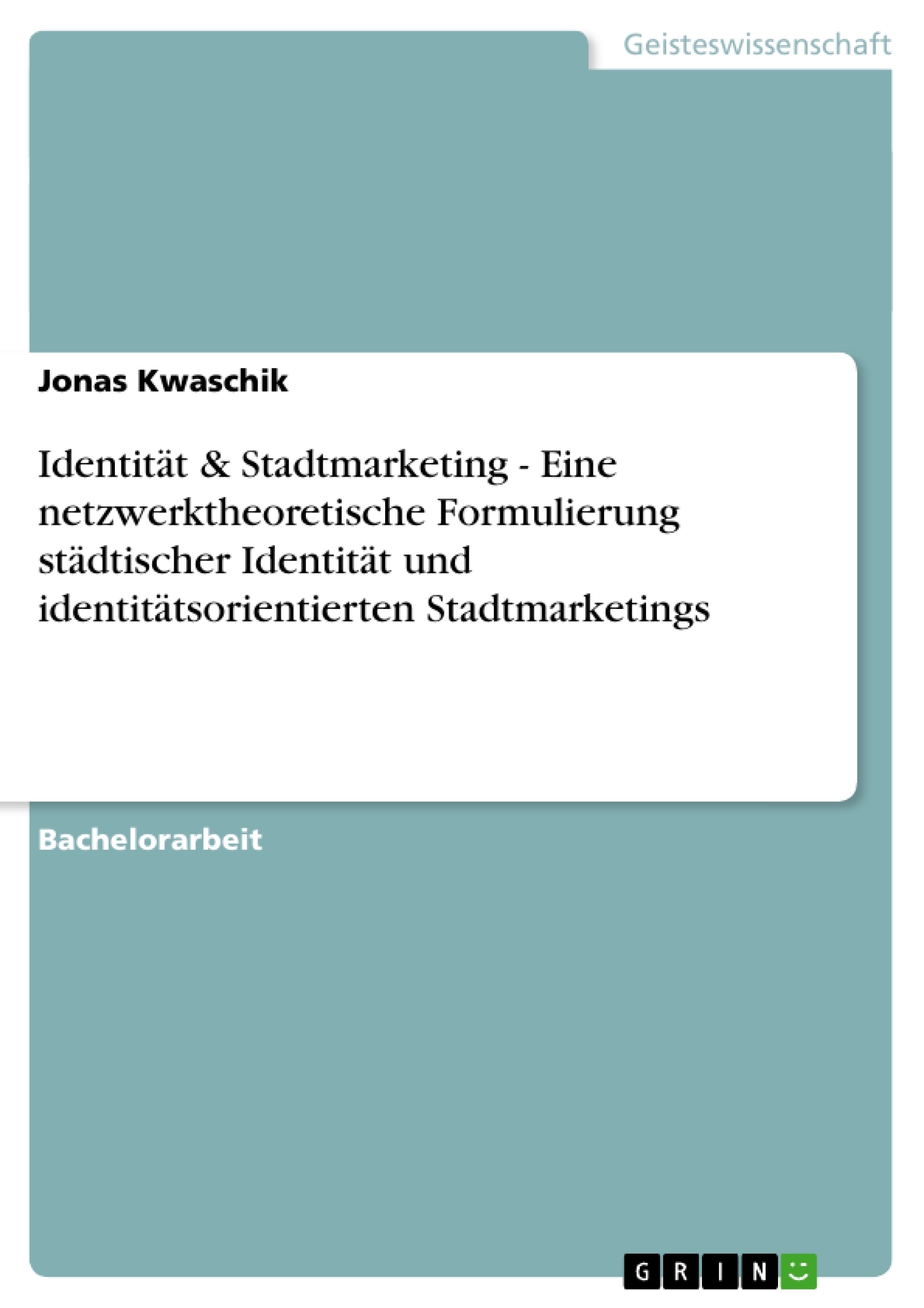Diese theoretische Arbeit untersucht die Konzeption von Stadtidentität im Kontext des Stadtmarketings, das sich in einem zunehmenden Standortwettbewerb um die Entwicklung wettbewerbsfähiger Stadtmarken als Synonym städtischer Identität bemüht. Wie die interdisziplinäre Untersuchung von Literatur zum Verständnis von Stadt und der Konstituierung von Identität zeigt, handelt es sich hierbei aber um keine essentialistischen Eigenschaften einer vermeintlichen Einheit sondern um narrative und plurale Prozesse einer relationalen Lokalität, die sich einer Gestaltbarkeit und Reduktion entziehen. Eine Rekonstruktion des Phänomens Identität mit Hilfe der Netzwerktheorie nach Harrison C. White macht es aber möglich, genauere Einblicke in die Operationalisierung der Konstitutionsprozesse von Identitäten zu erhalten. In Folge dessen wird durch eine netzwerktheoretische Formulierung von Stadtidentität ein neues Selbstverständnis des Stadtmarketings als Kommunikationsermöglicher entwickelt und an dem zuvor ausgeführten Praxisfall Graz-Reininghaus skizziert.
Abstract:
The theoretical paper analyses the conception of city identity in the context of the marketing of cities, which has been challenged in an increasing competition to develop place branding as competitive identities. As the interdisciplinary scrutiny of academic literature suggests, the conception of the city and the constitution of identity is however not an essentialistic quality of an assumed unity, but narrative and multiple processes in relational localities, which cannot be designed or reduced to a city’s single identity. The reconstruction of the phenomena of identity with the network theory according to Harrison C. White, gives then more insight into the operationalisation in the processes of constituting identities. As a result, a network theoretical conception of a city’s identity is developed. This leads to the new role of the city’s marketing as communication enabler, which is outlined in a current case of a city-making project in Graz-Reininghaus, Austria.
Inhaltsverzeichnis
- Problemaufriss
- Creative Class, Place Branding & Competitive identities
- Die Verbindung von Identität und Steuerung mit dem Stadtmarketing
- Forschungsfrage
- Einordnung in Forschung und Praxis
- Eingrenzung des Untersuchungsgebiets
- Aufbau der Untersuchung
- Literatur & Diskurs
- Stadt als Gegenstand
- Schwierigkeit mit der Begrifflichkeit von Stadt
- Klischees von Städten - der Blick von außen
- Die Stadt als Prozess
- Stadt ist kein Territorium
- Lokalisieren von Orten und Bedeutung des Lokalen
- Die Stadt als Akteur?
- Experteninterview: Bastian Lange zum Thema Stadtbegriffe & multipli:cities
- Identität in Stadt und Stadtmarketing
- Place Branding & Competitive Identities
- Identitätsorientiertes Stadtmarketing
- Empirische Erkenntnisse aus den Leitbildprozessen im Projekt,,Stadt 2030"
- Kontextsensibilität von Identitätsdiskursen
- Narrative Identitäten
- Experteninterview: Ares Kalandides zum Thema Identität & Stadtmarketing
- Netzwerktheorie: Identity & Control nach Harrison White
- Identität als Verortung bei Kontingenzen
- Kontext
- Switiching zwischen Netdoms
- Die 4 Ordnungen von Identitäten
- Networks und Stories
- Localities
- Anwendung der Netzwerktheorie auf die Vorstellung von Stadtidentität
- Phänomen: Was ist Identität?
- Akteure: Wem oder was kann Identität zugeschrieben werden?
- Kontext: Was ist "die Stadt"?
- Thesen zur Stadtidentität
- Fallbeispiel: Graz-Reininghaus
- Profil und Besonderheiten
- Prozess
- Experteninterview: Michael Sammer zum Thema Partizipation & Entwicklungsprozess in Reininghaus
- Experteninterview: Roland Koppensteiner zum Thema Strategie & Marketing in Reininghaus
- Das Problem der Identität in Reininghaus
- Neuformulierung von einem identitätsorientierten Stadtmarketing
- Selbstverständnis
- Dimensionen neuer Handlungsfelder
- Networking
- Switching
- Story-telling
- Tracing
- Anwendung auf Graz Reininghaus
- Ausblick
- Schlussbetrachtung und Resultate
- Zusammenfassung
- Fazit zur Forschungsfrage
- Kritische Würdigung und neue Fragen
- Schlusswort zur Anbindung an die Praxis
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Abbildungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Konzeption von Stadtidentität im Kontext des Stadtmarketings. Sie analysiert, wie Städte im zunehmenden Standortwettbewerb um die Entwicklung wettbewerbsfähiger Stadtmarken als Synonym für städtische Identität bemüht sind. Die Arbeit zeigt, dass Stadtidentität keine essentialistische Eigenschaft einer vermeintlichen Einheit ist, sondern ein narrativer und pluraler Prozess einer relationalen Lokalität, der sich einer Gestaltbarkeit und Reduktion entzieht. Die Arbeit rekonstruiert das Phänomen Identität mit Hilfe der Netzwerktheorie nach Harrison C. White, um genauere Einblicke in die Operationalisierung der Konstitutionsprozesse von Identitäten zu erhalten. Durch eine netzwerktheoretische Formulierung von Stadtidentität entwickelt die Arbeit ein neues Selbstverständnis des Stadtmarketings als Kommunikationsermöglicher und skizziert dies am Praxisfall Graz-Reininghaus.
- Die Bedeutung von Stadtidentität im Kontext des Stadtmarketings
- Die Herausforderungen der Gestaltung von Stadtidentität im Wettbewerb
- Die Anwendung der Netzwerktheorie zur Analyse von Stadtidentität
- Die Rolle des Stadtmarketings als Kommunikationsermöglicher
- Die praktische Anwendung der Theorie am Beispiel von Graz-Reininghaus
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit stellt den Problemaufriss dar. Es beleuchtet den zunehmenden Standortwettbewerb zwischen Städten und die Bedeutung von Place Branding und Competitive Identities. Die Arbeit stellt die Forschungsfrage nach der Konzeption von Stadtidentität im Kontext des Stadtmarketings und ordnet sie in Forschung und Praxis ein. Das Kapitel grenzt das Untersuchungsgebiet ein und skizziert den Aufbau der Untersuchung.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Literatur und dem Diskurs zum Thema Stadt und Identität. Es analysiert die Schwierigkeit der Begrifflichkeit von Stadt, die Klischees von Städten, die Stadt als Prozess und die Stadt als Akteur. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Lokalen und führt Experteninterviews mit Bastian Lange zum Thema Stadtbegriffe und mit Ares Kalandides zum Thema Identität und Stadtmarketing.
Das dritte Kapitel stellt die Netzwerktheorie nach Harrison White vor. Es analysiert die Konzeption von Identität als Verortung bei Kontingenzen, die Bedeutung des Kontextes und das Switching zwischen Netdoms. Das Kapitel beschreibt die vier Ordnungen von Identitäten, die Rolle von Networks und Stories sowie die Bedeutung von Localities.
Das vierte Kapitel wendet die Netzwerktheorie auf die Vorstellung von Stadtidentität an. Es analysiert das Phänomen Identität, die Akteure, denen Identität zugeschrieben werden kann, und den Kontext "die Stadt". Das Kapitel formuliert Thesen zur Stadtidentität.
Das fünfte Kapitel präsentiert das Fallbeispiel Graz-Reininghaus. Es beschreibt das Profil und die Besonderheiten des Projekts, den Prozess der Entwicklung und die Expertenmeinungen von Michael Sammer und Roland Koppensteiner. Das Kapitel analysiert das Problem der Identität in Reininghaus.
Das sechste Kapitel formuliert eine Neuformulierung von einem identitätsorientierten Stadtmarketing. Es beschreibt das Selbstverständnis des Stadtmarketings als Kommunikationsermöglicher und die Dimensionen neuer Handlungsfelder wie Networking, Switching, Story-telling und Tracing. Das Kapitel wendet diese Konzepte auf Graz-Reininghaus an und gibt einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Stadtidentität, Stadtmarketing, Place Branding, Competitive Identities, Netzwerktheorie, Harrison White, Graz-Reininghaus, Kommunikationsermöglicher, Standortwettbewerb, Global Cities, Creative Class, Identität, Lokalität, Prozess, Narrative, Pluralität, Kontext, Akteure, Thesen, Experteninterviews.
- Quote paper
- Jonas Kwaschik (Author), 2008, Identität & Stadtmarketing - Eine netzwerktheoretische Formulierung städtischer Identität und identitätsorientierten Stadtmarketings, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130779