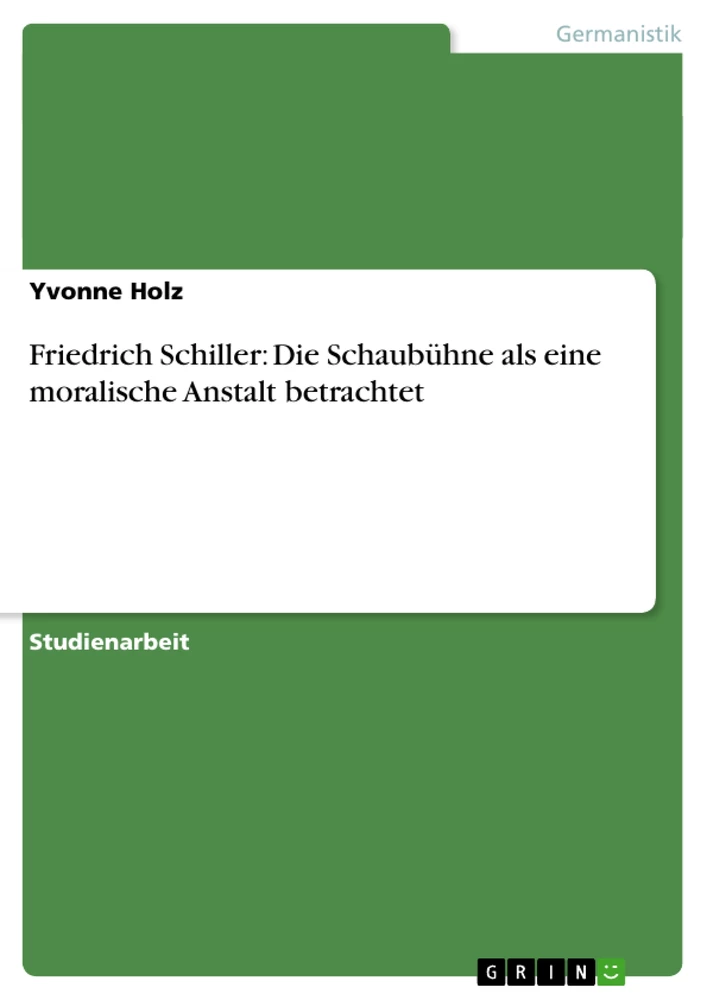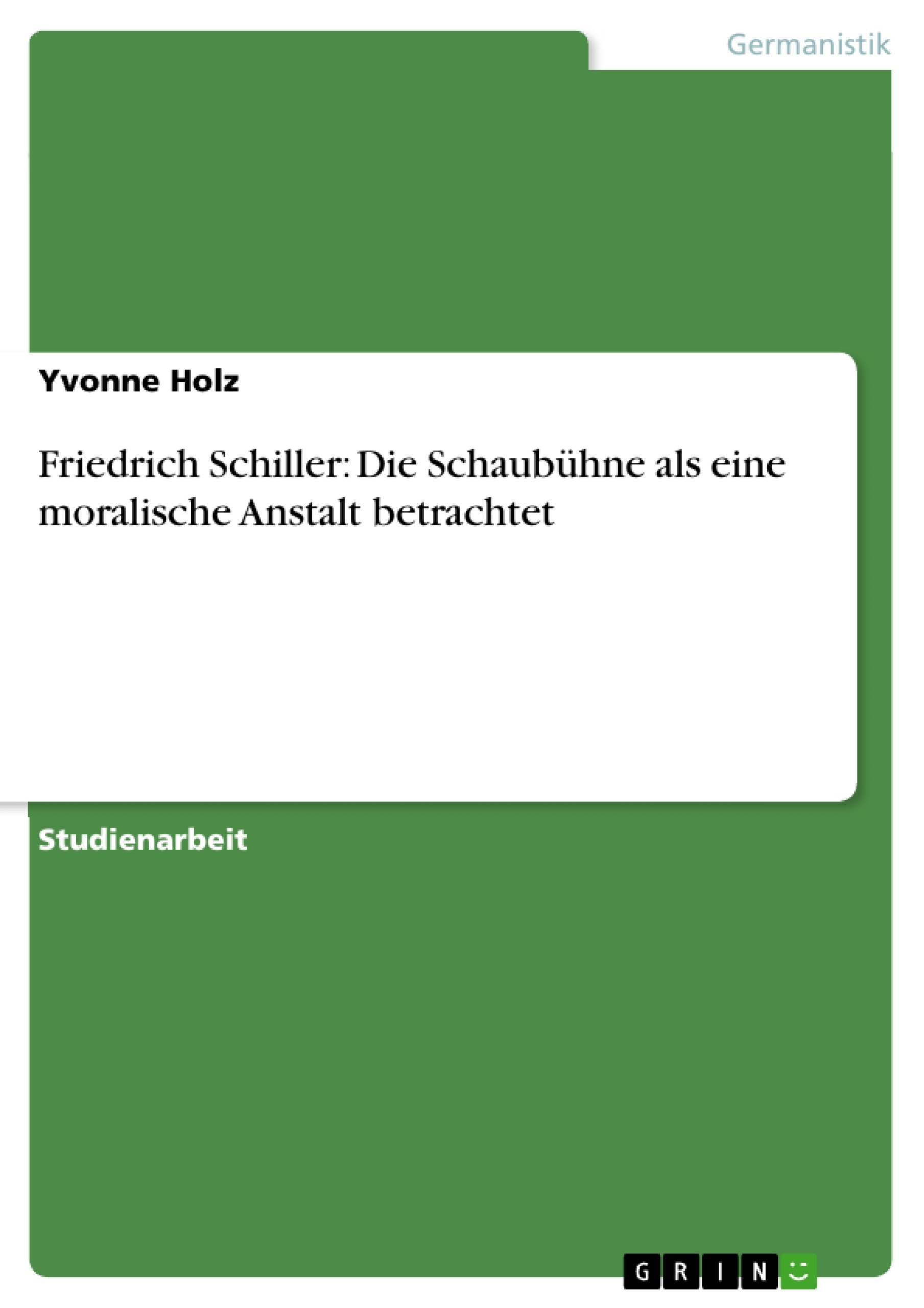Im Juni 1784 hält Friedrich Schiller seine Antrittsrede vor der „Kurfürstlichen Deutschen Gesellschaft“ zum Thema Vom Wirken der Schaubühne auf das Volk. Der Text der Rede wird 1785 in der ersten Ausgabe seiner Zeitschrift Rheinische Thalia unter dem Titel Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken? veröffentlicht. Im Jahr 1802 wird sie in der, um die Einleitung gekürzten, Fassung und mit dem revidierten Titel: Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet in die Kleineren prosaischen Schriften übernommen.
Diese letztgenannte Fassung der Rede ist Thema und Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Werk Schillers unter besonderer Berücksichtigung der Frage nach der funktionalen und wirkungsdimensionalen Bedeutung der Schaubühne für den Theaterdichter und Schriftsteller Friedrich Schiller.
Dazu erfolgt zunächst eine kurze zeitlich-biographische Einordnung des Stückes. Die anschließende Analyse und Interpretation legt in einem ersten Schritt die inhaltliche theater-theoretische Programmatik der Rede Schillers dar. Hierbei werden inhaltliche Schwerpunkte des Vortrages eruiert und bewertet.
Im Rahmen der weiteren Untersuchung wird, als exemplarischer Beleg für Schillers Theaterauffassung, seine Erzählung Der Verbrecher aus verlorener Ehre betrachtet. Hierbei liegt das Augenmerk auf einer kurzen Darstellung der Gattungsdifferenz zwischen Drama und Erzählung, der Gestaltung des Erzählverfahren sowie der Hauptfigur des Christian Wolf. Alle analytischen Betrachtungen werden mit konkreten werkimmanenten Textbeispielen belegt und veranschaulicht.
Ziel der Analyse ist es, Anhaltspunkte und Bedeutungsperspektiven im Kontext der zentralen Aufgabenstellung darzulegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hinführung zum Werk
- Analyse / Interpretation
- Die Schaubühne als moralische Anstalt - Schiller und das Theater
- Der Verbrecher aus verlorener Ehre - ein exemplarischer Beleg
- Gattungsdifferenz
- Erzählverfahren
- Das Gesicht des Täters
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Friedrich Schillers Rede „Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet“, insbesondere die funktionale und wirkungsdimensionale Bedeutung des Theaters für Schiller. Die Analyse umfasst die theatertheoretische Programmatik der Rede und betrachtet Schillers Erzählung „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ als exemplarischen Beleg.
- Schillers Theaterauffassung und deren moralische Dimension
- Die Rolle des Theaters als Erziehungs- und Bildungsinstitution
- Die politische und gesellschaftliche Funktion des Theaters
- Vergleich zwischen Drama und Erzählung bei Schiller
- Analyse der Figur Christian Wolf in "Der Verbrecher aus verlorener Ehre"
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Gegenstand der Arbeit: Schillers Rede „Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet“ in der Fassung von 1802. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der eine Analyse der theatertheoretischen Programmatik der Rede und eine exemplarische Betrachtung von Schillers Erzählung „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ umfasst, um die Bedeutung der Schaubühne für Schiller zu beleuchten.
Hinführung zum Werk: Dieses Kapitel bietet eine kurze biographische Einordnung Schillers im Kontext der Entstehung seiner Rede. Es beschreibt seine Flucht aus Stuttgart, seine Anstellung als Theaterdichter in Mannheim, seine Aufnahme in die „Kurfürstliche Deutsche Gesellschaft“ und die zeitgleich stattfindenden Uraufführungen seiner Dramen „Fiesco“ und „Kabale und Liebe“. Der Kontext verdeutlicht die schwierige Lebenssituation Schillers während dieser Zeit und die Bedeutung der Schaubühne in diesem Kontext.
Analyse / Interpretation: Dieser Abschnitt analysiert Schillers Rede und untersucht die drei zentralen Funktionen des Theaters, die Schiller beschreibt: die moralische, die politische und die ästhetische. Die moralische Funktion beinhaltet die Erziehung und Bildung des Publikums, die politische Funktion betont die stabilisierende Rolle des Theaters für den Staat, und die ästhetische Funktion fokussiert auf die Unterhaltung und den Genuss. Die Analyse von „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ dient als exemplarischer Beleg für Schillers Theaterauffassung. Sie vergleicht die Gattungen Drama und Erzählung, untersucht das Erzählverfahren und analysiert die Hauptfigur Christian Wolf in Bezug auf Schillers Theorie.
Schlüsselwörter
Friedrich Schiller, Schaubühne, Theater, Moral, Bildung, Politik, Erziehung, „Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet“, „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“, Drama, Erzählung, Gattungsvergleich, Aufklärung.
Häufig gestellte Fragen zu Schillers Schaubühne und "Der Verbrecher aus verlorener Ehre"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Friedrich Schillers Rede „Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet“ (Fassung von 1802) und untersucht deren theatertheoretische Programmatik. Als exemplarischen Beleg dient Schillers Erzählung „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“, um die Bedeutung der Schaubühne für Schiller zu beleuchten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Schillers Theaterauffassung und deren moralische, politische und ästhetische Dimension. Es werden die Rolle des Theaters als Erziehungs- und Bildungsinstitution, der Vergleich zwischen Drama und Erzählung bei Schiller sowie eine Analyse der Figur Christian Wolf in "Der Verbrecher aus verlorener Ehre" untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, eine Hinführung zum Werk (biographischer Kontext), eine Analyse/Interpretation (von Schillers Rede und der Erzählung) und eine abschließende Betrachtung. Die Analyse/Interpretation umfasst die Untersuchung der drei zentralen Funktionen des Theaters bei Schiller (moralisch, politisch, ästhetisch) und einen Vergleich der Gattungen Drama und Erzählung am Beispiel von "Der Verbrecher aus verlorener Ehre".
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine analytische und interpretative Methode. Sie analysiert den Text von Schillers Rede und interpretiert ihn im Kontext seiner Biografie und seines weiteren Werkes. Die Erzählung „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ dient als Fallbeispiel zur Illustration von Schillers theatertheoretischen Ansätzen.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist, dass Schillers Rede „Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet“ und seine Erzählung „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ wichtige Einblicke in seine umfassende Theaterauffassung liefern, die Moral, Bildung, Politik und Ästhetik eng miteinander verbindet. Das Theater wird dabei als eine Institution mit erzieherischer, politischer und ästhetischer Funktion dargestellt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Friedrich Schiller, Schaubühne, Theater, Moral, Bildung, Politik, Erziehung, „Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet“, „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“, Drama, Erzählung, Gattungsvergleich, Aufklärung.
Wie wird die Figur Christian Wolf in der Arbeit analysiert?
Die Analyse der Figur Christian Wolf in "Der Verbrecher aus verlorener Ehre" dient dazu, Schillers Theaterauffassung anhand eines konkreten Beispiels zu illustrieren. Dabei werden Aspekte wie das Erzählverfahren und die Gattungsunterschiede zwischen Drama und Erzählung betrachtet, um Schillers Theorie zu belegen.
Welchen biographischen Kontext beleuchtet die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet den biographischen Kontext Schillers während der Entstehung seiner Rede, insbesondere seine Flucht aus Stuttgart, seine Tätigkeit als Theaterdichter in Mannheim und seine Aufnahme in die „Kurfürstliche Deutsche Gesellschaft“, um die Bedeutung der Schaubühne in seinem Leben zu verdeutlichen.
- Quote paper
- Magister Artium Yvonne Holz (Author), 2005, Friedrich Schiller: Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130773