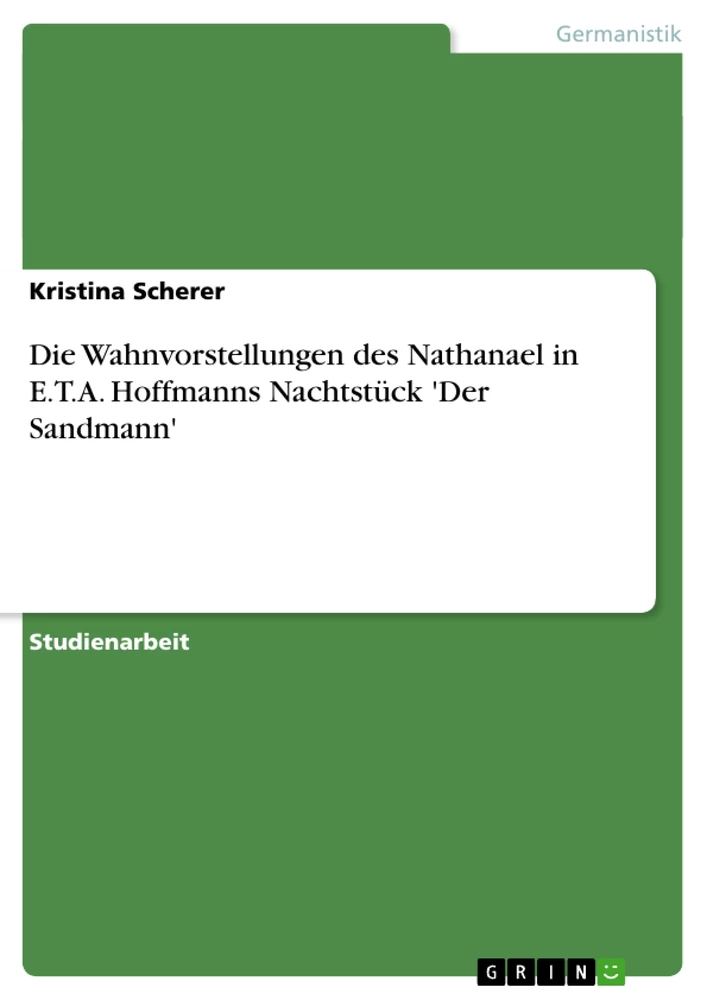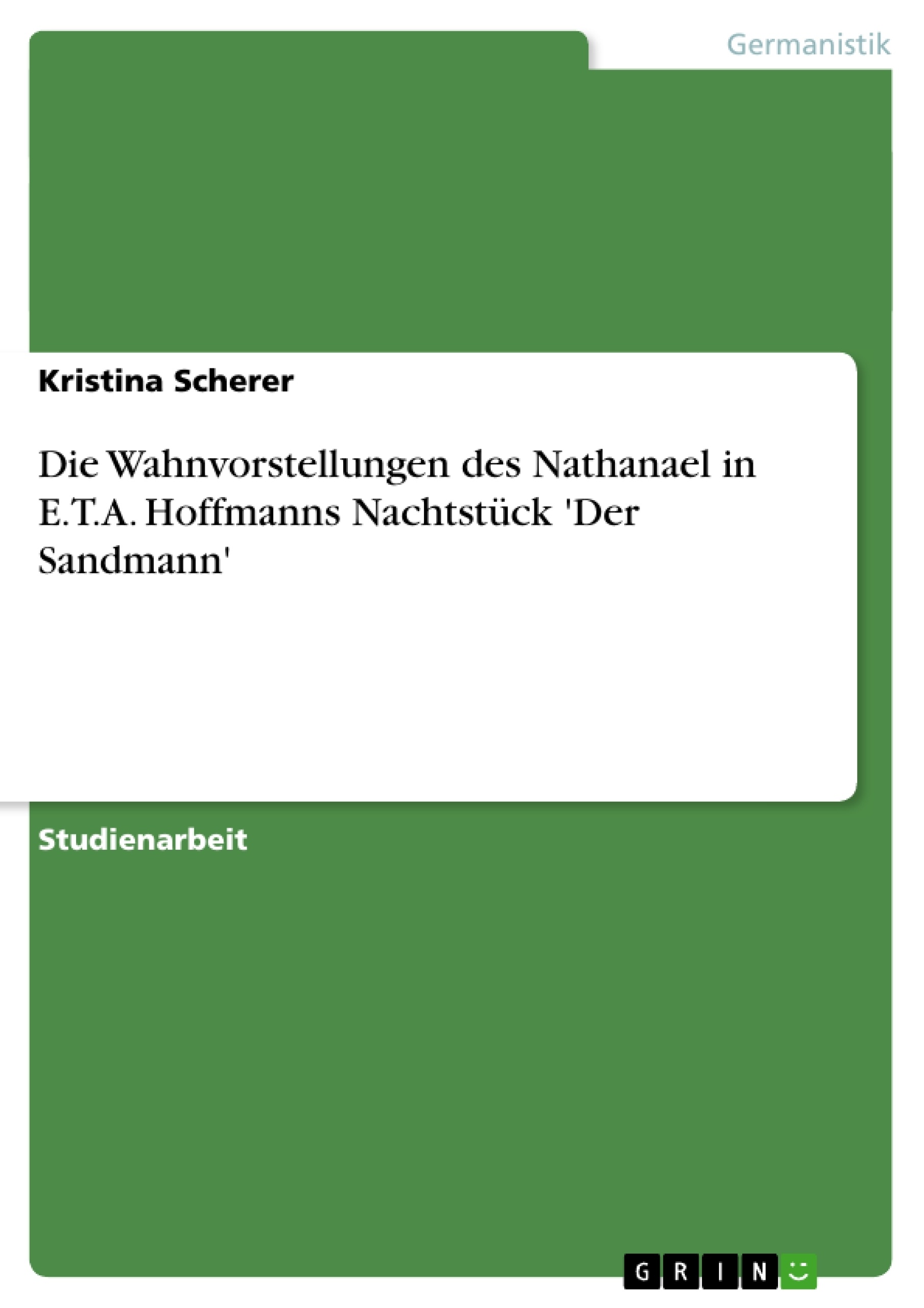Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Wahnvorstellungen des Nathanael in E.T.A. Hoffmanns Erzählung zu untersuchen. In den Themenkomplexen 2-4 werden zunächst die Textpassagen erläutert, in denen der Protagonist halluziniert: die Alchemie-Szene, die Sequenz der Verfassung der Dichtung, die Handels-, die Olimpia- sowie die Laborepisode und die Turmszene. Die Kapitel sind unterteilt in die Geschehnisse seiner Kindheit, der Studentenzeit und in die Phase der Ausbrüche des Wahnsinns. Im Verlauf der Erzählung werden Nathanaels Wahnzustände immer dramatischer. Die Halluzinationen führen zu einem Verlust von Identität und enden schließlich mit dem Tod.
Liest man den Sandmann, der komplex ist „wie wenige Erzählungen der deutschsprachigen Literatur des 19. Jahrhunderts“ und dessen „Gewebe noch nie zufriedenstellend entwirrt“ worden ist, so sieht man sich mit verschiedenen Motiven konfrontiert wie etwa dem des Automaten oder dem des Feuers. Am auffälligsten verwendet Hoffmann jedoch Motive aus dem optischen Sinnbereich – etwa Augen oder Brillen – und zwar so häufig, dass die gesamte Erzählung „optisch codiert“ erscheint. Das Leitmotiv der Augen, welches spätestens seit den Arbeiten der Literaturwissenschaftler Peter von Matt und Yvonne Holbeche nachgewiesen ist, tritt jedoch nicht zufällig auf. Es scheint den Wahnvorstellungen des Protagonisten vorauszugehen. Deshalb soll gezeigt werden, dass jenes Motiv der Augen mit dem des Wahnsinns verknüpft ist.
Der fünfte Themenkomplex widmet sich Deutungen für den Irsinn Nathanaels. Wahrlich können nicht alle Interpretationsansätze behandelt werden. Dazu existieren einfach zu viele, zumal sich an der Exegese des Sandmanns schon seit seiner Entstehung nicht lediglich Literaturwissenschaftler versuchen, sondern ebenso Forscher anderer Disziplinen, etwa der Psychologie oder der Philosophie. Neben dem zeitgenössischen Kontext und der Annahme, der Sandmann sei eine reale teuflische Macht, die das Leben des Protagonisten bedroht, werden Erklärungsversuche der zeitgenössischen Psychiatrie sowie der Psychoanalyse – sprich: das Affekt-Trauma-Schema und das Freudsche Prinzip der Verschiebung – vorgestellt, die den Schwerpunkt bilden sollen. Gerade in den letzten Jahrzehnten haben diese Modelle an Bedeutung gewonnen.
Die Erläuterungen stützen sich hauptsächlich auf Ulrich Hohoffs Standardwerk über den Sandmann, welches sich ausführlich mit der Thematik des Wahnsinns beschäftigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Nathanaels Kindheit
- Das Ammenmärchen vom Sandmann
- Die erste Begegnung mit dem, Sandmann': Die Alchemie-Szene
- Nathanaels Studentenzeit
- Eine düstere Vision: Nathanaels Dichtung für Clara
- Nathanaels zweite Begegnung mit dem Wetterglashändler Giuseppe Coppola
- Nathanaels Wahnvorstellungen beim Anblick der Brillen und Kauf eines Perspektivs
- Verzerrte Wahrnehmung durch das Perspektiv: Die Liebe zur leblosen Puppe Olimpia
- Nathanaels Weg in sein Ende
- ,,Da packte ihn der Wahnsinn mit glühenden Krallen“: Ausbruch des Wahnsinns nach Olimpias Verlust
- Die Turmszene: Nathanael stürzt in den Tod
- Erklärungsversuche für die Wahnvorstellungen Nathanaels
- Der zeitgenössische Kontext
- Romantisches Selbstverständnis
- Psychiatrische Diskussion
- Erklärungsversuche der Psychoanalyse
- Das Affekt-Trauma-Modell
- Das Freudsche Prinzip der Verschiebung: Coppelius/Coppola repräsentieren den bösen Teil des Vaters
- Der Sandmann – eine teuflische Macht
- Der zeitgenössische Kontext
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse der Wahnvorstellungen des Protagonisten Nathanael in E.T.A. Hoffmanns Erzählung "Der Sandmann". Ziel ist es, die Entstehung und Entwicklung seiner Halluzinationen im Kontext der Handlung zu untersuchen und verschiedene Deutungsmöglichkeiten für seinen Irsinn zu beleuchten.
- Die Rolle des Ammenmärchens vom Sandmann in der Entstehung von Nathanaels Ängsten und Wahnvorstellungen
- Die Bedeutung von optischen Motiven, insbesondere Augen und Brillen, für die Darstellung von Nathanaels Wahrnehmung und seinen zunehmenden Wahnsinn
- Die Analyse der verschiedenen Episoden, in denen Nathanael halluziniert, wie die Alchemie-Szene, die Olimpia-Episode und die Turmszene
- Die Erörterung verschiedener Erklärungsansätze für Nathanaels Irsinn, darunter der zeitgenössische Kontext, psychoanalytische Interpretationen und die Annahme einer teuflischen Macht
- Die Untersuchung des Einflusses von Nathanaels Kindheitserfahrungen auf seine spätere psychische Entwicklung und seine Wahnvorstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Erzählung beginnt mit einem Brief Nathanaels an seinen Freund Lothar, in dem er von einer beunruhigenden Begegnung mit einem Wetterglashändler namens Giuseppe Coppola berichtet. Nathanael erklärt, dass diese Begegnung ihn an ein traumatisches Erlebnis aus seiner Kindheit erinnert, das mit der Figur des Sandmanns verbunden ist. In seiner Kindheit wurde Nathanael von seiner Mutter immer mit der Erklärung ins Bett gebracht, dass der Sandmann komme, um ihm Sand in die Augen zu streuen. Diese Figur des Sandmanns, die Nathanael mit dem Verlust seines Vaters assoziiert, wird im Laufe der Erzählung zu einem zentralen Motiv für seine Wahnvorstellungen.
Im weiteren Verlauf der Erzählung wird Nathanael als Student in der Universitätsstadt G. dargestellt. Er verliebt sich in Clara, die Schwester seines Freundes Lothar. Doch seine Liebe zu Clara wird von seinen zunehmenden Wahnvorstellungen überschattet. Nathanael begegnet erneut dem Wetterglashändler Coppola, den er mit dem Sandmann aus seiner Kindheit identifiziert. Coppola verkauft ihm eine Brille, die seine Wahrnehmung verzerrt und seine Wahnvorstellungen verstärkt. Durch die Brille sieht Nathanael die leblose Puppe Olimpia als lebendiges Wesen und verliebt sich in sie. Diese Liebe führt zu einem weiteren Ausbruch seines Wahnsinns, als er die Wahrheit über Olimpia entdeckt.
Die Erzählung endet mit Nathanaels Tod, der durch seine Wahnvorstellungen verursacht wird. Er stürzt von einem Turm, nachdem er von der Puppe Olimpia getrennt wurde. Die Erzählung lässt den Leser mit der Frage zurück, ob Nathanaels Wahnvorstellungen real sind oder ob sie nur in seiner Fantasie existieren.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Sandmann als Symbol für Angst und Verlust, die Wahnvorstellungen des Protagonisten Nathanael, die Rolle von optischen Motiven wie Augen und Brillen, die Bedeutung von Kindheitserfahrungen für die psychische Entwicklung, die Erklärungsansätze für Wahnsinn im zeitgenössischen Kontext und in der Psychoanalyse sowie die Verbindung von Romantik und Phantastik.
- Quote paper
- Kristina Scherer (Author), 2009, Die Wahnvorstellungen des Nathanael in E.T.A. Hoffmanns Nachtstück 'Der Sandmann', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130622