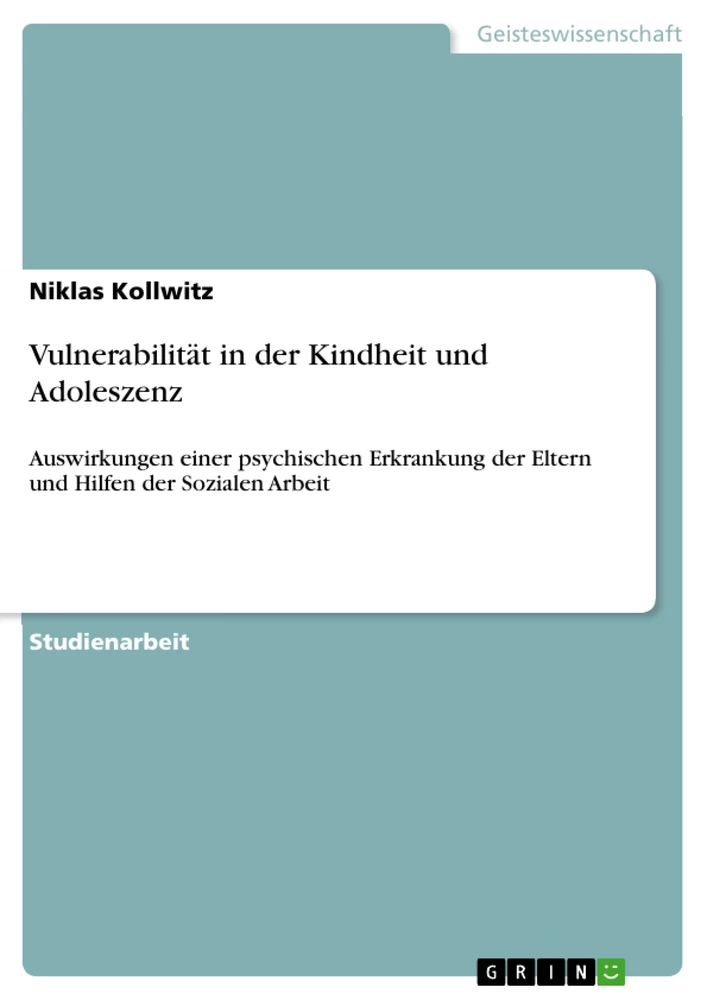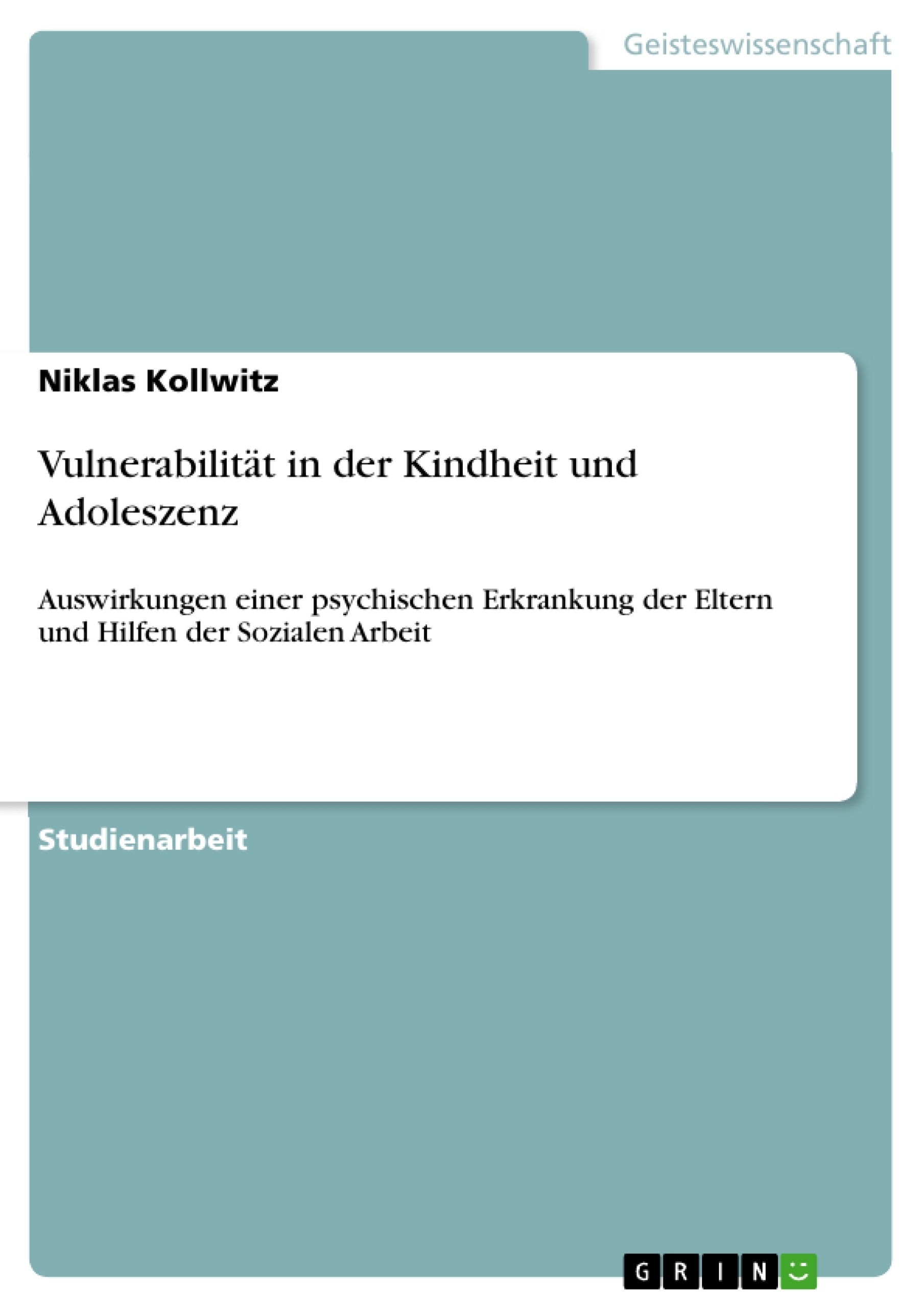In dieser Arbeit führe ich auf welche Auswirkungen eine psychische Erkrankung von Eltern auf die Kinder hat. Zudem stelle ich Möglichkeiten vor wie die Soziale Arbeit diese Auswirkungen auf die Kinder abfedern kann.
Alle Eltern wollen gute Eltern sein. Nur kann es trotzdem vorkommen, dass Eltern aufgrund ihrer psychischen Erkrankung ein Entwicklungsrisiko für die Kinder darstellen. Auch wenn dies in den allermeisten Fällen nicht beabsichtigt ist. Wenn ein oder mehrere Elternteile an einer psychischen Erkrankung leiden, heißt dies nicht zwangsläufig, dass diese “schlechte” Eltern sind oder eine Gefahr für das Kindeswohl darstellen. Diese Eltern können genau wie alle anderen Eltern auch ein oder mehrere Kinder liebevoll und wertschätzend großziehen oder auch negativ auf die Kinder und deren Entwicklung einwirken. Auch wenn ich mich in dieser Arbeit nur mit den Auswirkungen auf das Kind befasse, soll diese Arbeit nicht zu einer Stigmatisierung beitragen sondern diese eher abbauen und vor allem aufklären.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Einleitung
2. Einordnung betroffener Menschen und Kinder in Deutschland
3. Die Auswirkungen einer psychischen Erkrankung der Eltern, auf das Kind
3.1. Die Eltern-Kind-Beziehung
3.2. Die Auswirkungen auf die Vulnerabilität und Resilienz der Kinder
4. Präventions- und Interventionsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit
5. Zusammenfassung und Schlussfolgerung
6. Literaturverzeichnis
Vorwort
Ist eine Person mit einer oder mehreren Störungen aus dem DSM-5 oder dem ICD-11, von einem anerkannten Arzt oder Psychiater, diagnostiziert worden, so gilt sie in dieser Wissenschaftlichen Arbeit als psychisch erkrankte Person.
Für diese Wissenschaftliche Arbeit habe ich eine vielzahl an Publikationen benutzt. Insbesondere zwei Publikationen zitiere ich häufig. Einmal eine IST-Analyse von dem Autorenteam Wiegand-Grefe Et al., welches ausführlich die derzeitige Versorgungssituation, Problematiken, Hilfsmöglichkeiten und Chancen von Kindern psychisch erkrankter Eltern aufzeigt. Zum anderen Zitiere ich auch häufig aus der Publikation “Kinder von Eltern mit psychischen Erkrankungen” von dem Autorenteam Christiansen Et al., dies ist eine Zusammenfassung der derzeitigen Fachdiskussion rund um das Thema um welches es auch in dieser Arbeit geht.
Alle Eltern wollen gute Eltern sein. Nur kann es trotzdem vorkommen, dass Eltern aufgrund ihrer psychischen Erkrankung ein Entwicklungsrisiko für die Kinder darstellen. Auch wenn dies in den allermeisten Fällen nicht beabsichtigt ist. Wenn ein oder mehrere Elternteile an einer psychischen Erkrankung leiden, heißt dies nicht zwangsläufig, dass diese “schlechte” Eltern sind oder eine gefahr für das Kindeswohl darstellen. Diese Eltern können genau wie alle anderen Eltern auch ein oder mehrere Kinder liebevoll und wertschätzend großziehen oder auch negativ auf die Kinder und deren Entwicklung einwirken. Auch wenn ich mich in dieser Arbeit nur mit den Auswirkungen auf das Kind befasse, soll diese Arbeit nicht zu einer Stigmatisierung beitragen sondern diese eher abbauen und vor allem aufklären.
Zum Abschluss noch vielen Dank an meine Kommiliton*innen welche diese Arbeit Korrektur gelesen haben und mir im Schreibprozess immer Tipps und Verbesserungsmöglichkeiten gegeben haben sowie auch vielen Dank an Prof. Dr. Gaby Straßburger für das Feedback und die Hilfe für diese Arbeit.
1. Einleitung
Eine Geburt ist wahrscheinlich für viele Frauen einer der schönsten Momente in ihrem Leben. Auch wenn die vorangegangene Schwangerschaft eventuell nicht ganz problemlos ablief und die Geburt mit schmerzenden Wehen verbunden war.
Wenn die Kinder geboren werden, sind sie alles andere als eigenständig. Sie können sich nur mühsam fortbewegen, sie haben keine Zähne mit denen sie ihre Nahrung verzehren können und mitteilen funktioniert meist nur über schreien, weinen oder ähnlichem. Also sind die Neugeborenen vor allem in den ersten Jahren auf Hilfe von außen angewiesen. Diese Hilfe stellen meist die Eltern dar. Sie ernähren sie, wechseln ihnen die Windeln und bringen sie zum lächeln.
Mit fortschreitender Zeit wechselt die Rolle der Eltern langsam, aber stetig. Sie geht von pflegerisch allmählich zu erzieherisch über. Irgendwann sind die Eltern nicht mehr nur dafür da das Kind zu nähren und die Windeln zu wechseln, sondern sie erklären dem Kind klassische Benimmregeln und alle Grundlagen für ein gutes gesellschaftliches zusammenleben (vgl. Abels 2019, S.60 f.). Zudem helfen sie ihrem Kind bei der Problembewältigung, der Emotionsregulierung und sind eine Quelle von Liebe, Nähe, Wärme, und Sicherheit (vgl. Kißgen 2010, S.132).
Doch was passiert, wenn die Eltern das alles nicht eigenständig bewältigen können ? Was passiert mit den Kindern, wenn die Eltern selbst nicht angemessen mit ihren Problemen und Emotionen umgehen können oder wenn das Leben der Eltern nur durch den Substanzkonsum bestimmt ist ? All das hat unweigerlich Auswirkungen auf das Kind. Daher beschäftige ich mich in den folgenden Kapiteln dieser wissenschaftlichen Arbeit mit der Frage, welche Auswirkungen eine psychische Erkrankung der Eltern auf die Vulnerabilität des Kindes hat und wie die Soziale Arbeit helfen kann, anhand von Beispielen aus den Frühen Hilfen sowie anderen Präventions- und Beratungsprogrammen. Angemerkt sei hier noch, dass ich nicht auf ein spezielles Krankheitsbild eingehe, sondern den Leser*innen einen breiten Überblick über diese Problematik geben möchte.
2. Einordnung betroffener Menschen und Kinder in Deutschland
Psychische Erkrankungen sind ein wichtiges Thema. Nicht nur für Betroffene und Angehörige, sondern auch für die breite Gesellschaft und Politik. Psychische Erkrankungen gehören, mit immer steigender Tendenz, zu den weltweit häufigsten Krankheiten. Fast jeder Zweite erkrankt im Laufe seines Lebens an einer beliebigen Form von psychischen Auffälligkeiten oder Störungen (vgl. Rehder 2016, S.9).
In Deutschland erkranken jedes Jahr etwa 17,8 Millionen Erwachsene an einer psychischen Erkrankung. Menschen mit psychischen Erkrankungen leben in Deutschland rund 10 Jahre weniger und trotzdem nehmen nur 18,9% der Betroffenen jedes Jahr Hilfeleistungen in Anspruch (vgl. DGPPN 2022, S.1). Zudem weisen zwischen 7 bis 20% aller Kinder und Jugendlichen eine neurologische oder psychische Verhaltensauffälligkeit auf. 17,4% dieser Kinder sind zwischen 3 und 6 Jahre alt. (vgl. Hillenbrand Et al. 2010, S.210). Die Zahlen für betroffene Einzelpersonen, wie Erwachsene oder Kinder sind in Deutschland relativ gut erfasst und es gibt regelmäßig faktenbasierte und belastbare Veröffentlichungen darüber, wie beispielsweise von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde oder dem Barmer Arztreport.
Das Problem ist jedoch, dass nur die Zahlen der betroffenen Einzelpersonen bzw. der Personen, welche die Hilfeleistungen in Anspruch nehmen, gut erfasst werden. Sind Erwachsene in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung, wird nur selten gefragt, ob diese auch Kinder haben. Wenn sie es gefragt werden, dann wird dies meist mangelhaft dokumentiert. Das selbe Problem ist bei Kindern und Jugendlichen in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung. Bei diesen wird auch sehr selten der psychische Gesundheitszustand der Eltern abgefragt (vgl. Christiansen Et al. 2020, S. 24).
Demnach kann ich mich bei den Zahlen für Kinder mit psychisch erkrankten Elternteilen nur auf Schätzungen berufen. Nach diesen Schätzungen haben etwa 3 bis 3,8 Millionen Kinder und Jugendliche mindestens ein Elternteil, welches temporär oder chronisch an einer oder mehreren psychischen Erkrankungen erkrankt ist. Von diesen 3 bis 3,8 Millionen Kindern und Jugendlichen sind etwa 15% der Kinder unter drei Jahre alt. (vgl.: Christiansen Et al. 2020, S.1; Pillhofer Et al. 2020, S.5; PTK-NRW 2020, S.1)
3. Die Auswirkungen einer psychischen Erkrankung der Eltern, auf das Kind.
3.1. Die Eltern-Kind-Beziehung
Eltern beeinflussen ihre Kinder auf verschiedenste Weise. Vor allem in jüngsten Jahren, sichern sie nicht nur unser Überleben, sondern auch unser psychisches wohlbefinden. (vgl. Wiegand-Grefe Et al. 2019, S.25f). Durch situativ angemessenes Verhalten gleichen die Eltern etwaige Stimmungsschwankungen aus oder lindern den vom Kind empfundenen Stress. Somit helfen sie den Kindern bei ihrer Emotionsregulation, solange sie es nicht selbst können (vgl. Kißgen 2010, S.132).
Angemessenheit ist hierbei ein gutes Stichwort, denn das Verhalten der Eltern auf die Signale des Kindes sollte immer bedarfsgerecht sein. Wenn das Kind weint, weil es Hunger hat, ist es gleichermaßen zu vermeiden dem Kind zu wenig als auch zu viel Essen zu geben. Zu wissen, wann das Kind Hunger hat, die Windeln gewechselt werden müssen oder zu merken, wann das Kind gestresst ist, benötigt Feinfühligkeit. Feinfühligkeit beschreibt, im Eltern-Kind Kontext, die Fähigkeit die Signale des Kindes wahrzunehmen und dementsprechend angemessen zu handeln (vgl. Kißgen 2010, S.132f., S.140f. ; Scheuerer-Englisch und Fröhlich 2010, S. 250)
Eine hohe Feinfühligkeit der Eltern geht mit vielen positiven Auswirkungen für die Kinder einher. Die Kinder von Müttern mit einer hohen Feinfühligkeit, weinen meist weniger und zeigen weniger Anzeichen von Stress, Angst oder Ärger. Generell steigert eine hohe Feinfühligkeit die Bindungsqualität zwischen den Eltern und den Kindern. Sie baut eine Basis von Vertrauen, Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft auf. Dies ermöglicht dem Kind seine Umwelt mit positiven Erwartungen zu erkunden (vgl. Kißgen 2010, S,141 f.).
Ein Problem, welches hier auftritt ist, dass eine psychische Erkrankung der Eltern nicht nur häufig mit einer geringeren Feinfühligkeit, einer schlechteren Bindungsqualität zwischen Eltern und Kind sowie geringeren Erziehungskompetenzen einhergeht, sondern auch das die Gefahr besteht, dass diese Eltern eventuell nicht ordentlich für ihre Kinder sorgen können (vgl. Christiansen Et al. 2020, S.8; Alle 2017, S.71, S.14). Das alles geht mit einer Vielzahl negativer Auswirkungen für die Kinder einher. Die Kinder könnten das krankhafte Verhalten der Eltern übernehmen und beispielsweise zukünftig selbst Substanzen oder Medikamente für die Stress- und Emotionsregulation missbrauchen. Das Entwicklungsrisiko für Bindungsstörungen bei den Kindern erhöht sich, die Fähigkeit zur Emotionsregulation nimmt ab, was langfristig zu pathologischen Auffälligkeiten der Kinder führen kann (vgl. Christiansen Et al. 2020 S.8).
Eine psychische Erkrankung der Eltern benötigt unter umständen eine menge an Aufmerksamkeit. Es dazu kommen, dass die eigene Krankheit, statt des Kindes im alltäglichen Fokus der Eltern liegt. Dadurch kann es zu einer Verschiebung der Rollen- und Aufgaben-Verhältnisse kommen, sodass die Kinder womöglich selbst den Haushalt bewältigen, einkaufen gehen und kochen. Sozusagen kann es dazu kommen, dass die Kinder die Elterliche Verantwortung für sich und ihre Eltern übernehmen. Dies und die Tatsache, dass sich die Kinder oft selbst die Schuld an der Erkrankung der Eltern geben, führt zu einer starken Belastung für die Kinder (vgl. Christiansen Et al. 2020 S.7, S.9; Rehder 2016, S.10).
3.2. Die Auswirkungen auf die Vulnerabilität und Resilienz der Kinder
Manche Kinder und Jugendliche erkranken psychisch aufgrund dieser Belastung, andere allerdings nicht. Ungefähr 15 bis 38% der Kinder von psychisch kranken Eltern zeigen selbst psychische Auffälligkeiten (vgl. Christiansen Et al. 2020, S.3). Die Frage ist allerdings, wieso die anderen 62 bis 85% keine psychischen Auffälligkeiten zeigen. Dies hängt vermutlich mit der Resilienz der Kinder zusammen.
Resilienz beschreibt eine psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress. Also eine Fähigkeit, die es möglich macht belastende Situationen, sowie Krisen zu überstehen ohne hierbei psychisch zu erkranken. Diese Fähigkeit ist zudem nicht angeboren. Resilienz bildet sich im Laufe des eigenen Lebens und kann stets trainiert und somit gestärkt werden (vgl. Fingerle 2010, S. 148 ff. ; Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse 2017, S. 718).
Vulnerabilität auf der anderen Seite, stellt das Gegenstück zu Resilienz dar. Vulnerabilität beschreibt das Risiko bzw. Anfälligkeit im Laufe des Lebens dysfunktional auf Stress bzw. Belastungen zu reagieren und gegebenenfalls aufgrund von Krisen oder Belastungen psychisch zu erkranken (vgl. Burghardt Et al. 2017, S.19; Christiansen Et al. 2020, S.8 f.).
Sowohl die Resilienz, als auch die Vulnerabilität eines Menschen wird durch bestimmte Faktoren beeinflusst. Sogenannte Schutzfaktoren erhöhen die Resilienz und Risikofaktoren senken die Resilienz bzw. erhöhen die Vulnerabilität. Allerdings sind diese Faktoren nicht absolut, sondern erhöhen oder senken die Wahrscheinlichkeit mit der ein Mensch im Laufe seines Lebens an einer psychischen Erkrankung erkrankt. Das heißt, es kann jemand ohne Risikofaktoren in seinem Leben an einer psychischen Erkrankung erkranken, sowie jemand mit kaum Schutzfaktoren in seinem Leben keine psychische Erkrankung erleben muss. Auch gleichen sich die Risiko- und Schutzfaktoren nicht aus, alle beeinflussen den Menschen individuell (vgl. Fingerle 2010, S.153). Allerdings verstärken sich die Effekte dieser Faktoren, je mehr Faktoren vorhanden sind (vgl. Christiansen 2020, S.10), so zeigen zwei Drittel der Kinder mit mehr als 6 Risikofaktoren eine klinisch relevante Auffälligkeit (vgl. Scheuerer-Englisch und Fröhlich 2010, S.252).
Schutz- und Risikofaktoren sind sehr vielfältig. Schutzfaktoren können u.a. eine gute Kommunikations- und Problemlösefähigkeit oder die effektive Nutzung von eigenen Talenten und Interessen sein. Auch wirken eine gute Organisations- und Planungsfähigkeit sowie Selbstvertrauen, als auch ein positives Selbstwertgefühl schützend. Selbstwirksamkeitserfahrungen wie auch eine stabile und verlässliche Bezugsperson innerhalb und außerhalb der Familie unterstützen die Bildung von Resilienz. Diese Aufgezählten Schutzfaktoren sind keineswegs eine komplette Liste aller möglichen Schutzfaktoren. Sie sind meistens individuell und immer verschieden ausgeprägt. (vgl. Fingerle 2010, S. 150).
Mögliche Risikofaktoren auf der anderen Seite sind beispielsweise: eine geringe Feinfühligkeit der Eltern, Beeinträchtigung der Emotionsregulierung, negative Modelle für Stressbewältigungsverhalten, familiäre Disharmonie, häusliche Gewalt, finanzielle Schwierigkeiten, Traumata, unsichere Bindungen, geringes Selbstwertgefühl, geringe soziale und kognitive Fähigkeiten (vgl. Christiansen Et al. 2020, S.8f.)
Ein oder mehrere psychisch erkrankte Elternteile, sowie fehlendes Wissen über die Erkrankung der Eltern, erhöhen das Risiko für das Kind eine psychischen Erkrankung zu entwickeln. So steigt das Erkrankungsrisiko für die Kinder, je nach Erkrankung der Eltern, bis um das 13-Fache. Das Risiko an Schizophrenie zu erkranken, von Kindern mit einem schizophrenen Elternteil, liegt bei 13%, wobei das Risiko für die Allgemeinbevölkerung lediglich bei 0,5 bis 1% liegt. Bei Depressionen ist das Risiko 4-mal so hoch für das Kind selbst Depressionen zu entwickeln und bei Angststörungen 7-mal so hoch, als für die Allgemeinbevölkerung (vgl. Alle 2017, S.116 ; Rehder 2016, S.10). Zudem erhöht sich das Risiko, wenn die Erkrankung der Eltern phasenweise zurück kommt (z.B. wie bei saisonal affektiven störungen, wie beispielsweise der sogenannten Winterdepression). Wenn mehrere Störungen vorhanden sind oder wenn sich die Störung der Eltern noch vor Ihrem 30 Lebensjahr entwickelt, erhöht sich das Risiko für die Kinder noch einmal (vgl. Christiansen Et al. 2020, S. 7f). Allerdings ist das Risiko an einer beliebigen psychischen Erkrankung zu erkranken weitaus höher, als das Risiko an der selben Erkrankung zu leiden, wie die Eltern (vgl. Rehder 2016, S. 10). Auch generell betrachtet entwickeln 60% der Kinder mit einem oder mehreren psychisch kranken Elternteil eine psychische Erkrankung (vgl. Alle 2017, S. 116).
Das liegt allerdings nicht nur an der Genetik. Die Resilienzfähigkeit, die Umweltfaktoren wie Vermögen (denn ein besseres Einkommen verringert das Risiko psychisch zu erkranken), die Stadt und der Bezirk in dem man aufwächst, die eigene Bildung bzw. Bildungschancen, sowie die psychosozialen Lebensumstände der Kinder haben einen noch größeren Einfluss auf das Erkrankungsrisiko als die Genetik (vgl. Alle 2017, S. 117 ; Christiansen Et al. 2020, S. 9).
4. Präventions- und Interventionsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit
Die Frage ist jetzt, wie man diese Auswirkungen präventiv verhindern kann oder den schon betroffenen Kindern helfen kann. Es ist nicht nur unbekannt, wie viele Kinder eigentlich von dieser Problematik betroffen sind (vgl.Christiansen Et al. 2020, S.24), dazu kommt das die Studienlage für Frühinterventionsprogramme nicht aussagekräftig genug ist. Die Studienergebnisse sind häufig nicht eindeutig und wenn ein positiver Effekt beobachtet werden konnte, ist dieser meist nur klein. Dennoch ist unbestritten, dass Präventionsmaßnahmen wichtig und wirksam sind, auch wenn die Effekte zur Zeit wissenschaftlich noch nicht gut belegt sind (vgl. Christiansen Et al. 2020, S.13 f.).
Trotz dieser schwierigen Studienlage, gibt es einige Programme, welche in der Theorie und Praxis gut erprobt sind. Das wohl am besten erprobte und am weitesten verbreitetste Frühinterventionsprogramm ist das STEEP™ Programm. Das Programm steht für Steps Towards Effective and Enjoyable Parenting bzw. Schritte zu einer effektiven und erfreulichen Elternschaft. In diesem Programm wird mithilfe von Hausbesuchen, Eltern-Kind Gruppen, Familienaktionen und videogestützter Eltern-Kind Interaktionsanalyse die Feinfühligkeit der Eltern gestärkt und die soziale Isolation abgebaut. Das funktioniert, indem die Eltern ein Video davon machen, wie sie mit ihrem Kind umgehen und interagieren. Dieses Video wird dann zusammen mit dem Berater angesehen und analysiert. Dadurch lernen die Eltern die Signale des Kindes besser und früher wahrzunehmen und das führt zu einer höheren Feinfühligkeit, wie auch einer stärkeren und sicheren Bindung zwischen Eltern und Kind. Das STEEP™ Programm ist für Eltern ab der Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr des Kindes konzipiert (vgl. Kißgen 2010, S.140 f. ; Wiegand-Grefe Et al. 2019, S.37ff. ; Bohlen ; Maier 2015 ; Hartfiel 2016).
Ein weiteres Beispiel ist das Programm “Lubo aus dem All”. Die Zielgruppe für dieses Programm sind Kinder im Vorschulalter. Das Programm fördert die emotionale Kompetenz, Emotionsregulation, soziale Kompetenzen, sowie die Beziehungs- und Bindungsfähigkeit der Kinder. Das wird erreicht, indem Rollenspiele mit Puppen durchgespielt werden, die Kinder gedanklich eine Person aus einem Kinderbuch übernehmen und gefragt werden, wie sie sich in dieser Situation verhalten würden. Zudem werden noch Kooperationsspiele gespielt, gemeinsame Projekte durchgeführt, geleitetes Problemlösen geübt und die Eltern werden angeregt mehr mit ihren Kindern über die eigenen Gefühle zu reden, sowie die eigenen Problemlösestrategien sprachlich zu kommunizieren. Damit steigert das Programm die sozial-kognitiven Leistungen der Kinder deutlich, reduziert Verhaltensprobleme und verhilft den Kindern damit zu einem guten Übergang von dem Kindergarten in die Schule (vgl. Hillenbrand Et al. 2010, S. 209 ff.).
Weitere Programme wären:
CHAMPS (Children and mentally ill Parents) bzw. die deutsche Variante KANU ist ein Interventionsprogramm für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Hier werden mithilfe von wöchentlichen Sitzungen oder vier ganztägigen Sitzungen die sozialen Kompetenzen der Kinder gefördert (vgl. Wiegand-Grefe Et al. 2019, S.17).
PATS (Paying Attention To Self) ist für Jugendliche zwischen 12-18 Jahren entwickelt worden und stammt auch aus Australien. Hierbei steht auch die Förderung der sozialen Kompetenzen der Jugendlichen im Mittelpunkt. Ergänzend werden Psychoedukation (also Aufklärung über die Erkrankung der Eltern) und der Aufbau von Stressbewältigungsstrategien gefördert (vgl. Wiegand-Grefe Et al. 2019, S.17f).
Die “Family Intervention” bzw. die Deutsche Abwandlung “Hoffnung, Sinn und Kontinuität”. Hierbei wird auf einer Mischung aus der Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen, Psychoedukation, Kommunikationstraining und Elterntraining gesetzt (vgl. Wiegand-Grefe Et al. 2019, S.18f.).
Das Projekt NischE (Nicht von schlechten Eltern) ist ein Familien fokussiertes Programm, welches mit Einzelgesprächen, Familiengesprächen und Einzelförderung in mehreren Phasen die Eltern-Kind Beziehung, die familiäre Kommunikation und den Abbau von stressoren der Jugendlichen verbessert (vgl. Wiegand-Grefe Et al. 2019, S.21f.).
Das waren alles nur Beispiele. Es gibt noch eine Vielzahl weiterer Programme und Hilfsmöglichkeiten. Diese weiter aufzuschlüsseln, würde allerdings den Rahmen dieser Arbeit übersteigen.
Auffällig bei allen Programmen ist, dass oft der Fokus auf die Förderung der Resilienz mithilfe von sozialem und emotionalem Kompetenztraining, dem Erlernen von Stressbewältigungsstrategien sowie der Psychoedukation liegt (vgl. Wiegand-Grefe Et al. 2019, S.30 f.).
Auch wenn es durch die hier aufgezeigte menge an Hilfsmöglichkeiten so aussieht, als würde die Versorgungslage gut sein muss ich dem leider widersprechen. Aufgrund von fehlender Zusammenarbeit zwischen Kliniken, Psychotherapeuten, Beratungs-, Präventions-, Interventionsstellen und sonstigen Einrichtungen. Der Tatsache, dass sich die meisten Eltern selbst um die Teilnahme in den Programmen kümmern müssen, sowie der Angst der Eltern vor Stigmatisierung wie auch über die Versorgung der Kinder, werden viele Angebote schlichtweg nicht wahrgenommen (vgl. Christiansen Et al. 2020, S. 24 ; Alle 2017, S,115 ; Wiegand-Grefe Et al. 2019, S.8 f.).
5. Zusammenfassung und Schlussfolgerung
Eine psychische Erkrankung der Eltern hat teilweise weitreichende Folgen für die Vulnerabilität und Resilienz-Bildung der Kinder. Sie erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder selbst eine psychische Erkrankung entwickeln signifikant, stört die Entwicklung von sicheren Bindungsmustern, beeinträchtigt die sozialen und emotionalen Kompetenzen des Kindes und kann zu einer schlechteren akademischen Leistung führen. Diese Faktoren schädigen die Entwicklung des Kindes nicht nur temporär, sondern im schlimmsten Fall permanent. Die Tatsache, dass es keine genau statistische Erhebung zu dieser Problematik gibt und die Forschungslücke im Bereich der Frühintervention, sowie der fehlenden interdisziplinären Kooperation zeigt Nachholbedarf auf.
Schlussfolgernd ist zu sagen, dass die Forschungslücke bekannt ist und es auch schon einige weitere Forschungsprojekte gibt, welche genau diese Lücke füllen wollen (vgl. Christiansen Et al. 2020, S.17 ff.). Zudem sollten die Einrichtungen besser miteinander kooperieren und die Klient*innen besser in die Hilfestrukturen einbinden. Denn jeder hat eine Chance auf gute Hilfsangebote sowie ein gesundes und sorgenfreies Leben verdient.
6. Literaturverzeichnis
Abels, Heinz (2019). Einführung in die Soziologie: Band 2: Die Individuen in ihrer Gesellschaft. 5. Auflage. Wiesbaden: Springer VS
Alle, Friederike (2017). Kindeswohlgefährdung: das Praxishandbuch. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
Bohlen, Uta (keine Jahresangabe). Das Beratungs- und Frühinterventionsprogramm STEEP™. mamamia e.V.: https://steep-qualifizierung.de/was-ist-steeptm/ (Stand: 26.02.2022)
Burghardt, Daniel; Dziabel, Nadine; Höhne, Thomas; Dederich, Markus; Lohwasser, Diana; Stöhr, Robert; Zirfas, Jörg (2017). Vulnerabilität: pädagogische Herausforderung. Stuttgart: Kohlhammer.
Christiansen, Hanna; Röhre, Bernd; Fahrer, Julia; Stracke, Markus; Dobener, Lisa-Marie (2020). Kinder von Eltern mit psychischen Erkrankungen : State of the Art für Psychotherapeutinnen, Pädiaterinnen, Pädagoginnen. Wiesbaden : Springer.
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V. (DGPPN) (2022). Basisdaten Psychische Erkrankungen: https://www.dgppn.de/_Resources/Persistent/be8589427bb02b67f5592b73cbb4d32cde26d0be/Factsheet_Kennzahlen%202022.pdf (Stand: 26.02.2022)
Fingerle, Michael (2010). Risiko, Resilienz und Prävention. In: Rüdiger Kissen / Norbert Heinen (Hrsg.). Frühe Risiken und Frühe Hilfen. Stuttgart: Klett-Cotta. S. 148-160
Fröhlich-Gildhoff, Klaus; Rönnau-Böse, Maike (2017). Resilienz. in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (Hrsg.). Fachlexikon der Sozialen Arbeit 8. Auflage. Baden-Baden: Nomos. S. 718
Grobe, G. Thomas; Széchenyi, Joachim (2021). BARMER Arztreport 2021: https://www.bifg.de/publikationen/reporte/arztreport-2021 (Stand: 26.02.2022)
Gutmann, Renate (2017). Professionelle Hilfe aus der Sicht von Müttern mit einer psychischen Erkrankung. Weinheim; Basel: Beltz Juventa.
Hartfiel, kein Vorname (2016). Vorstellung des STEEP-Programms. Jugendamt des Bezirksamtes Treptow-Köpenick von Berlin: https://www.fruehehilfen-tk.de/vorstellung-des-steep-programm/ (Stand 26.02.2022)
Hillenbrand, Clemens; Hennemann, Thomas und Schell, Annika (2010). Sozial-emotionale Kompetenzförderung im Vorschulalter für Kinder unter Risiko - das Programm >>Lubo aus dem All!<< In: Rüdiger Kissen / Norbert Heinen (Hrsg.). Frühe Risiken und Frühe Hilfen. Stuttgart: Klett-Cotta. S. 209-231
Heedt Thorsten (2019). Borderline-Persönlichkeitsstörung: Das Kurzlehrbuch. Stuttgart: Schattauer
Kegel, Bernhard (2015). Epigenetik: Wie unsere Erfahrungen vererbt werden. Köln: DuMont
Kißgen, Rüdiger (2010). Frühe Risiken und Präventivintervention aus Sicht der Bindungstheorie. In: Rüdiger Kissen / Norbert Heinen (Hrsg.). Frühe Risiken und Frühe Hilfen. Stuttgart: Klett-Cotta. S.132-147
Lenz, Albert (2012). Psychisch Kranke Eltern und ihre Kinder. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
Lenz, Albert; Brockmann, Eva (2013). Kinder psychisch kranker Eltern stärken: Informationen für Eltern, Erzieher und Lehrer. Göttingen: Hogrefe
Maier, Frumentia (2015). Das Frühinterventionsprogramm STEEP – ein wirksamer Baustein Früher Hilfen. Neue Caritas: https://www.caritas.de/neue-caritas/heftarchiv/jahrgang2015/artikel/das-fruehinterventionsprogramm-steep--ein-wirksamer-baustein (Stand: 26.02.2022)
Martin, Miriam; Schu, Martina; Walter-Hamann, Renate (Hrsg.) (2018). Suchtkranke Eltern stärken: eine interdisziplinäre Handreichung. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
Pillhofer, Melanie; Prof. Dr. Ute Ziegenhain, Prof. Dr. med. Jörg M. Fegert, Till Hoffmann, Mechthild Paul (2020). Kinder von Eltern mit psychischen Erkrankungen im Kontext der Frühen Hilfen: https://www.fruehehilfen.de/fileadmin/user_upload/fruehehilfen.de/pdf/Publikation-NZFH-Eckpunktepapier-Kinder-psychisch-kranker-Eltern-b.pdf (Stand: 26.02.2022)
Oswald, Corinna; Meer Janina (2019). Kinder und Jugendliche aus Suchtbelasteten Familien; Methodenhandbuch. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
Psychotherapeuten Kammer NRW (PTK NRW) (2020). Situation der Kinder psychisch kranker Eltern: https://www.ptk-nrw.de/fileadmin/user_upload/downloads/04_psychotherapeuten/kjp/PTK_NRW_I_zur_Situation_der_Kinder_psychisch_kranker_Eltern.pdf (Stand: 26.02.2022)
Rehder, Michael (2016). Psychisch belastete Eltern in der Sozialpädagogischen Familienhilfe: Ergebnisse ethnographischer Forschung. Weinheim ; Basel: Beltz Juventa.
Schrappe, Andreas (2018). Kinder und ihre psychisch erkrankten Eltern: kompetent beraten, sicher kooperieren. Weinheim; Basel: Beltz Juventa.
Scheuerer-Englisch, Hermann und Fröhlich, Herbert (2010). Frühe Hilfen - Möglichkeiten und Angebote im Rahmen der Erziehungsberatung. In: Rüdiger Kissen / Norbert Heinen (Hrsg.). Frühe Risiken und Frühe Hilfen. Stuttgart: Klett-Cotta. S. 246-271
Wiegand-Grefe, Silke; Klein, Michael; Kölch, Michael; Lenz, Albert; Seckinger, Mike; Thomas’s, Rainer; Ziegenhain, Ute (2019). Kinder psychisch kranker Eltern “Forschung”: IST-Analyse zur Situation von Kindern psychisch kranker Eltern. https://www.ag-kpke.de/wp-content/uploads/2019/02/Stand-der-Forschung-1.pdf (stand 26.02.2022)
Zick, Jowita (2014). Kinder von Borderline-Eltern: Entwicklung, Risiko- und Schutzfaktoren. Marburg: Tectum.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Textes?
Dieser Text behandelt die Auswirkungen einer psychischen Erkrankung der Eltern auf Kinder, Präventions- und Interventionsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit in Deutschland.
Wer gilt in diesem Text als psychisch erkrankte Person?
Eine Person mit einer oder mehreren Störungen aus dem DSM-5 oder dem ICD-11, von einem anerkannten Arzt oder Psychiater, diagnostiziert wurde.
Wie viele Kinder und Jugendliche in Deutschland haben mindestens ein Elternteil mit einer psychischen Erkrankung?
Schätzungen zufolge haben etwa 3 bis 3,8 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland mindestens ein Elternteil, welches temporär oder chronisch an einer oder mehreren psychischen Erkrankungen erkrankt ist. Ungefähr 15% dieser Kinder sind unter drei Jahre alt.
Welche Auswirkungen kann eine psychische Erkrankung der Eltern auf die Eltern-Kind-Beziehung haben?
Eine psychische Erkrankung der Eltern kann mit einer geringeren Feinfühligkeit, einer schlechteren Bindungsqualität zwischen Eltern und Kind sowie geringeren Erziehungskompetenzen einhergehen. Dies kann zu einer Vielzahl negativer Auswirkungen für die Kinder führen, wie beispielsweise die Übernahme krankhaften Verhaltens, erhöhte Anfälligkeit für Bindungsstörungen und verminderte Fähigkeit zur Emotionsregulation.
Was ist Resilienz und Vulnerabilität im Kontext von Kindern psychisch kranker Eltern?
Resilienz beschreibt die psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress, die es ermöglicht, belastende Situationen und Krisen zu überstehen ohne psychisch zu erkranken. Vulnerabilität stellt das Gegenstück dar und beschreibt das Risiko bzw. die Anfälligkeit, dysfunktional auf Stress bzw. Belastungen zu reagieren und gegebenenfalls aufgrund von Krisen oder Belastungen psychisch zu erkranken.
Welche Schutz- und Risikofaktoren beeinflussen die Resilienz und Vulnerabilität von Kindern?
Schutzfaktoren können u.a. eine gute Kommunikations- und Problemlösefähigkeit oder die effektive Nutzung von eigenen Talenten und Interessen sein. Risikofaktoren können eine geringe Feinfühligkeit der Eltern, Beeinträchtigung der Emotionsregulierung, familiäre Disharmonie, häusliche Gewalt und finanzielle Schwierigkeiten sein.
Welche Präventions- und Interventionsmöglichkeiten gibt es durch die Soziale Arbeit?
Es gibt verschiedene Programme, welche die Resilienz mithilfe von sozialem und emotionalem Kompetenztraining, dem Erlernen von Stressbewältigungsstrategien sowie der Psychoedukation fördern. Beispiele sind STEEP™, Lubo aus dem All, CHAMPS/KANU, PATS, Family Intervention/Hoffnung, Sinn und Kontinuität und NischE.
Welche Probleme gibt es bei der Versorgung von Kindern psychisch kranker Eltern?
Aufgrund fehlender Zusammenarbeit zwischen Kliniken, Psychotherapeuten, Beratungs-, Präventions-, Interventionsstellen und sonstigen Einrichtungen, der Selbstinitiative der Eltern und der Angst vor Stigmatisierung werden viele Angebote nicht wahrgenommen.
Was ist das Fazit des Textes?
Psychische Erkrankungen der Eltern haben teilweise weitreichende Folgen für die Entwicklung der Kinder. Es besteht Nachholbedarf bei der statistischen Erhebung, der Forschung im Bereich der Frühintervention und der interdisziplinären Kooperation. Einrichtungen sollten besser kooperieren und Klient*innen besser in die Hilfestrukturen einbinden.
- Quote paper
- Niklas Kollwitz (Author), 2022, Vulnerabilität in der Kindheit und Adoleszenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1305695