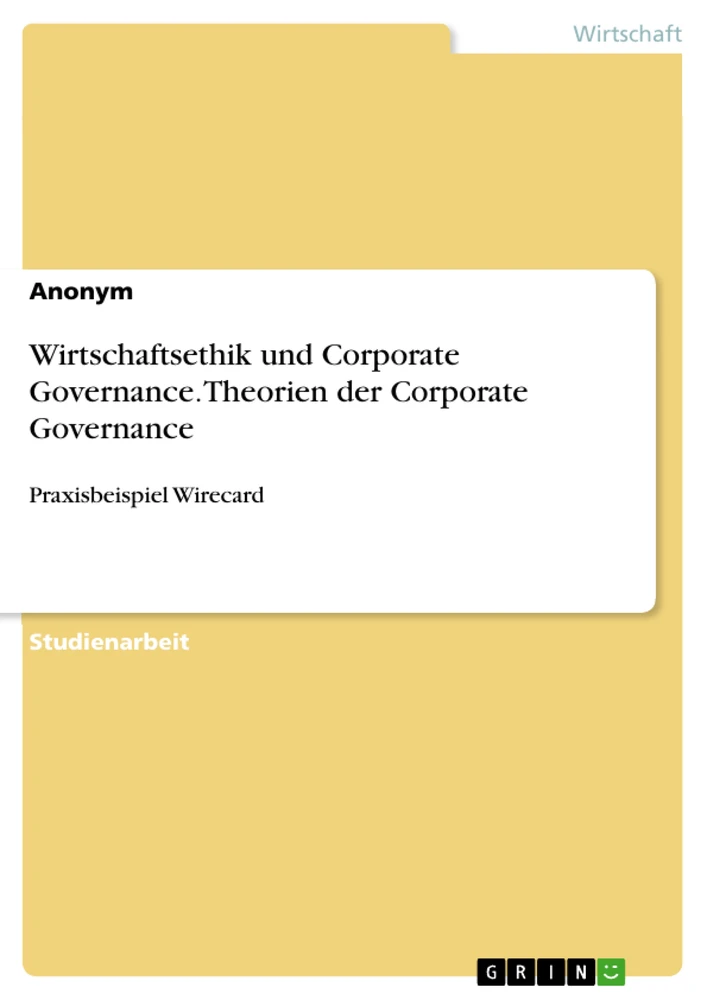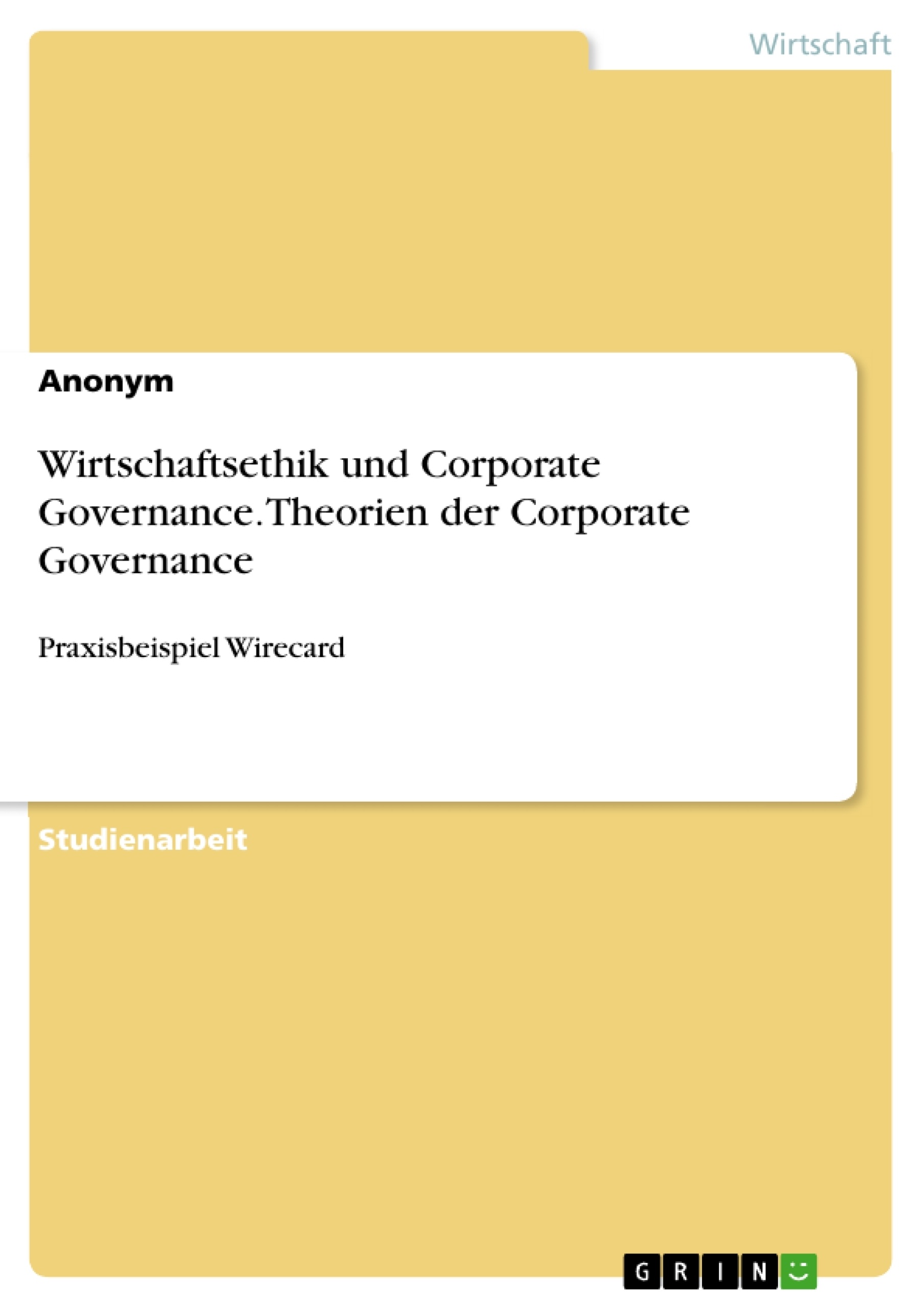In dieser Hausarbeit liegt der Fokus auf der Stewardship- und Prinzipal-Agenten-Theorie. Im Verlauf wird neben allgemeinen Erklärungen zu den Theorien auch die Rolle des Vertrauens in den beiden Ansätzen erörtert. Nach einem Vergleich der beiden Theorien und den Auswirkungen der Theorien auf die Gestaltung der Corporate Governance wird im zweiten Teil der Arbeit
anhand des Praxisbeispiels Wirecard erläutert, wie die Theoriegrundlagen angewendet wurden und welche Mechanismen zum Versagen der Corporate Governance in diesem Fall beitrugen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Prinzipal-Agenten Theorie
- Stewardship Theorie
- Prinzipal-Agenten Theorie vs. Stewardship Theorie – die Unterschiede
- Auswirkungen der Theorien auf die Gestaltung der Corporate Governance
- Publizitätspflicht
- Aufsichtsgremien
- Vergütungssystem der Unternehmensführung
- Präambel des Deutschen Corporate Governance Kodex
- Praxisbeispiel Wirecard
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Prinzipal-Agenten-Theorie und die Stewardship-Theorie im Kontext von Corporate Governance. Sie beleuchtet die Unterschiede zwischen den beiden Ansätzen und deren Auswirkungen auf die Gestaltung von Corporate Governance-Strukturen. Außerdem wird am Beispiel von Wirecard untersucht, wie die Theoriegrundlagen in der Praxis angewendet wurden und welche Mechanismen zum Versagen der Corporate Governance beigetragen haben.
- Die Prinzipal-Agenten-Theorie und die Stewardship-Theorie als Organisationstheorien in der Corporate Governance
- Die Rolle des Vertrauens in beiden Theorien
- Die Auswirkungen der Theorien auf die Gestaltung von Corporate Governance-Strukturen
- Die Anwendung der Theoriegrundlagen am Praxisbeispiel Wirecard
- Die Ursachen für das Versagen der Corporate Governance im Fall Wirecard
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung gibt einen Überblick über die Relevanz von Corporate Governance im Kontext von Unternehmensskandalen wie dem VW-Dieselskandal, Commerzbank und Wirecard.
- Prinzipal-Agenten Theorie: Dieses Kapitel beschreibt die Grundprinzipien der Prinzipal-Agenten-Theorie, die von einer Informationsasymmetrie zwischen Prinzipal (Aktionär) und Agent (Unternehmensleitung) ausgeht. Es werden die verschiedenen Arten von versteckten Informationen und Verhaltensweisen sowie die Kritikpunkte der Theorie erläutert.
- Stewardship Theorie: Dieses Kapitel stellt die Stewardship-Theorie als Gegenentwurf zur Prinzipal-Agenten-Theorie vor. Es betont die Annahme, dass Manager die Geschäfte der Organisation verantwortungsvoll und integer führen. Die Rolle des Vertrauens als entscheidender Unterschied zwischen den beiden Theorien wird hervorgehoben.
- Prinzipal-Agenten Theorie vs. Stewardship Theorie – die Unterschiede: Dieser Abschnitt vergleicht die beiden Theorien und untersucht ihre Auswirkungen auf die Gestaltung von Corporate Governance-Strukturen. Dabei werden Themen wie Publizitätspflicht, Aufsichtsgremien und Vergütungssysteme der Unternehmensführung beleuchtet.
- Praxisbeispiel Wirecard: Dieses Kapitel analysiert das Beispiel Wirecard und zeigt, wie die Theoriegrundlagen der Prinzipal-Agenten-Theorie und der Stewardship-Theorie in diesem Fall angewendet wurden. Es untersucht, welche Mechanismen zum Versagen der Corporate Governance beigetragen haben.
Schlüsselwörter
Corporate Governance, Prinzipal-Agenten-Theorie, Stewardship-Theorie, Informationsasymmetrie, Vertrauen, Opportunismus, Kontrollmechanismen, Aufsichtsgremien, Vergütungssysteme, Wirecard, Unternehmensskandale.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Wirtschaftsethik und Corporate Governance. Theorien der Corporate Governance, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1305625