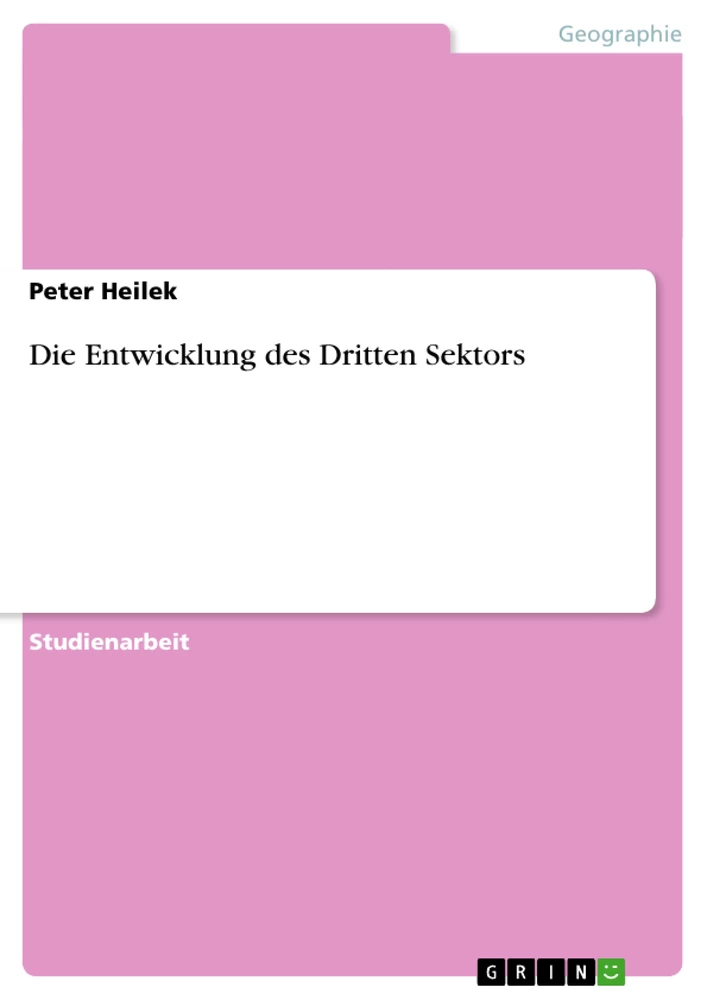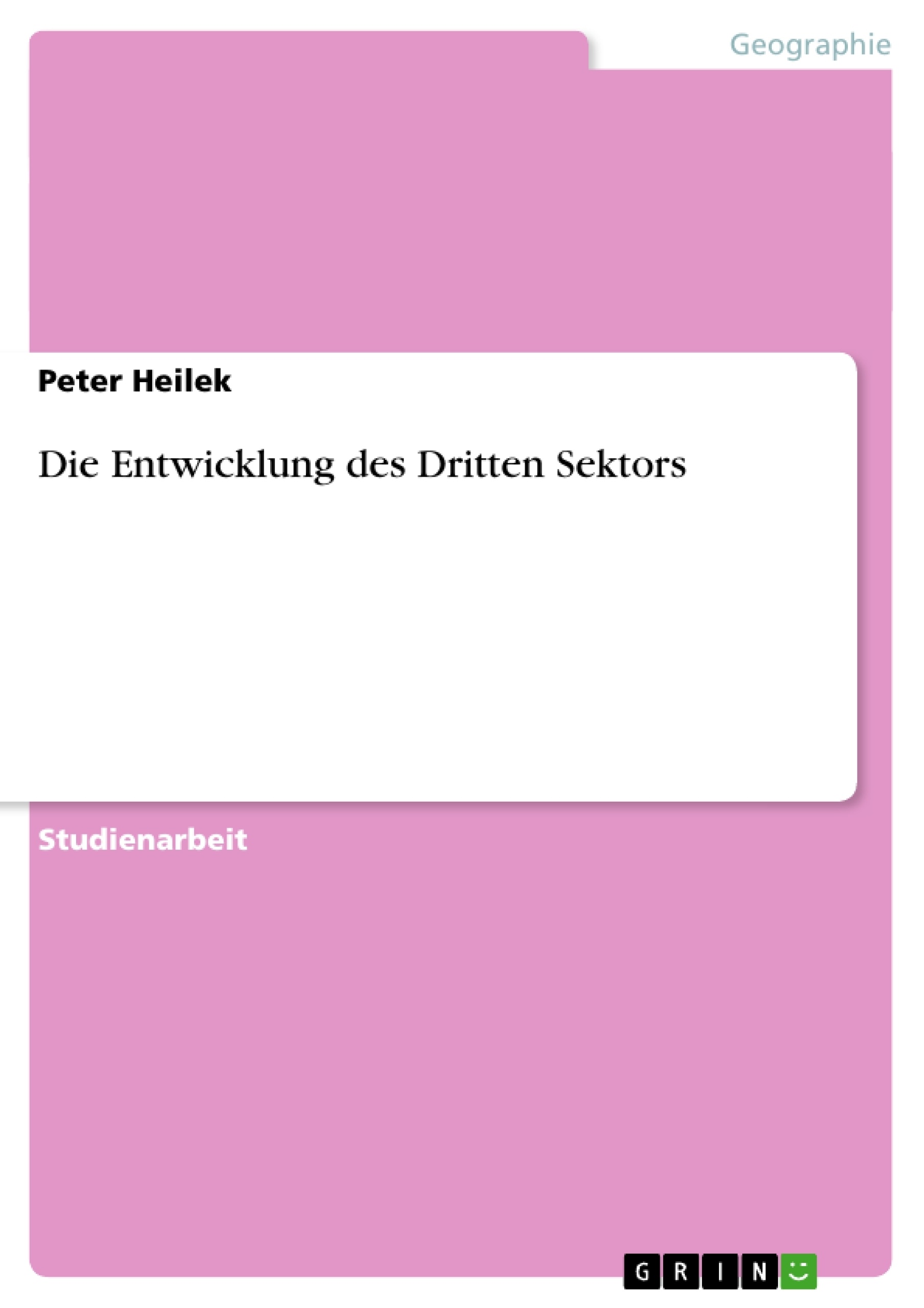In Wissenschaft und Politik fand er bis vor wenigen Jahrzehnten kaum Beachtung. Und auch heute gibt es in Deutschland nur wenige Institute und Lehrstühle, die sich mit Struktur und Potenzial des Dritten Sektors beschäftigen. Doch in aktuellen Debatten über die Zukunft der modernen Gesellschaft gewinnt der „Nonprofit-Sektor“ zusehends an Bedeutung. Doch wie lässt sich dieses neu erwachte Interesse an Funktionen und Möglichkeiten von Stiftungswesen, gemeinnützigen Verbänden, Ehrenamt und privaten Einrichtungen im Kultur- und Freizeitbereich etc. erklären? Einen Teil der Antwort sehen Wissenschaftler in dem Wertewandel sowie den tiefgreifenden wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen, „die insbesondere seit 1989 unsere Gesellschaft prägen und ein Ende des industriewirtschaftlichen Wohlfahrtstaates erahnen lassen.“ (ANHEIER 1998:13) Als ein weiterer Faktor wird der letztlich damit einhergehende Vertrauensverlust gegenüber staatlichen Aktivitäten angeführt, welcher nicht-staatliche Organisationen verstärkt in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken lässt (Vgl. ebd.).
Wie es jedoch zum Entstehen dieses wirtschaftlichen Sektors „zwischen Markt und Staat“, welcher keinesfalls synonym zum Begriff des tertiären Sektors verwendet werden sollte, kam, welche Komponenten ihn konstituieren und wie dieser Sektor sozial in der Gesellschaft verortet ist, wird Thema der vorliegenden Arbeit sein. Hierbei liegt der Fokus der Betrachtung auf der Entwicklung und der gesellschaftspolitischen Bedeutung des Nonprofit-Sektors in Deutschland. Dennoch wird versucht, ebenso einen Einblick in die internationale Entwicklung des Dritten Sektors zu geben und einige Vergleiche zu Deutschland zu ziehen. Darüber hinaus wird der im Laufe der Arbeit zu erläuternden Polyfunktionalität des Sektors ein weiterer Abschnitt gewidmet, welcher zudem einen Ausblick in die Zukunft wagt und Entwicklungschancen sowie Potenziale des Sektors versucht einzuschätzen. In einer abschließenden Zusammenfassung werden die markantesten Eckpunkte der Entwicklung sowie die gesellschafts- und wirtschaftspolitische Relevanz dieses Wirtschaftsbereiches kompakt zusammengestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Der Dritte Sektor - Versuch einer Definition
- Entwicklung und Struktur des Dritten Sektors
- Entwicklungen in Deutschland
- Entwicklungen im internationalen Vergleich
- Polyfunktionalität und Zukunftschancen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und gesellschaftspolitische Bedeutung des Dritten Sektors, insbesondere in Deutschland, und bietet einen Vergleich mit internationalen Entwicklungen. Sie beleuchtet die Polyfunktionalität des Sektors und skizziert Zukunftschancen und Potenziale. Der Fokus liegt auf der Analyse der Struktur und des Stellenwerts dieses Wirtschaftsbereichs „zwischen Markt und Staat“.
- Definition und Abgrenzung des Dritten Sektors
- Entwicklung des Dritten Sektors in Deutschland
- Internationaler Vergleich der Entwicklung
- Polyfunktionalität des Dritten Sektors
- Zukunftschancen und Potenziale des Dritten Sektors
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Arbeit untersucht den Dritten Sektor, seine Entstehung, seine Komponenten und seine soziale Verortung, mit einem Schwerpunkt auf der Entwicklung und gesellschaftspolitischen Bedeutung in Deutschland und einem internationalen Vergleich. Sie beleuchtet die Polyfunktionalität des Sektors und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und Potenziale. Der zunehmende Vertrauensverlust gegenüber staatlichen Aktivitäten und der Wertewandel tragen zum wachsenden Interesse am Nonprofit-Sektor bei.
Der Dritte Sektor - Versuch einer Definition: Der Dritte Sektor, auch Nonprofit-Sektor genannt, wird als Bereich zwischen Markt, Staat und Gemeinschaft definiert, in dem keiner dieser Mechanismen eindeutig vorherrscht. Er umfasst diverse Organisationen wie Krankenhäuser, Universitäten, Vereine etc., die sich durch institutionellen Aufbau, private Organisation, Nicht-Gewinnorientierung, Freiwilligkeit und teilweise ehrenamtliches Engagement auszeichnen. Der Begriff wird von anderen Begriffen wie „gemeinnütziger“ oder „freiwilliger“ Sektor abgegrenzt und darf nicht mit dem tertiären Sektor verwechselt werden. Die Abgrenzung zu Markt und Staat erfolgt über den "Zwang der Nichtverteilung" und die Freiwilligkeit der Mitgliedschaft. Die Organisationen des Dritten Sektors agieren als Vermittler zwischen Individuum und Gesellschaft, basierend auf Solidarität und gemeinsamen Werten.
Entwicklung und Struktur des Dritten Sektors: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des Dritten Sektors, sowohl national in Deutschland als auch international im Vergleich. Es untersucht die strukturellen Veränderungen und die sich daraus ergebenden Herausforderungen und Chancen für den Nonprofit-Sektor. Der Abschnitt beleuchtet die unterschiedlichen Organisationsformen, die finanzielle Ausstattung und die Rolle von Freiwilligenarbeit. Der Vergleich mit internationalen Entwicklungen zeigt Ähnlichkeiten und Unterschiede im Wachstum und der gesellschaftlichen Bedeutung des Sektors.
Schlüsselwörter
Dritter Sektor, Nonprofit-Sektor, gemeinnützig, Freiwilligenarbeit, Zivilgesellschaft, Deutschland, internationaler Vergleich, Polyfunktionalität, Nondistribution constraint, Wertewandel, gesellschaftspolitische Bedeutung, Zukunftschancen.
FAQ: Entwicklung und gesellschaftspolitische Bedeutung des Dritten Sektors
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und gesellschaftspolitische Bedeutung des Dritten Sektors, insbesondere in Deutschland, im Vergleich mit internationalen Entwicklungen. Sie beleuchtet die Polyfunktionalität des Sektors und skizziert Zukunftschancen und Potenziale. Der Fokus liegt auf der Analyse der Struktur und des Stellenwerts dieses Wirtschaftsbereichs „zwischen Markt und Staat“.
Wie wird der Dritte Sektor definiert?
Der Dritte Sektor, auch Nonprofit-Sektor genannt, wird als Bereich zwischen Markt, Staat und Gemeinschaft definiert, in dem keiner dieser Mechanismen eindeutig vorherrscht. Er umfasst diverse Organisationen (Krankenhäuser, Universitäten, Vereine etc.), die sich durch institutionellen Aufbau, private Organisation, Nicht-Gewinnorientierung, Freiwilligkeit und teilweise ehrenamtliches Engagement auszeichnen. Der Begriff wird von anderen Begriffen abgegrenzt und darf nicht mit dem tertiären Sektor verwechselt werden. Die Abgrenzung zu Markt und Staat erfolgt über den "Zwang der Nichtverteilung" und die Freiwilligkeit der Mitgliedschaft.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung des Dritten Sektors, seine Entwicklung in Deutschland und im internationalen Vergleich, seine Polyfunktionalität sowie seine Zukunftschancen und Potenziale. Sie analysiert die Struktur und den Stellenwert des Sektors und untersucht die Rolle von Freiwilligenarbeit und die finanzielle Ausstattung der Organisationen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einführung, ein Kapitel zur Definition des Dritten Sektors, ein Kapitel zur Entwicklung und Struktur des Sektors (mit nationalem und internationalem Vergleich), ein Kapitel zur Polyfunktionalität und Zukunftschancen sowie eine Zusammenfassung. Jedes Kapitel bietet detaillierte Informationen zu den jeweiligen Aspekten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Dritter Sektor, Nonprofit-Sektor, gemeinnützig, Freiwilligenarbeit, Zivilgesellschaft, Deutschland, internationaler Vergleich, Polyfunktionalität, Nondistribution constraint, Wertewandel, gesellschaftspolitische Bedeutung, Zukunftschancen.
Welche Rolle spielt der Wertewandel im Kontext des Dritten Sektors?
Der zunehmende Vertrauensverlust gegenüber staatlichen Aktivitäten und der Wertewandel tragen zum wachsenden Interesse am Nonprofit-Sektor bei. Dies spiegelt sich in der zunehmenden Bedeutung und dem Wachstum des Sektors wider.
Wie wird der internationale Vergleich in der Arbeit behandelt?
Der internationale Vergleich beleuchtet Ähnlichkeiten und Unterschiede im Wachstum und der gesellschaftlichen Bedeutung des Dritten Sektors in verschiedenen Ländern. Er dient dazu, die Entwicklung in Deutschland in einen breiteren Kontext einzuordnen und best-practice Beispiele aufzuzeigen.
Welche Zukunftschancen werden für den Dritten Sektor beschrieben?
Die Arbeit skizziert Zukunftschancen und Potenziale des Dritten Sektors, die sich aus seiner Polyfunktionalität und seiner gesellschaftlichen Rolle ergeben. Diese Chancen hängen eng mit den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen und dem Wertewandel zusammen.
- Quote paper
- Peter Heilek (Author), 2006, Die Entwicklung des Dritten Sektors, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130558