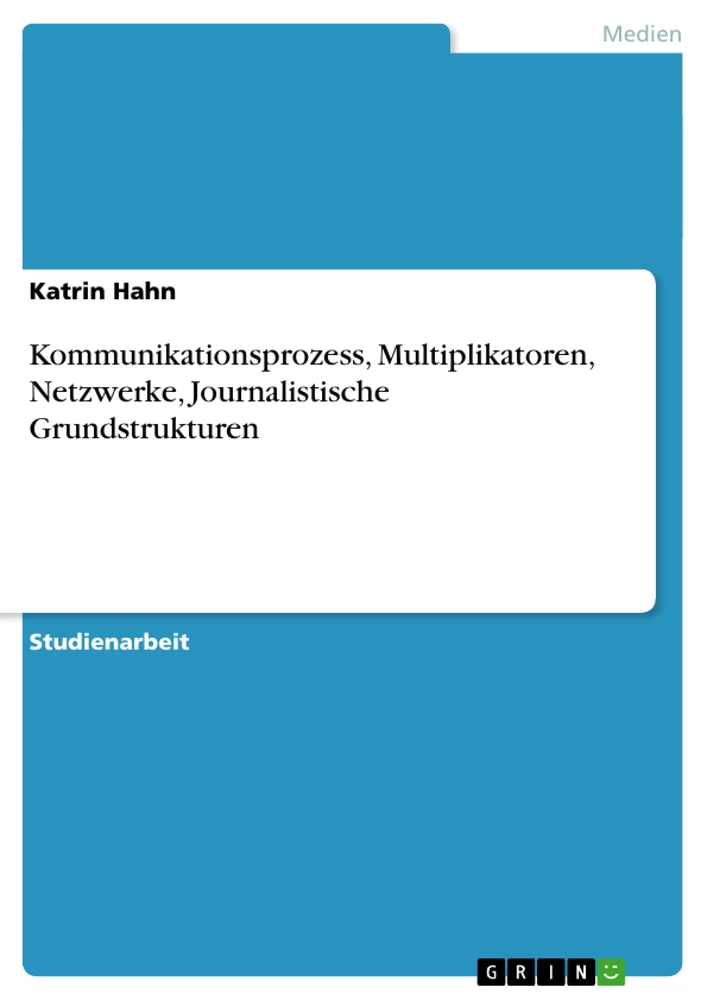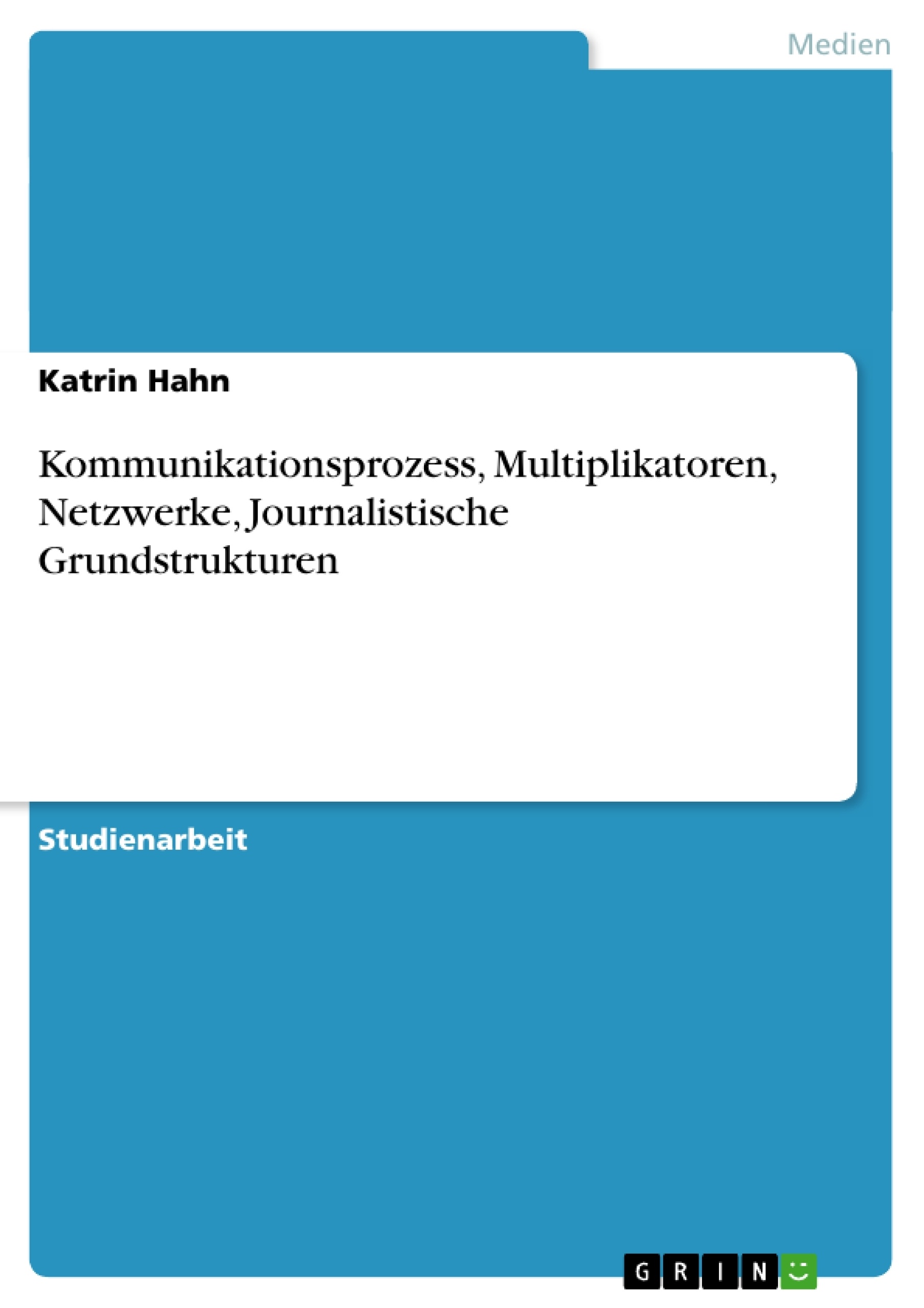[...] Bei diesem abgebildeten Ablauf ist es wichtig, Schritt für Schritt vorzugehen und somit nach
und nach jede Phase auszuarbeiten. Zuerst gilt es, das Informationsangebot zu schaffen. Dabei
geht es um die Aufgabe, die wesentlichen Informationen zu sammeln: Worum geht es im
Wesentlichen? Was ist das Besondere (dies ist wichtig für den Rezipienten)? Wie sieht die
Kostenkalkulation aus (danach richtet sich, wer angesprochen wird)? Mit welchen
Nachrichten lässt sich das Ganze beleben (z. B. spezielle Events)? Diese
Informationssammlung ist der Grundstock für die weiteren Schritte, bei der die Rezipienten
die zentrale Rolle spielen - zunächst die Phase der Wahrnehmung. Hier ist zuerst einmal die Zielgruppe zu definieren. Dies kann bei einem Produkt der Kunde sein, bei einem Projekt die
Geldgeber. Dabei ist zu überlegen, wie man diese Zielgruppen erreicht, z. B. durch welche
Multiplikatoren, wie man diese Multiplikatoren anspricht, aber auch mit der Art und Weise
und nicht zuletzt mit welchen zentralen Botschaften [siehe Informationsangebot]. Die
Vorteile sollten hier aufgezeigt werden. Geschieht die und die Wahrnehmung ist erfolgt, geht
es optimaler Weise zum nächsten Schritt über - dem Verständnis. Die Zielgruppe muss nun
die Wichtigkeit der Idee verstehen und im nächsten Schritt dieser zustimmen. Die Idee wurde
also inzwischen vom Sender vorgestellt und vom Empfänger wahrgenommen, verstanden und
zugestimmt. Dies reicht aber nicht aus, denn bisher ist keine aktive Reaktion erfolgt.
Deswegen sollte es nun idealerweise zur Verhaltensanpassung kommen. Der Idee wird nicht
nur zugestimmt, sie wird nun auch aktiv unterstützt. Dies kann z. B. der Kauf eines Produktes
sein oder das in Aussicht stellen einer Finanzierung. Einige Projekte und Produkte erreichen
bei vielen Rezipienten nur diese Phase. Optimiert läuft der Prozess jedoch, wenn es zur
Reaktivierung der Information durch eigenes Engagement kommt. D. h. der Empfänger
engagiert sich aktiv für die Idee. Dies kann durch Finanzierung erfolgen, durch Fanaktivitäten
oder durch andere Förderung für das Produkt/ das Projekt. In dieser letzten Phase agiert der
Rezipient dann u. U. sogar als Multiplikator. Voraussetzung zum Erreichen dieser Stufe ist
allerdings die Image- und Lifestyletauglichkeit der Idee. Ein Auto vermittelt dies sicher mehr
als ein Standardlebensmittel, ebenso vermutlich soziale oder kulturelle Projekte.
Zu erwähnen ist, dass dieser gesamte Ablauf ein investiver Vorgang ist.
Inhaltsverzeichnis
- Thematische Fragen
- Beschreiben Sie Ablauf und Zielsetzung eines positiven Kommunikationsprozesses!
- Wie steuern bzw. beeinflussen Sie einen negativen Kommunikationsprozess?
- Beschreiben Sie den Unterschied zwischen Zielgruppen und Multiplikatoren?
- Welche Multiplikationsformen gibt es?
- Beschreiben Sie das dialektische Prinzip der Kommunikationssteuerung!
- Wie werden Netzwerke gebildet und genutzt?
- Benennen Sie die Grundformen des „Journalistischen Handwerks“ und beschreiben Sie die wesentlichen Grundstrukturen!
- Informierende Texte
- Meldung
- Bericht
- Reportage
- Portrait
- Interview
- Meinungstexte
- Kommentar
- Glosse
- Was ist der literarische Aspekt der Reportage?
- Nennen und beschreiben Sie die verschiedenen Formen einer Talkshow!
- Welche Zielsetzung haben die „Riga Reportagen“?
- Literaturverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Kommunikationsprozess und seinen verschiedenen Facetten, insbesondere im journalistischen Kontext. Sie analysiert die Struktur und die Zielsetzung eines positiven und negativen Kommunikationsprozesses, beleuchtet die Rolle von Multiplikatoren und Netzwerken und untersucht die Grundformen des journalistischen Handwerks.
- Kommunikationsprozess: Analyse von positiven und negativen Kommunikationsabläufen
- Multiplikatoren und Netzwerke: Bedeutung und Funktionsweise im Kommunikationsprozess
- Journalistische Grundstrukturen: Beschreibung der verschiedenen Formen des journalistischen Handwerks
- Informierende und meinungsbildende Texte: Analyse der verschiedenen Textformen und ihrer Zielsetzung
- Riga Reportagen: Analyse der Zielsetzung und des Konzepts
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Hausarbeit widmet sich dem Kommunikationsprozess und seinen verschiedenen Phasen. Es werden die Schritte eines positiven Kommunikationsprozesses von der Informationsbereitstellung bis zur Reaktivierung der Information durch eigenes Engagement detailliert beschrieben. Anschließend wird der negative Kommunikationsprozess analysiert und die Möglichkeiten zur Steuerung und Beeinflussung dieses Prozesses beleuchtet. Die Kapitel 1.3 und 1.4 befassen sich mit dem Unterschied zwischen Zielgruppen und Multiplikatoren sowie den verschiedenen Multiplikationsformen. Das dialektische Prinzip der Kommunikationssteuerung wird im Kapitel 1.5 erläutert, während Kapitel 1.6 die Bildung und Nutzung von Netzwerken im Kommunikationsprozess beleuchtet. Abschließend werden im Kapitel 1.7 die Grundformen des journalistischen Handwerks und ihre wesentlichen Grundstrukturen beschrieben.
Das zweite Kapitel der Hausarbeit befasst sich mit informierenden Texten. Es werden die verschiedenen Formen des journalistischen Handwerks, wie Meldung, Bericht, Reportage, Portrait und Interview, vorgestellt und ihre spezifischen Merkmale und Zielsetzungen erläutert.
Das dritte Kapitel der Hausarbeit widmet sich meinungsbildenden Texten. Es werden die Formen Kommentar und Glosse analysiert und ihre Funktionen im journalistischen Kontext beleuchtet. Darüber hinaus wird der literarische Aspekt der Reportage untersucht und die verschiedenen Formen einer Talkshow vorgestellt. Abschließend werden die Zielsetzung und das Konzept der „Riga Reportagen“ analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Kommunikationsprozess, Multiplikatoren, Netzwerke, journalistische Grundstrukturen, informierende Texte, meinungsbildende Texte, Meldung, Bericht, Reportage, Portrait, Interview, Kommentar, Glosse, Talkshow und Riga Reportagen.
- Quote paper
- Katrin Hahn (Author), 2005, Kommunikationsprozess, Multiplikatoren, Netzwerke, Journalistische Grundstrukturen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130375