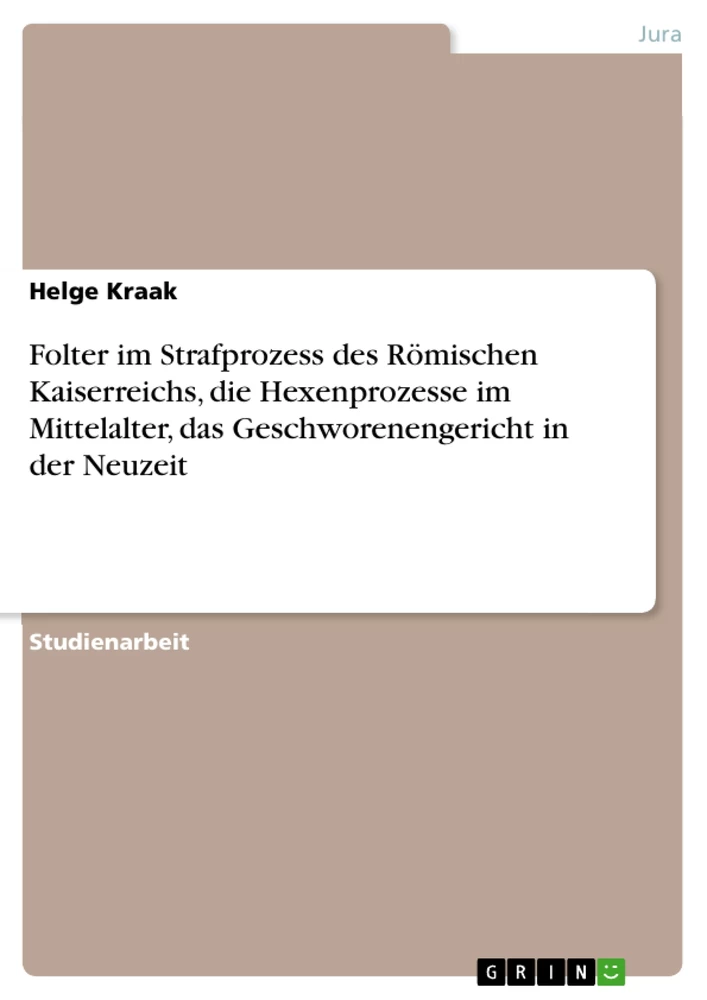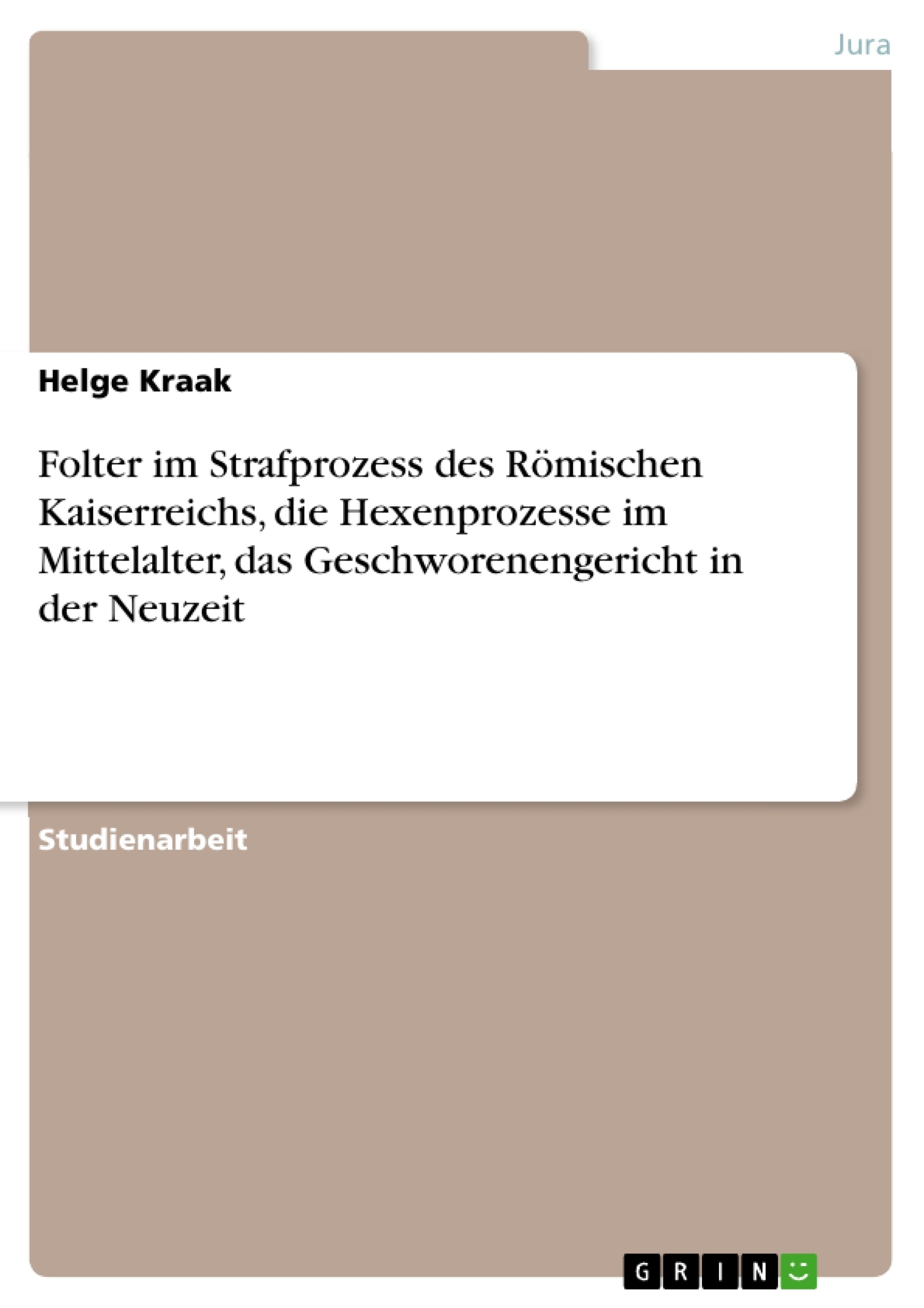Die Bezeichnung „Corpus Iuris Civilis“ wurde das erste Mal von Gothofredus d. Ä. für die Gesamtausgabe der Gesetzgebung Justinians 1583 verwendet. Der oströmische Kaiser Justinian setzte von 528 – 534 mehrere Komissionen ein, die neben dem Codex Justinian, den Institutionen und Novellen auch die Digesten (bzw. Pandekten), bestehend aus 50 Büchern, als zukünftig allein verbindliche Vorschriften für die damalige Zeit abfassten.
Inhaltsverzeichnis
- A. Folter im Strafprozess zum Ende des Römischen Reichs.
- I. Zur Herkunft des Corpus Iuris Civilis
- II. Quelle 1, Interpretation und Analyse
- B. Die Hexenprozesse im Mittelalter
- I. Mittelalterliche Lehren
- 1.) Die Ursprünge des Glaubens an Magie
- 2.) Der Teufelspakt in der kirchlichen Lehre des Mittelalters
- II. Kritiker der Teufelspakttheorien
- 1.) Die Kritik Balthasar Bekkers
- 2.) Christian Thomasius
- a) Einschub zu seiner Person
- b) Thomasius Kritik
- 3.) Ergänzungen von Friedrich Hoffmann
- III. Der Inquisitionsprozess
- 1.) Historische Entwicklung der Prozessprinzipien
- 2.) Die juristische Legitimation der Bestrafung
- 3.) Quelle 2, Interpretation und Analyse
- 4.) Das Torturprotokoll mit Blick auf die These des Thomasius
- 5.) Folter im Mittelalterlichen und im Römischen Strafprozess
- C. Das Geschworenengericht in der Neuzeit
- I. Die Entwicklung des Geschworenengerichts
- II. Quelle 3, Interpretation und Analyse
- III. Wahrheitsbegriff im Inquisitionsprozess im Vergleich zum Geschworenengericht
- D. Fazit
- I. Epochale Entwicklungen bei den Strafprozessprinzipien
- II. Die Besonderheiten des Wahrheitsbegriff im Laufe der verschiedenen Epochen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Entwicklung von Strafprozessprinzipien anhand ausgewählter Quellen aus verschiedenen Epochen. Ziel ist es, den Wandel des Wahrheitsbegriffs im Strafrecht und die damit verbundenen Veränderungen der Prozessführung zu beleuchten.
- Folter im römischen und mittelalterlichen Strafprozess
- Die Hexenprozesse und die Kritik an der Teufelspakttheorie
- Die Entwicklung des Geschworenengerichts
- Der Wandel des Wahrheitsbegriffs im Strafrecht
- Vergleichende Analyse der Quellen und ihrer historischen Einordnung
Zusammenfassung der Kapitel
A. Folter im Strafprozess zum Ende des Römischen Reichs: Dieses Kapitel analysiert Quelle 1, ein Reskript des Kaisers Hadrian, welches die Anwendung der Folter an Sklaven reglementiert. Die Exegese beleuchtet die Bedingungen, unter denen Folter eingesetzt werden durfte, und setzt dies in den Kontext des römischen Strafprozesses. Die Analyse untersucht die Grenzen der Folteranwendung und die implizite Anerkennung von Indizienbeweisen neben dem Geständnis. Die Herkunft des Corpus Iuris Civilis wird kurz skizziert, um den Kontext der Quelle zu verdeutlichen.
B. Die Hexenprozesse im Mittelalter: Dieses Kapitel befasst sich mit den Hexenprozessen des Mittelalters und untersucht die mittelalterlichen Lehren über Magie und den Teufelspakt. Es analysiert die Kritik an diesen Theorien durch Balthasar Bekker, Christian Thomasius (einschließlich einer kurzen Biografie und Detaillierung seiner Kritik) und Friedrich Hoffmann. Eine detaillierte Exegese von Quelle 2, einem Torturprotokoll, verdeutlicht die Brutalität der Inquisitionsprozesse. Der Vergleich des Torturprotokolls mit der These des Thomasius hebt den fundamentalen Unterschied in der Betrachtung des Delikt der Hexerei hervor. Schließlich wird die Folter im mittelalterlichen Strafprozess mit der des römischen Reichs verglichen.
C. Das Geschworenengericht in der Neuzeit: Das Kapitel analysiert die Entwicklung des Geschworenengerichts und exegetisch Quelle 3, einen Bericht des Gesetzgebungsausschusses der Nationalversammlung. Die Analyse konzentriert sich auf den Wahrheitsbegriff im Geschworenengericht und vergleicht diesen mit dem Wahrheitsbegriff im Inquisitionsprozess. Das Kapitel untersucht, wie der veränderte Wahrheitsbegriff die Prozessführung beeinflusst und die Grenzen des Geschworenengerichts beleuchtet.
Schlüsselwörter
Strafprozessgeschichte, Folter, Hexenprozesse, Inquisition, Christian Thomasius, Teufelspakt, Geschworenengericht, Wahrheitsbegriff, Römisches Recht, Mittelalter, Neuzeit, Quellenexegese, Rechtsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Entwicklung von Strafprozessprinzipien
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Entwicklung von Strafprozessprinzipien anhand ausgewählter Quellen aus verschiedenen Epochen (Römisches Reich, Mittelalter, Neuzeit). Der Fokus liegt auf dem Wandel des Wahrheitsbegriffs im Strafrecht und den damit verbundenen Veränderungen der Prozessführung.
Welche Epochen und Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt drei Hauptepochen: das Römische Reich (am Ende des Reiches), das Mittelalter (Hexenprozesse) und die Neuzeit (Geschworenengericht). Die zentralen Themen sind die Anwendung von Folter, die Hexenprozesse und die Kritik an der Teufelspakttheorie, die Entwicklung des Geschworenengerichts und der Wandel des Wahrheitsbegriffs im Strafrecht.
Welche Quellen werden analysiert?
Die Hausarbeit analysiert drei Quellen: ein Reskript des Kaisers Hadrian zur Folteranwendung an Sklaven (Quelle 1), ein Torturprotokoll aus der Zeit der Hexenprozesse (Quelle 2) und einen Bericht des Gesetzgebungsausschusses der Nationalversammlung zur Entwicklung des Geschworenengerichts (Quelle 3).
Welche Personen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt wichtige Persönlichkeiten wie Kaiser Hadrian, Balthasar Bekker, Christian Thomasius (mit ausführlicher Biografie und Analyse seiner Kritik an der Teufelspakttheorie) und Friedrich Hoffmann. Ihre Ansichten und Kritik zum Thema Folter und Hexenprozessen werden eingehend untersucht.
Wie wird der Wahrheitsbegriff behandelt?
Die Hausarbeit vergleicht den Wahrheitsbegriff im römischen Strafprozess, im Inquisitionsprozess des Mittelalters und im Prozess des Geschworenengerichts der Neuzeit. Es wird untersucht, wie sich der Wahrheitsbegriff im Laufe der Zeit verändert hat und welche Auswirkungen dies auf die Prozessführung hatte.
Welche Schlüsselkonzepte werden untersucht?
Schlüsselkonzepte umfassen Strafprozessgeschichte, Folter, Hexenprozesse, Inquisition, Teufelspakt, Geschworenengericht, Wahrheitsbegriff, Römisches Recht, Mittelalter, Neuzeit, Quellenexegese und Rechtsgeschichte.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in die Kapitel A. Folter im Strafprozess zum Ende des Römischen Reichs, B. Die Hexenprozesse im Mittelalter, C. Das Geschworenengericht in der Neuzeit und D. Fazit. Jedes Kapitel beinhaltet eine detaillierte Analyse der relevanten Quellen und eine Einordnung in den historischen Kontext.
Was ist das Fazit der Hausarbeit?
Das Fazit fasst die epochalen Entwicklungen der Strafprozessprinzipien und die Besonderheiten des Wahrheitsbegriffs in den verschiedenen Epochen zusammen. Es bietet einen Überblick über die Veränderungen und Kontinuitäten im Strafprozess über die Jahrhunderte hinweg.
- Quote paper
- Helge Kraak (Author), 2005, Folter im Strafprozess des Römischen Kaiserreichs, die Hexenprozesse im Mittelalter, das Geschworenengericht in der Neuzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130346