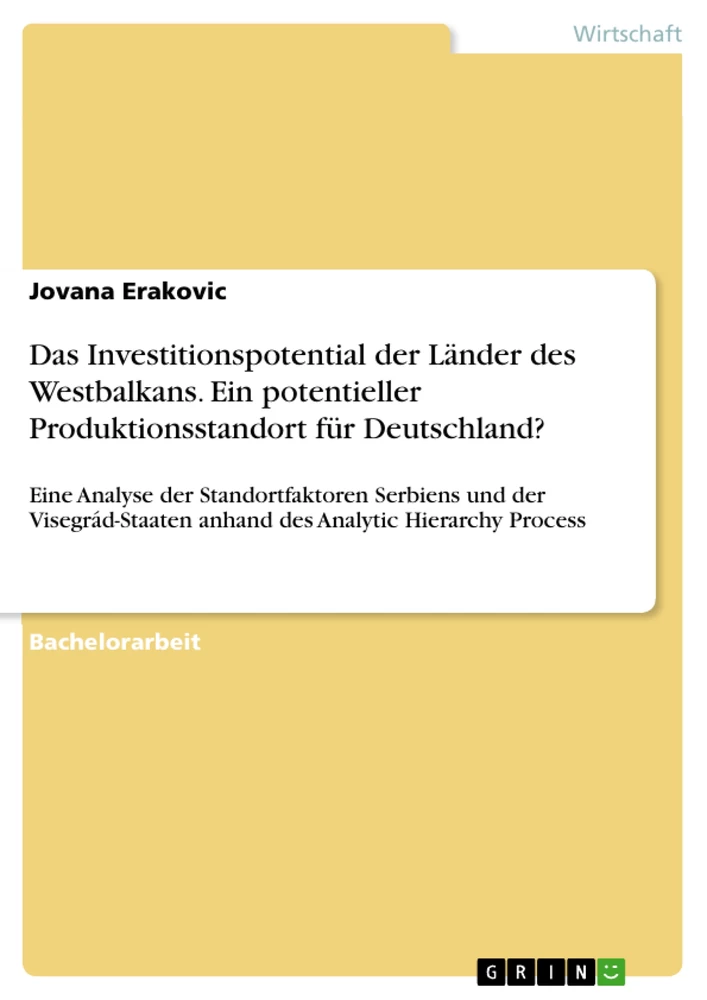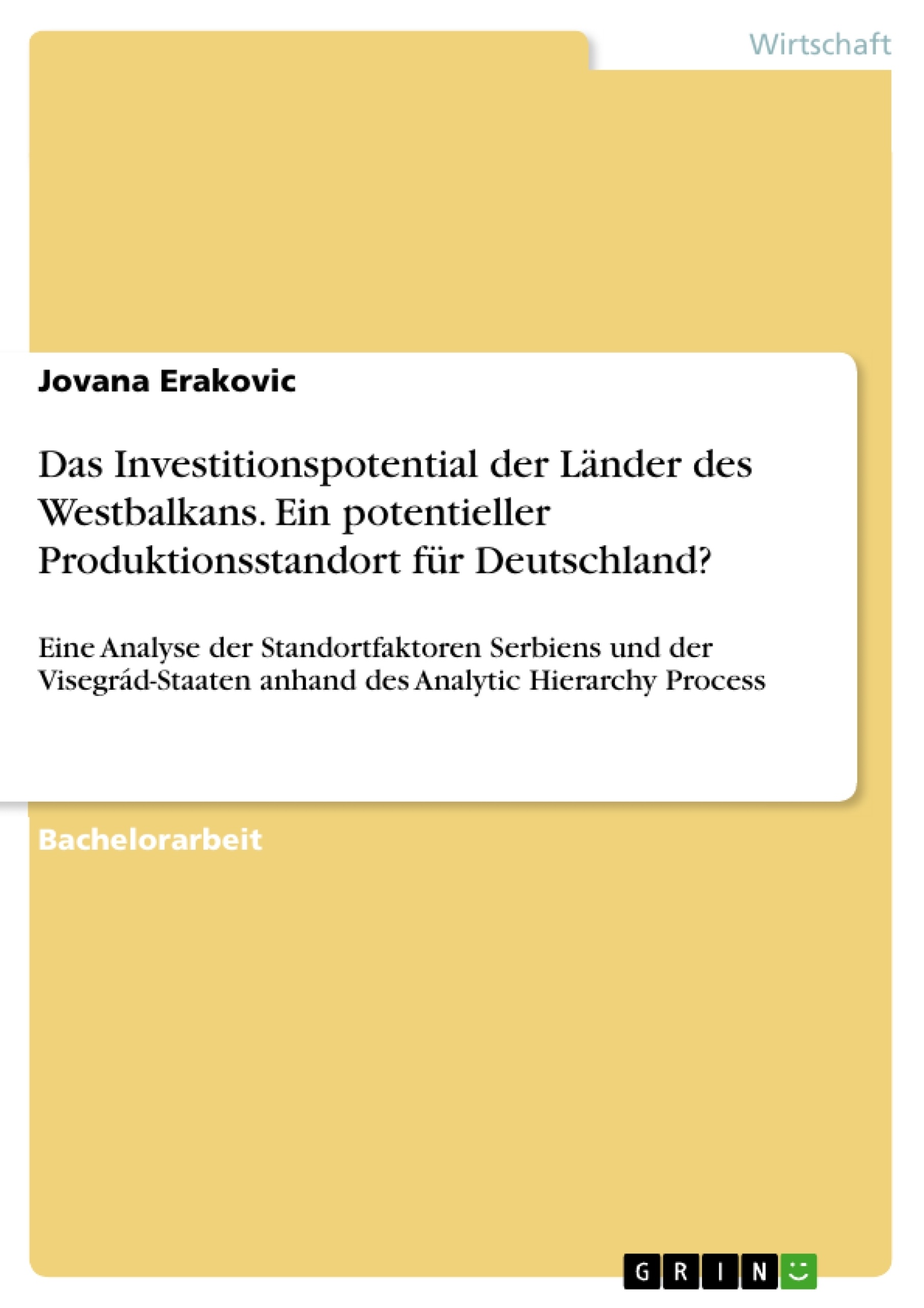Die Standortfaktoren Serbiens und der Visegrád-Staaten im Vergleich – Welches der Länder bietet das größte Investitionspotential für deutsche Produktionsunternehmen?
Hierzu werden in dieser wissenschaftlichen Arbeit zuerst im zweiten Kapitel die Gegebenheiten auf dem Westbalkan im Vergleich einiger gesamtwirtschaftlicher Indikatoren näher betrachtet und interpretiert, sodass die deutschen Investitionen räumlich weiter eingegrenzt werden können. Anschließend wird im Kapitel drei auf die Bedeutung von Standortentscheidungen für Industrieunternehmen eingegangen und Determinanten der Standortwahl werden näher erläutert. In Kapitel vier werden die Standortfaktoren der Länder des Westbalkan am Beispiel von Serbien mit denen der Visegrád-Staaten verglichen und mithilfe des Analytic Hierarchy Process des Mathematikers Thomas L. Saaty bewertet. Zur Gewichtung der Bedeutung der Standortfaktoren wird innerhalb des Analytic Hierarchy Process zuerst eine Präferenzanalyse durchgeführt und die Faktoren werden paarweise miteinander verglichen. Daraufhin werden die Präferenzen anhand einer Skala bewertet und anschließend durch ein mathematisches Modell in einer Matrix präzise gewichtet. Schließlich ergibt sich ein Punktesystem, durch welches die Rangfolge nach der Größe des Investitionspotentials gebildet wird.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Investitionspotential der WB6 – Wohin deutet der Trend?
3. Die Bedeutung von Standortentscheidungen für Industrieunternehmen
3.1 Standortfaktoren
3.2 Determinanten der internationalen Standortwahl
3.3 Erfolgskritische Standortfaktoren
4. Eine Analyse der Standortfaktoren Serbiens und der Visegrád-Staaten anhand des Analytic Hierarchy Process
4.1 Gesamtwirtschaftliche Indikatoren
4.2 Der Arbeitsmarkt der Visegrád 4 und Serbiens im Vergleich
4.3 Verschiedene Kostenarten im Überblick
4.4 Verschiedene Steuerarten im Überblick
4.5 Die geographische Lage und Verkehrsinfrastruktur
4.6 Internationale Handelsabkommen und Präferenzsysteme
4.6.1 Internationale Handelsabkommen und Präferenzsysteme Serbiens
4.6.2 Internationale Handelsabkommen und Präferenzsysteme der EU
4.6.3 Die wichtigsten deutschen Handelspartner außerhalb der EU und bestehende Handelsabkommen mit der EU und Serbien
4.7 Investitionsförderung
4.8 Sonstige Indizes
4.9 Auswertung der Analyse
5. Fazit
Anhang:
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 Welthandel vs. Welt-BIP im Zeitverlauf
Abb. 2: Der Anteil ausländischer Wertschöpfung an der inländischen Nachfrage innerhalb einer Wirtschaftsregion (2005–2016)
Abb. 3: Regionen, in die deutsche Unternehmen planen Ihre Standorte zu verlagern
Abb. 4: Die Handelsanteile geografischer Räume am deutschen Außenhandelsvolumen (2005 und 2020)
Abb. 5: Das deutsche Außenhandelsvolumen im Zeitverlauf (2005–2020) und der Anteil des Handels mit Osteuropa (2014–2020)
Abb. 6: Der Deutsche Osthandel und die Bedeutung der Visegrád-Staaten
Abb. 7: FDI-Zuflüsse in die CESEE-Volkswirtschaften in % vom BIP (2010-2019)
Abb. 8: Die Entwicklung von FAT deutscher Investoren im Westbalkan (2015–2019)
Abb. 9: Die Zufriedenheit deutscher Unternehmen im Westbalkan
Abb. 10: Die Westbalkan Six – geografische Übersicht
Abb. 11: Das reale pro Kopf-BIP der Westbalkanstaaten im Vergleich (2010–2020)
Abb. 12: Importe, Exporte und Handelsbilanzsalden zwischen der EU und den West-Balkan-Staaten (2010–2020)
Abb. 13: Deutsche Direktinvestitionen im Westbalkan (2010–2019)
Abb. 14: Die FDI-Zuflüsse der WB6 nach Herkunftsland (2010–2019)
Abb. 15: Zielbranchen ausländischer Investoren im Westbalkan (2010–2019)
Abb. 16: Die ausländischen Direktinvestitionszuflüsse in Albanien (2010–2020)
Abb. 17: Die ausländischen Direktinvestitionszuflüsse in Bosnien und Herzegowina (2010–2020)
Abb. 18: Die ausländischen Direktinvestitionszuflüsse im Kosovo (2010–2020)
Abb. 19: Die ausländischen Direktinvestitionszuflüsse in Montenegro (2010–2020)
Abb. 20: Die ausländischen Direktinvestitionszuflüsse in Nordmazedonien (2010–2020)
Abb. 21: Die ausländischen Direktinvestitionszuflüsse in Serbien (2010–2020)
Abb. 22: Die deutschen Investitionen in die WB6 im Verhältnis zur Landesgröße
Abb. 23: Die Einteilung von Standortfaktoren nach der BESTAND-Standortfaktorensystematik
Abb. 24: Die Entwicklung des realen BIP/Kopf und seiner Wachstumsraten der V4 und Serbiens (2010–2020)
Abb. 25: Die Entwicklung von FDI-Zuflüssen und -Stocks zu aktuellen Preisen (2010 – 2020)
Abb. 26: Die Top 3 Sektoren für Investitionen in der Region V4 und RS im Jahr
Abb. 27: Das Bildungsniveau im Alter von 25-54 Jahren (2020)
Abb. 28: Die Bevölkerung im Alter von 20-24 Jahren, die mindestens die Sekundarstufe II abgeschlossen hat (2020)
Abb. 29: Die Komplexität der Findung von qualifizierten Mitarbeitern (2017–2019)
Abb. 30: Die Arbeitsproduktivität der V4 und Serbiens im Vergleich anhand der EU FAT im Bereich Industrie, Baugewerbe und Dienstleistung (2019)
Abb. 31: Die Beschäftigungskosten bei Sachgütererzeugung (2020)
Abb. 32: Die B2B-Energiekosten der V4 und Serbiens (2022)
Abb. 33: Die wichtigsten europäischen Logistikkorridore der Zukunft
Abb. 34: Die Gewichtung der Standortfaktoren und das Ranking der Länder
Abb. 35: Das Ergebnis des Gesamtrankings
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Die Top 5 der größten Handelspartner im deutschen Außenhandel (2021)
Tab. 2: Das Ranking des Ease of doing business
Tab. 3: Die Transportkosten in Form von Arbeitskosten und Entfernungen der V4 und Serbiens zu den Hauptstädten der wichtigsten europäischen Handelspartnern Deutschlands
Tab. 4: Die Steuerbelastung von Unternehmen in den V4 und Serbien
Tab. 5: Die Transport- und Strukturdaten der V4 und Serbiens im Vergleich
Tab. 6: Die wichtigsten deutschen Handelspartner außerhalb der EU (2021) und bestehende Handelsabkommen mit der EU und Serbien
Tab. 7: Die Investitionsanreize für das verarbeitende Gewerbe in den V4-Staaten und Serbien im Vergleich
Tab. 8: Der Stand politischer Transformation nach dem Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung (2020)
Tab. 9: Der globale Innovationsindex 2021 – Serbien und die V4 im Vergleich
Tab. 10: Die Prioritäten Kompromisse der Standortfaktoren
Tab. 11-26: Der paarweise Vergleich der Länder je Standortfaktor
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Der weltweite Handel steht in den nächsten Jahren vor neuen strukturellen Herausforderungen, gleichzeitig steigt seine Bedeutung weiter an. Den stärksten und nachhaltigsten Trend für unternehmerisches Handeln stellt in den vergangenen 20 Jahren die Globalisierung der Weltwirtschaft dar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Welthandel vs. Welt-BIP im Zeitverlauf
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bereits seit den 90er Jahren übertrifft das Wachstum des globalen Handelsvolumens stets das globale Wirtschaftswachstum. Den Wendepunkt hierfür stellt die Finanzmarktkrise im Jahr 2009 dar, seit welcher sich die beiden Wachstumswerte entsprechen. Hierzu tragen neben dem Rückgang der Nachfrage aus China und anderen asiatischen Schwellenländern, auch entwickelte Volkswirtschaften wie Großbritannien bei. Die Staaten beginnen ihre Unternehmen nach der Krise zu schützen und tendieren zur Regionalisierung von zuvor ausgelagerter Produktion ins Inland oder in das nähere regionale und wirtschaftliche Umfeld. Auch regionale Beschaffungsmärkte gewinnen an Bedeutung.
Diesen Rückwärtstrend zur Globalisierung stellt die zunehmende Bedeutung regionaler Beschaffungsmärkte in den Fokus. Der Anteil ausländischer Wertschöpfung an der heimischen Nachfrage innerhalb einer Wirtschaftsregion nimmt in der Europäischen Union (EU), in Nordamerika und in Asien wie in Abbildung (Abb.) 2 zu sehen, seit 2012 kontinuierlich zu und bestätigt den Trend „Regionalisierung statt Globalisierung“, welcher außerdem durch die Bildung regionaler Handelsabkommen bestärkt wird. Ein positives und stabiles Konsumentenverhalten steht dem allgemeinen negativen Trend jedoch entgegen. Weitere Auslöser für den Trend sind der Druck zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit in den Lieferketten, wachsender Onlinehandel, sowie die schnellere Reaktionsmöglichkeit auf eine schwankende Kundennachfrage (Wagener, 2020, S. 30ff.).
Abb. 2: Der Anteil ausländischer Wertschöpfung an der inländischen Nachfrage innerhalb einer Wirtschaftsregion (2005–2016)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die internationalen Lieferketten befinden sich im Umbruch und viele Unternehmen wägen ab, zumindest einen Teil ihrer Produktion näher an die Absatzländer zu holen. Die Corona-Pandemie beschleunigt diese Entwicklung. Im Lockdown scheitern lange genutzte Verkehrswege und Routen und es wird deutlich, wie groß die Abhängigkeit bei der täglichen Versorgung von funktionierenden Lieferketten ist. Über Wochen kommen kaum Frachtschiffe aus Asien an, was die Unternehmen dazu zwingt, ihre Produktion herunterzufahren oder sogar einzustellen. (Dachser SE, 2020) Etwa 60 % der Unternehmen der Automobilindustrie sind laut IW-Umfrage im Juni 2020 von der Störung der internationalen Wertschöpfungs-ketten betroffen, zu Produktionsausfällen kommt es bei rund 18 %. (Bardt, 2020, S. 1f.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Regionen, in die deutsche Unternehmen planen Ihre Standorte zu verlagern
Eine Befragung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) von 3.300 Mitglieds-unternehmen der Deutschen Außenhandelskammer (AHK) ergibt, dass sich fast 40 % der Unternehmen zurzeit nach neuen sowie nähergelegenen Lieferanten umsehen. Zahlreiche Unternehmen (22 %) planen darüber hinaus eine Rückverlagerung ihrer Produktion. 27 % der Unternehmen plant, ihren Standort vor allem nach Europa zu verlagern (siehe Abb. 3).
Eines der Ergebnisse der Pandemie könnte sein, dass Unternehmen bei der Lieferanten-suche vermehrt auf Ausfallrisiken achten, um auch in Krisenzeiten ihre notwendigen Vorprodukte und Waren zu erhalten. (DIHK, 2020, S. 7f.) Der Lockdown betrifft zeitgleich mehr oder minder die ganze Welt und der Ruf nach Veränderung der globalen Warenströme wird laut. Selbst Globalisierungsverfechter rufen dazu auf, die Produktion ins Inland oder zumindest nach Europa zurückzuverlegen (Dachser SE, 2020).
Viele Unternehmen leiden deutschlandweit an akutem Fachkräftemangel. (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2021a) Während laut einer Konjunktur-umfrage der DIHK im Jahr 2010 rund 16 % der Unternehmen den Fachkräftemangel in Deutschland als größte Entwicklungshemmnis sehen, sind es im Jahr 2019 bereits 56 % der Unternehmen, wobei der Mangel heute als größtes Risiko empfunden wird. (DIHK, 2019, S. 29f.) Außerdem berichtet die Kompetenzzentrum Fachkräftesicherungs-Studie -KOFA, dass im Jahr 2018 rund 79 % aller offenen Stellen in Engpassberufen ausgeschrieben wurden. Im Jahr 2011 waren dies noch 43 %. (KOFA, 2019, S. 9) Der Fachkräftemangel ist jedoch nicht flächendeckend, sondern konzentriert sich vielmehr auf einige Berufe insbesondere in der Metall- und Elektroindustrie, dem Handwerk und dem MINT-Bereich. Aufgrund dieser unter anderem durch den demografischen Wandel hervorgerufenen Entwicklungen, macht eine Produktionsrückverlagerung nach Deutschland nicht in allen Branchen Sinn (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2021a).
Die Abb. 4 stellt die Handelsanteile geografischer Räume am deutschen Handelsvolumen in den Jahren 2005 und 2020 dar. Es ist zu erkennen, dass die asiatischen Länder den größten Handelsanteil auf sich vereinen. Gefolgt werden diese jedoch von den Ländern Europas, außerhalb der EU, die mit ca. 20 % einen bedeutenden Anteil auf sich vereinen können und somit von großer Relevanz für den deutschen Außenhandel sind (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2021b, S. 8).
Abb. 4: Die Handelsanteile geografischer Räume am deutschen Außenhandels- volumen (2005 und 2020)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Das deutsche Außenhandelsvolumen im Zeitverlauf (2005–2020) und der Anteil des Handels mit Osteuropa (2014–2020)
Die 29 Partnerländer1 des Ostausschusses in Mittel- und Osteuropa sowie Zentralasien erwirtschaften in Zusammenarbeit mit Deutschland, wie auf Abb. 5 zu sehen, im Jahr 2017 ein Handelsvolumen von 426 Mrd. €, was in etwa 20 % des deutschen Außenhandels ausmacht. Im Jahr 2020 beträgt dieser Wert nur noch ca. 424 Mrd. € und macht weiterhin fast 20 % des deutschen Außenhandels aus (Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft, 2014-2020). Insgesamt entwickelt sich der Außenhandel über die Jahre positiv und nimmt lediglich während der Corona-Pandemie leicht ab. Das Außenhandelssaldo Deutschlands, mit dieser Ländergruppe ist ebenfalls positiv und beträgt ca. 6,9 Mrd. €. Somit exportiert Deutschland mehr in diese Länder als importiert wird, was auf die Relevanz der Länder vor allem als Absatzmarkt aber auch als Beschaffungsmarkt hinweist (Eigene Berechnung; DESTATIS, 2022, S. 2ff.).
Tabelle 1: Die Top 5 der größten Handelspartner im deutschen Außenhandel (2021)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Tabelle (Tab.) 1 verweist auf die hohe Bedeutung der Visegrád-Staaten (V4) für den deutschen Außenhandel. Diese vereinen zusammen den größten Anteil am deutschen Außenhandel und lassen China, die Niederlande, die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und Frankreich deutlich hinter sich (DESTATIS, 2022, S. 1ff.). Die Visegrád-Region (V4) umfasst vier Länder Mitteleuropas, nämlich Polen (PL), die Slowakei (SK), Tschechien (CZ) und Ungarn (HU). Alle vier Länder strebten in der Vergangenheit eine Mitgliedschaft in der EU an und betrachten ihre Integration in die EU als einen weiteren Schritt zur Über-windung künstlicher Trennlinien in Europa durch gegenseitige Unterstützung. Im Jahr 2004 erreichten sie dieses Ziel, werden alle zu EU-Mitgliedern und zielen auf eine optimale Zusammenarbeit mit allen Ländern, insbesondere den Nachbarländern ab (International Visegrad Fund, 2021, S. 1f.).
Die Warenströme zwischen Deutschland und den V4-Ländern steigen seit deren Beitritt zur EU im Jahr 2004 erheblich. Daten des deutschen Bundesamtes für Statistik zeigen, dass sich das Außenhandelsvolumen mit PL seit 2004 mehr als verdoppelt, von 34,7 Mrd. € auf 75,7 Mrd. €. Mit CZ werden im Jahr 2012 Waren im Wert von 64,7 Mrd. € ausgetauscht, gegenüber 34,8 Mrd. € im Jahr 2004. Der Anstieg des Handelsvolumens fällt für HU und die SK nicht ganz so groß aus. Doch seit Deutschland beginnt intensive Wirtschafts-beziehungen mit den mittel- und osteuropäischen Ländern (MOEL) aufzubauen, trägt die europäische Erweiterung nicht zu grundlegenden Veränderungen, sondern eher zur Fort-führung und Vertiefung bestehender Beziehungen bei (Gawrich & Stepanov, 2014, S. 9).
„Die Volkswirtschaften Osteuropas sind längst mehr als verlängerte Werkbänke: Ihr Wachstum liegt klar über dem im Westen – und so wird es bleiben.“ (Brüggmann & Münchrath, 2021)
Die Länder Osteuropas sind höchst heterogen, wobei einige bereits Mitglieder der EU sind und sich ihren Standards entsprechend positiv entwickeln. Andere nähern sich der EU wirtschaftspolitisch erst an, während wiederandere versuchen, ihre Rolle in der Region neu zu definieren und sich von Zentraleuropa zu entfernen. Viele dieser Länder haben sehr gute Beziehungen zu Deutschland und sind langjährige Partner, während andere sich in der Phase der Öffnung befinden und sich als neue Investitionsziele und Partner anbieten. Gemeinsam haben diese Länder, dass ihre Märkte wachsen, zum Teil seit Jahren auf hohem Niveau, zuletzt aufgrund hausgemachter oder politischer Krisen auch eher schwach. (Bessler, 2018, S. 3, 6ff.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6: Der Deutsche Osthandel und die Bedeutung der Visegrád-Staaten 2
Das Diagramm 6 zeigt den Warenverkehr zwischen Deutschland und den V4-Staaten sowie zwischen Deutschland und Osteuropa insgesamt mit Fokus auf deren Veränderungen in % innerhalb des Zeitraums 2013-2021. Es ist zu erkennen, dass der Handel zwischen Deutschland und den V4-Staaten wie auch mit Osteuropa insgesamt, über diesen Zeitverlauf bis zum Beginn der Corona Pandemie im Jahre 2019 stetig zunimmt und einen positiven Wachs-tumstrend verfolgt. Die Kurven verlaufen dabei ähnlich volatil. Im Jahr 2019 nimmt der Handel mit den Visegrád-Staaten einen Anteil von rund 67 % ein. Auf der sekundär vertikalen Achse sind die Veränderungen des Volumens an Warenverkehr in % abgebildet. Diese lassen erkennen, dass die Wachstumsraten des Warenverkehrs zwischen Deutschland und den V4 zu Beginn des Betrachtungszeitraumes deutlich höher ausfallen und der Warenverkehr um bis zu knapp 15 % jährlich zunimmt. Ab 2014 ist jedoch eine Abnahme der Wachstumsraten zu erkennen, sie fallen dabei lediglich im Jahr 2019 negativ aus. Der Warenverkehr mit Ost-europa insgesamt ist ab dem Jahr 2016 von abnehmenden Wachstumsraten geprägt und fällt ebenfalls im Jahr 2019 negativ aus. Der Warenverkehr mit beiden Ländergruppen nimmt jedoch im nächsten Jahr wieder zu, mit den V4-Staaten um 17 % und Osteuropa insgesamt um 19 %. (Ost- Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, 2012 – 2021, S. 1ff.)
Die Region bietet im Gegensatz zu Zentraleuropa günstige Produktionskosten, eine strategisch günstige Lage zwischen Ost und West und vor allem zukünftige Absatzmärkte. Eine niedrige Inflation, niedrige Zinsen, hohe Kapazitätsauslastungen sowie ein Anstieg in der Exportquote treiben das Wachstum voran. Die Region befindet sich im stetigen Wandel und viele der Länder steigen in der globalen Wertschöpfungskette durch die Produktion höherwertiger Güter, was mehr und mehr Innovationen von Ost nach West kommen lässt. Die Wettbewerbsfähigkeit wird trotz stark steigenden Lohnerhöhungen durch deutliche Steigerungen in der Arbeitsproduktivität aufrechterhalten. Zudem profitieren die mitteleuropäischen EU-Länder sowie die EU-Beitrittskandidaten auf dem Westbalkan von Strukturfonds oder Vorbeitrittshilfen sowie der Verstärkung regionaler Zusammenarbeit, wie im Rahmen der eurasischen Wirtschaftsunion und den Verhandlungen des Berlin-Prozesses über einen gemeinsamen Markt der Westbalkanstaaten. Ausländische Investoren fordern jedoch vor allem das Beseitigen postsowjetischer Altlasten, die sich noch im Ausbau befindende Infrastruktur und unterschiedliche Geschäftskulturen (Bessler, 2018, S. 3, 6ff.). Der deutsche Mittelstand, exportstark und international aufgestellt, investiert jedoch weiter und die Zahl deutscher Unternehmen vor Ort wächst in den vergangenen Jahren gleichermaßen wie das deutsche Handelsvolumen (Deutsche Bundesbank, 2020, S. 5ff.).
Abb. 7: FDI-Zuflüsse in die CESEE-Volkswirtschaften in % vom BIP (2010-2019)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bei der Betrachtung der durchschnittlichen Zuflüsse an ausländischen Direktinvestitionen (FDI) im Verhältnis zum BIP in Abb. 7 sticht vor allem eine Region heraus, der Westbalkan (WB). Hier beläuft sich der Anteil an Investitionen innerhalb des Betrachtungszeitraums zwischen 2010 bis 2019 im Durchschnitt auf 6,1 % des BIP, welcher im Vergleich zu den anderen Ländern in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (CESEE), die im Durchschnitt 2,6 % des BIP an FDI erhalten, deutlich höher ausfällt. Den Spitzenreiter bildet Montenegro (ME) mit einem Durchschnitt von 11,8 % des BIP, gefolgt von Albanien (AL) mit 8,4 %, Serbien (RS) mit 6 % sowie dem Kosovo (XK) und Nordmazedonien (MK) auf Platz 5 und 7 mit 5 % des BIP im XK und 3,1 % in MK. Insgesamt finden sich fünf der Länder unter den Top 7 in der gesamten CESEE-Region. Lediglich Bosnien und Herzegowina (BA) befindet sich in der unteren Hälfte der Region mit 2,4 % auf Platz 16 (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, 2021, S. 16).
Die aufgeführten Entwicklungen geben Anlass dazu, die derzeitigen EU-Beitrittskandidaten des Westbalkans näher zu betrachten. Die regionale Kooperation dieser Länder wird unter anderem im Rahmen des Berlin- Prozesses angekurbelt. Zu dieser Ländergruppe gehören Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Der gemeinsame Wirtschaftsraum verfolgt das Ziel, die Volkswirtschaften dieser Länder zu verbinden und freien Waren-, Dienstleistungs-, Personen- und Kapitalverkehr einzuführen. Mit einem Aktionsplan bis 2024 verpflichten sich die Länder zu Maßnahmen in den Bereichen Mobilität, Klima, Energie, nachhaltige Landwirtschaft, Biodiversität und Nahrungsmittelproduktion (Quiring, 2021, S. 40f.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 8: Die Entwicklung von FAT deutscher Investoren im Westbalkan (2015-2019) 3
Auch die deutschen Investitionen auf dem Westbalkan wachsen stetig, wie auf Abb. 8 zu sehen ist. Sie verdoppeln sich nahezu im Betrachtungszeitraum von 2015 bis 2019 und nehmen um knapp 94 % zu. Ebenso entwickelt sich die Anzahl an Unternehmen und Beschäftigten kontinuierlich und wächst im selben Zeitraum um 21 % bei den Unternehmen und um 48 % bei den Beschäftigten, was unter anderem auf eine Zunahme der Arbeitsproduktivität deutet (Deutsche Bundesbank, 2020, 2021b, S. 5ff.).
In einer Umfrage der Kammerpartnerschaft Westbalkan in Zusammenarbeit mit der Delegation der deutschen Wirtschaft in BA sowie MK, der Deutsch-Serbischen Industrie- und Handelskammer und German Trade and Invest im Winter 2020 wurden deutsche Unternehmen zu ihren Unternehmen allgemein, zu ihren Investitionen und zu der Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen in den WB-Staaten befragt (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, 2021, S. 56).
Abb. 9: Die Zufriedenheit deutscher Unternehmen im Westbalkan
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
62 % der Unternehmen geben, wie in Abb. 9 zu erkennen ist, an zufrieden oder sehr zufrieden mit ihren Arbeitserfahrungen auf dem Westbalkan zu sein. Während weitere 18 % neutral gestimmt sind, geben 19 % an unzufrieden oder sehr unzufrieden zu sein (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, 2021, S. 57).
Die Überwindung der Corona-Pandemie führt nicht zum Verschwinden oder einer Abnahme an Herausforderungen der deutschen und europäischen Wirtschaft. „Business as usual“ wird es nach der Pandemie nicht mehr geben. Der weltweite Trend sich abzukapseln und auf nationale Lösungen zu setzen wird verstärkt. Multinationale Kooperationen werden an Bedeutung verlieren und die Weltwirtschaft künftig wieder stärker durch Autarkie-bestrebungen und Protektionismus bestimmt.
Das Erfolgsmodell der EU und vor allem Deutschlands, basiert jedoch auf barrierefreier Globalisierung. Die Aufspaltung der Weltwirtschaft in auseinanderdriftende Kontinentalplatten durch die globale Machtkonkurrenz zwischen den USA und China stellt eine existentielle Gefahr dar. Deutsche und europäische Unternehmen geraten vermehrt zwischen die Fronten dieser geopolitischen Auseinandersetzungen. Deutschland und Europa sollten die neue globale Wirtschaftsordnung mitgestalten, ihr Gewicht gegen die ökonomische Dominanz Chinas und der USA legen, sich neu aufstellen und Defizite beseitigen. De facto bilden weder China noch die USA nach Handelsvolumina den wichtigsten Wirtschaftsraum für Deutschland. Vielmehr sind es die 29 Partnerländer des Ostausschusses in Osteuropa und Zentralasien (Hermes, 2021, S. 6f.).
Die COVID 19-Pandemie schafft weltweit eine neue Realität. Diese neue Realität bringt Chancen mit sich, welche die Volkswirtschaften Mittel- und Osteuropas nutzen könnten. Eine tendenziell widerstandsfähigere Wirtschaft sowie Produktionsnetzwerke werden aus der Pandemie hervorgehen. Verändern sich die Länder so, wie sich die Welt verändert, können diese ebenfalls gestärkt hervorgehen (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, 2021, S. 5f.).
Der aktuelle und weltweite Trend zur Regionalisierung weist auf eine mögliche Verlagerung von Investitionsbeständen hin und grenzt neue deutsche Investitionen räumlich weiter ein. Abb. 2 zeigt, dass die ausländische Wertschöpfung an der inländischen Nachfrage, innerhalb einer Wirtschaftsregion, kontinuierlich zunimmt und deutsche Unternehmen (wie in Abb. 3 zu sehen) planen ihre Produktion vor allem nach Europa und ins Inland zurückzuverlagern. Faktoren wie z.B. der anhaltende Fachkräftemangel in Deutschland weisen jedoch darauf hin, dass eine Verlagerung ins Inland nicht immer und nicht in allen Branchen sinnvoll ist. Die in Engpassberufen ausgeschriebenen Stellen haben sich zwischen dem Jahr 2011 und 2018 fast verdoppelt und konzentrieren sich auf einige Berufe insbesondere in der Metall- und Elektroindustrie, dem Handwerk und dem MINT-Bereich, weshalb sich diese Arbeit im weiteren Verlauf vor allem auf das verarbeitende Gewerbe, genauer gesagt auf Produktionsunternehmen im verarbeitenden Gewerbe konzentriert.
Die Betrachtung der Handelsanteile geografischer Räume zeigt, dass die Länder Europas außerhalb der EU, was viele MOEL miteinschließt, einen bedeutenden Anteil ausmachen (zu sehen in Abb. 5) und lediglich von Asien übertroffen werden. Des Weiteren macht der Handel mit Osteuropa (in Abb. 6 zu sehen) mit 20 % des gesamten deutschen Außenhandelsvolumens keinen unbedeutenden Anteil aus.
Die wichtigste Handelsregion Deutschlands bildet gem. Tab. 1 die Visegrád-Region, welche mit Abstand die größten Umsätze auf sich vereint. Abb. 8 lässt feststellen, dass generell die Länder des Westbalkans die größten FDI-Zuflüsse im Verhältnis zum BIP auf sich vereinen können und sich fünf der sechs Länder unter den Top 7 der Region finden. Außerdem deuten die Entwicklung der deutschen FAT sowie die Zufriedenheit deutscher Unternehmen im Westbalkan auf eine lange und intensive Zusammenarbeit hin. Weitere Faktoren wie günstige Produktionskosten, eine strategisch günstige Lage zwischen Ost und West und vor allem zukünftige Absatzmärkte unterstreichen die Relevanz der Region.
Die aufgeführten Entwicklungen geben Anlass das Investitionspotential Mittel- und Ost-europas mit einem Fokus auf die Visegrád- und insbesondere die Westbalkan-Staaten näher zu betrachten.
Hierzu werden in dieser wissenschaftlichen Arbeit zuerst im zweiten Kapitel die Gegeben-heiten auf dem Westbalkan im Vergleich einiger gesamtwirtschaftlicher Indikatoren näher betrachtet und interpretiert, sodass die deutschen Investitionen räumlich weiter eingegrenzt werden können. Anschließend wird im Kapitel drei auf die Bedeutung von Standortentscheidungen für Industrieunternehmen eingegangen und Determinanten der Standortwahl werden näher erläutert. In Kapitel vier werden die Standortfaktoren der Länder des Westbalkan am Beispiel von Serbien mit denen der Visegrád-Staaten verglichen und mithilfe des Analytic Hierarchy Process des Mathematikers Thomas L. Saaty bewertet. Zur Gewichtung der Bedeutung der Standortfaktoren wird innerhalb des Analytic Hierarchy Process zuerst eine Präferenzanalyse durchgeführt und die Faktoren werden paarweise miteinander verglichen. Daraufhin werden die Präferenzen anhand einer Skala bewertet und anschließend durch ein mathematisches Modell in einer Matrix präzise gewichtet. Schließlich ergibt sich ein Punktesystem, durch welches die Rangfolge nach der Größe des Investitionspotentials gebildet wird. Die Betrachtung der Gegebenheiten auf dem Westbalkan und die durchgeführte Analyse führen zur Beantwortung der folgend formulierten Forschungsfragen:
„Das Investitionspotential der Länder des Westbalkan – ein potentieller Produktionsstandort für Deutschland?; - Wohin geht der Trend?“;
„Die Standortfaktoren Serbiens und der Visegrád-Staaten im Vergleich – Welches der Länder bietet das größte Investitionspotential für deutsche Produktionsunternehmen?“
2 Das Investitionspotential der WB6 – Wohin deutet der Trend?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 10: Die Westbalkan Six – geografische Übersicht
Abb. 10 bildet die geographische Lage sowie räumliche Größe des Westbalkans ab. Das Land Serbien ist hier mit rund 77.500 km² das flächenmäßig größte der Westbalkan-Länder. Es ist fast sechs-mal so groß wie Montenegro, sieben-mal so groß wie der Kosovo und rund drei-mal so groß wie Albanien und Nordmazedonien. Gefolgt wird das Land von Bosnien und Herzegowina mit ca. 51.000 km², Albanien mit knapp 28.700 km², Nordmazedonien mit 25.700 km², Montenegro mit 13.812 km² und dem Kosovo mit rund 10.900 km² (Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württenberg, 2022a-f). Keines der Länder ist Mitglied der EU, sie alle streben es jedoch an. Albanien (seit 2014), Montenegro (seit 2010), Nordmazedonien (seit 2005) und Serbien (seit 2012) tragen bereits den Status des Beitrittskandidaten, während Bosnien und Herzegowina sowie der Kosovo potenzielle Beitrittskandidaten sind und sich der EU weiter annähern müssen (Busch, 2021, S. 66).
Das pro Kopf-BIP in der Region des Westbalkans fällt, wie in Abb. 11 zu sehen, sehr unterschiedlich aus. Spitzenreiter ist hier das Land Serbien mit knapp 713 Tausend (Tsd.) €/Kopf im Jahr 2020, gefolgt von Albanien mit ca. 522 Tsd. € und Nordmazedonien mit rund 215 Tsd. €/Kopf. In RS und AL entwickelt sich das BIP über den Zeitverlauf positiv und in MK leicht positiv. Auf einem deutlich niedrigeren Niveau entwickelt sich das reale BIP in Bosnien und Herzegowina mit ca. 9,6 Tsd. € und dem Kosovo mit rund 3,1 Tsd. €, wobei beide Länder einen stets positiven Wachstumstrend verfolgen. Das BIP Montenegros ist von einer höheren Volatilität geprägt und entspricht 5,5 Tsd. € im Jahr 2020 (World Bank, 2022d).
Abb. 11: Das reale pro Kopf-BIP der Westbalkanstaaten im Vergleich (2010–2020)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 12: Importe, Exporte und Handelsbilanzsalden zwischen der EU und den Westbalkan-Staaten (2010–2020)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 12 bildet den Handel zwischen der EU und den Westbalkanstaaten ab. Man kann erkennen, dass sowohl die Einfuhren als auch die Ausfuhren einen positiven Wachstumstrend verfolgen und bspw. im Jahr 2019 Waren im Wert von knapp 32 Millionen (Mio.) € in die Region des Westbalkans exportiert wurden und rund 23 Mio. € in die EU importiert wurden. Die Handelsbilanz bleibt dabei positiv, wobei die Exporte stets höher ausfallen als die Importe und die Bilanz sich in einem Rahmen zwischen 7,6 und 9,8 Mio. € bewegt (Eurostat, 2021).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 13: Deutsche Direktinvestitionen im Westbalkan (2010–2019) 4
Abbildung 13 zeigt die Bestände an Direktinvestitionen in den sechs hier untersuchten Ländern Südosteuropas von 2010 bis 2019. In diesem Zeitraum sind die Bestände um 113 % von 1,5 Mrd. € auf über 3,2 Mrd. € gestiegen (Deutsche Bundesbank & Wiiw, 2015, 2019, 2021b & 2012-2020). Die Abbildung lässt erkennen, dass nicht einzelne große Transaktionen die Bestandsstatistik stark beeinflusst haben, wie dies oft bei den Direktinvestitions-strömen der Fall ist. Es ist zu sehen, dass sich die Bestände an Direktinvestitionen vielmehr sehr schnell und vor allem sehr kontinuierlich erhöht haben (Römer, 2007, S. 27). Eine nähere Betrachtung zeigt, dass sich die Investitionen vor allem auf drei Länder beziehen, nämlich Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien und Serbien. Auf diese drei Länder entfallen im Jahr 2019 knapp 2,9 Mrd. € der Investitionen was rund 89 % aller deutschen Investitionen in die WB6 ausmacht. Über den gesamten Zeitverlauf vereinen die drei Länder rund 88 % aller Investitionen auf sich (Deutsche Bundesbank, 2015, 2019, 2021b; wiiw, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).
Abb. 14: Die FDI-Zuflüsse der WB6 nach Herkunftsland (2010–2019)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 14 zeigt die Herkunft der FDI- Zuflüsse des Westbalkans nach ihrer Größe und veranschaulicht, dass die Top-5-Investoren die Niederlande, die Schweiz, Österreich, Russland und Deutschland sind, wobei Deutschland den 5. Platz belegt. Für die WB6 haben FDI oberste Priorität. Alle haben sie spezielle staatliche Stellen, die sich um ausländische Direktinvestitionen bemühen. Einige von ihnen haben hierfür sogar eigene Ministerien. Alle bieten sie attraktive Vergünstigungen für Investoren und die meisten verfügen über spezielle Investitionszonen, in denen ausländische Investoren ihre Anlagen leicht ansiedeln können. Für die Aufgeschlossenheit der politischen Entscheidungsträger gegenüber FDI wird stets geworben (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, 2021, S. 15ff.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 15: Zielbranchen ausländischer Investoren im Westbalkan (2010–2019) 5
Abb. 15 zeigt bei einer kumulierten Branchenbetrachtung aller FDI in die WB6 eine eindeutige Tendenz. Demnach stellt das verarbeitende Gewerbe mit rund 8 Mrd. € die mit Abstand wichtigste Zielbranche von Investoren dar. An zweiter Stelle folgt mit deutlichem Abstand der Finanz- und Dienstleitungssektor mit ca. 5,2 Mrd. € und an dritter Stelle der Groß- und Einzelhandel mit ca. 4,2 Mrd. €. Weitere Zielbranchen stellen das Bauwesen, der Bergbau und die Gewinnung von Bodenschätzen, Immobilien, die Elektroindustrie sowie die Transport- und Logistikbranche dar. Für die Länder BA, MK und RS stimmen die Top-3-Zielbranchen für FDI mit den in Abb. 16 dargestellten Branchen, nämlich dem verarbeitenden Gewerbe, den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen und dem Groß- und Einzelhandel überein. Für AL sind dies Elektrizität, Gas etc., der Bergbau und die Gewinnung von Bodenschätzen sowie die Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Für den XK sind es die Zielbranchen Immobilien, Elektrizität, Gas etc. und die Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, 2021).
Abb. 16-21: Die ausländischen Direktinvestitionszuflüsse der WB6 (2010–2020)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
FDI-Zuflüsse in % des BIP FDI-Zuflüsse zu aktuellen Preisen in Mio. €Deutsche unmittelbare und mittelbare Direktinvestitionsbestände (saldiert in Mio. €)
Abb. 16-21 zeigen den prozentualen Anteil der insgesamt in dem jeweiligen Land zu-geflossenen FDI am BIP, die insgesamt zugeflossenen FDI in €, sowie die deutschen unmittelbaren und mittelbaren FDI, im Zeitverlauf von 2010 bis 2020. Die Anteile der FDI-Zuflüsse am BIP sind dabei auf der primär vertikalen Achse abzulesen und die Gesamtinvestitionen sowie deutschen Investitionen auf der sekundär vertikalen Achse.
- In AL bewegen sich die FDI-Bestände zwischen 7 und 10 % des BIP. Sie steigen im Betrachtungszeitraum um durchschnittlich 964 Mio. € jährlich, was einem Wachstum von 9 % entspricht. Die deutschen Investitionsbestände entwickeln sich gleichmäßig und konstant und steigen durchschnittlich um 96,4 Mio. €, was 10 % pro Jahr ausmacht. Sie bilden im Zeitverlauf zwischen 8 und 12 % der gesamten FDI in Albanien und sind hier somit von deutlich kleinerer Bedeutung als in den anderen Ländern. Im Jahr 2019 belaufen sich die deutschen Investitionen auf rund 1,3 Mio. €.
- Die FDI-Bestände bewegen sich in BA zwischen 1,5 und 3 % des BIP und das durchschnittliche jährliche Wachstum beläuft sich auf 389,7 Mio. €, was rund 9 % entspricht. Ihren Höchstwert erreichen die Investitionen mit rund 526,6 Mio. € im Jahr 2018. Die deutschen Investitionsbestände steigen stetig und wachsen im Durchschnitt mit 237 Mio. € um 10 % jährlich. Sie bilden im Zeitverlauf zwischen 34 und 94 % der gesamten bosnischen FDI- Bestände und weisen auf eine hohe Abhängigkeit des Landes von den deutschen Investitionen hin. Diese belaufen sich im Jahr 2019 auf 316 Mio. €.
- Die FDI-Bestände im XK entwickeln sich in einem Rahmen von 2,8 bis 8,2 % des BIP und wachsen im Zeitverlauf durchschnittlich um 248,3 Mio. €, also rund 9 %. Insgesamt sind die FDI-Bestände sehr volatil und finden ihren Höchstwert von 394 Mio. € im Jahr 2011. Die deutschen Investitionen, hier zu sehen von 2014 bis 2019, entwickeln sich konstant, wachsen im Durchschnitt um 10 %, also 82 Mio. € jährlich, und erreichen im Jahr 2019 einen Höchstwert von 147 Mio. €. Insgesamt entsprechen deutsche Investitionen zwischen 40 und 85 % der gesamten in den Kosovo in diesem Zeitraum geflossenen Investitionen, was auf die enorme Bedeutung dieser, für den Kosovo verweist.
- Das Diagramm lässt erkennen, dass die Investitionen in ME von einer höheren Volatilität geprägt sind als die der restlichen Länder. Die Investitionen erreichen hier ihren Höchstwert im Jahr 2010 mit knapp 697 Mio. €, entwickeln sich seitdem insgesamt negativ und wachsen im Durchschnitt um rund 9 %, also um 484 Mio. € jährlich. Zu beachten ist hier, dass das Land entgegengesetzt den anderen Ländern seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2019 vermehrt Investitionen erhält und die Kurve eine positive Steigung aufweist. Die Investitionen belaufen sich auf 7,5 bis 18 % des BIP, was generell auf eine deutlich höhere Abhängigkeit von FDI deutet als bei den anderen Ländern. Die deutschen Investitionen in Montenegro erreichen ihren Höchstwert ebenfalls im Jahr 2010 mit 114,5 Mio. € und entwickeln sich trotz deutlicher Steigerung des Niveaus im Jahr 2014 insgesamt negativ. Im Durchschnitt steigen die Investitionen um 80,5 Mio. € sprich um 11 %, bilden zwischen 5,8 und 43 % der gesamten Investitionen in Montenegro und sind damit für das Land von weniger großer Bedeutung als für BA, XK, MK und RS.
- In MK sind die FDI-Bestände leicht volatil und bewegen sich zwischen 1,5 und 5,7 % des BIP. Ihren Höchstwert erreichen die Investitionen im Jahr 2018 mit 6,7 Mio. € und verfolgen seither jedoch einen negativen Wachstumstrend. Durchschnittlich steigen die Investitionen jährlich um 309 Mio. € (ca. 9 %). Die deutschen Investitionen wachsen nach einem kurzen Fall nach der Finanzmarktkrise stets positiv um durchschnittlich 159,3 Mio. € im Jahr was rund 10 % ausmacht. Im Zeitverlauf machen die deutschen Investitionen zwischen 9,6 und 81 % der Gesamtinvestitionen aus, was auch hier auf die Relevanz deutscher Investitionen deutet.
- Die serbischen Investitionsbestände verfolgen bis auf einen Ausreißer nach der Finanzmarktkrise im Jahr 2011 einen überwiegend positiven Wachstumstrend, bewegen sich in einem Rahmen zwischen 3 und 10 % des BIP und wachsen durchschnittlich um ca. 2,9 Mrd. €, was einem Anstieg von 9 % jährlich entspricht. Die deutschen Investitionsflüsse nach Serbien verändern sich zwischen 2010 und 2017 nur sehr gering und bleiben konstant, steigen seither jedoch stetig. Der durchschnittliche Anstieg pro Jahr beträgt rund 1,4 Mrd. € und beläuft sich auf 10 %. Insgesamt bilden die deutschen Investitionen im Zeitverlauf zwischen 22 und 78 % der gesamten serbischen Investitionsbestände und sind auch hier von Wichtigkeit. Im Jahr 2019 erreichen die deutschen Investitionen ihren Rekordwert mit 2,2 Mrd. €.
Alles in allem lässt sich festhalten, dass die Anteile der Investitionsbestände am BIP während des Betrachtungszeitraums in Montenegro mit Werten zwischen 7,5 und 18 % deutlich höher ausfallen als bei den anderen Ländern, was auf eine größere Abhängigkeit des Landes von den FDI hindeutet. Gefolgt wird das Land von Albanien (mit zwischen 7 und 10 %) und Serbien (mit zwischen 3 und 10 %). Das durchschnittliche jährliche Wachstum der insgesamt in das Land geflossenen Investitionen beläuft sich bei jedem der Länder auf ca. 9 %, wobei Serbien mit 2,9 Mrd. € jährlich die mit Abstand größten Investitionen erhält. Darauf folgen Albanien mit 964 Mio. €, Montenegro mit 484 Mio. €, Bosnien und Herzegowina mit knapp 390 Mio. €, Nordmazedonien mit 309 Mio. € und der Kosovo mit durchschnittlich rund 248 Mio. €. Die deutschen FDI in den Westbalkan unterliegen einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von ca. 10 % und fallen in Serbien mit durchschnittlich 1,4 Mrd. € mit Abstand am höchsten aus. Hierbei machen die deutschen Investitionen zwischen 22 und 78 % der gesamten FDI in Serbien aus. Darauf folgen Bosnien und Herzegowina mit im Durchschnitt 237 Mio. € und einem Anteil an den Gesamtinvestitionen zwischen 34 und 94 % und Nordmazedonien mit 159 Mio. € und Anteilen von 9,6-81 %. Albanien und der Kosovo schließen sich mit deutschen FDI von durchschnittlich 96,4 Mio. € in AL und 82 Mio. € in XK an, während sie hier in AL zwischen 8 und 12 % und im XK 40-80 % der gesamten Investitionen ausmachen. Das Schlusslicht bildet mit geringem Abstand zum Kosovo das Land Montenegro mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum der deutschen Investitionen von 80,5 Mio. €. Der Anteil an Gesamtinvestitionen beträgt dabei zwischen 5,8 und 43 %. Es lässt sich feststellen, dass bis auf Albanien, jedes der betrachteten Länder in hohe Maße abhängig von deutschen Investitionen ist. Diese ist dabei in Bosnien und Herzegowina am stärksten ausgeprägt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 22: Die deutschen Investitionen in die WB6 im Verhältnis zur Landesgröße
Abb. 22 berücksichtigt neben der Höhe der Investitionen, die Landesgröße der einzelnen Länder und ermöglicht einen einfacheren Vergleich der Investitionsdaten. Es lässt sich festhalten, dass Serbien, Bosnien und Herzegowina und Nordmazedonien die beliebtesten Zielländer deutscher Investoren darstellen. Das Diagramm zeigt jedoch auch, dass die Investitionen keine Korrelation mit der Größe des Landes aufweisen und bspw. in AL mit 4,71 % und BA mit 11,58 % verhältnismäßig klein ausfallen, wenn man sie mit der Größe der Länder von jeweils 13,82 und 24,57 % vergleicht. Es ergibt sich ein Verhältnis von 1:2,9 für AL und 1:2,1 für BA. Auch in ME ist das Verhältnis mit 1:1,9 nicht besonders ausgeglichen. In den beiden Ländern MK und XK ist das Verhältnis etwas ausgewogener und beträgt für MK 1:1,6 und für XK 1:1,3. Lediglich in RS ist das Investitionsvolumen mit 68 % aller deutschen Investitionen in die WB6 deutlich höher als die Landesgröße mit 37 % der Gesamtfläche. Es ergibt sich ein Verhältnis von 1,8:1 (Deutsche Bundesbank; Landeszentrale für politische Bildung; Wiiw, 2015, 2019, 2021b; 2022a-f; 2012-2020).
Zahlreiche Unternehmen des Westbalkans stellen bereits wichtige Elemente deutscher Lieferketten dar und Deutschland fungiert als wichtigster Abnehmer der Westbalkanländer. Potential ist jedoch noch reichlich vorhanden und die Region bietet im wahrsten Sinne einen Liefermarkt direkt vor der Haustür. Bilaterale Initiativen führen zur Stärkung von Liefer-beziehungen und bauen Brücken zwischen Märkten. So ist die Region spätestens seit der Gründung der Einkaufsinitiative Westbalkan im Jahr 2015, welche die lokalen Lieferanten mit deutschen Einkäufern vernetzt, als Beschaffungsmarkt auf dem Bildschirm. In besonderem Fokus stehen hier die metall- und kunststoffverarbeitende Industrie, doch auch andere Branchen wie die Landwirtschaft und Lebensmittel-, die Textil-, Schuh- und Leder- und die Möbel- und Holz- Industrie weisen großes Potential auf. Um die Kontrolle über die Lieferbeziehungen zu erlangen, investieren ausländische Unternehmen vermehrt direkt und steigern die FDI-Bestände der Region zwischen 2015 und 2018 um 44 %. Die bilateralen Beziehungen unterliegen seit Beginn der Corona Pandemie einem Stresstest, der Lieferstandort Westbalkan wird jedoch sogar gestärkt. Auf dem Landweg ist die Region einfach erreichbar und auf eine Änderung der Nachfrage kann zügig reagiert werden. Außerdem zeichnet sich der Mittelstand der Region durch eine hohe Flexibilität aus (Overhoff, 2021, S. 5ff.).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Investitionen in die WB6 stark produktions-orientiert sind, was mit den in Deutschland ausgeschriebenen Engpassberufen und dem bestehenden Fachkräftemangel in Zusammenhang gebracht werden kann. Die deutschen Investitionen beziehen sich dabei vor allem auf die Länder Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien und insbesondere auf Serbien. Exemplarisch für den Westbalkan wird deshalb im weiteren Verlauf der Arbeit das Investitionspotential Serbiens, dem Land mit den mit Abstand höchsten Investitionen im Westbalkan, näher betrachtet und die zu Beginn gestellte Forschungsfrage „Das Investitionspotential der Länder des Westbalkan – Wohin geht der Trend?“ kann abschließend mit Serbien beantwortet werden.
3 Die Bedeutung von Standortentscheidungen für Industrieunternehmen
Ein Unternehmen baut seinen Industriebetrieb in der Regel nur dort, wo es wirtschaftlich und vorteilhaft produzieren kann. Das Qualitätsniveau eines Standortes ist unter anderem entscheidend für die Kostenstruktur des Unternehmens weshalb die Vor- und Nachteile potentieller Standorte akkurat geprüft werden und zahlreiche Interessen ausführlich aufeinander abgestimmt werden müssen. Allseitig werden Gründe für die Standortwahl von Unternehmen als Standortfaktoren bezeichnet (Kreus, Lindner, & von der Ruhren, 2004, S. 61f.).
Die geläufigste Standorttheorie stammt von Alfred Weber aus dem Jahre 1909, wonach der Standort in einem dreistufigen Entscheidungsprozess gewählt wird. Zuerst erfolgt die Identifikation eines transportkostenminimalen Standorts auf Grundlage für die Produktion verwendeter Materialien. Anschließend werden die Arbeitskosten und daraufhin die Agglomerationseffekte betrachtet (Haas, Neumair, & Schlesinger, 2022).
Überwiegend knüpfen Standorttheorien heute an die Webers an, beziehen jedoch aufgrund des technischen Fortschritts und modifizierter Ansprüche an den Raum weitere Faktoren mit ein. Neben berechenbaren Kosten gewinnen auch nicht berechenbare Faktoren, wie ökologische, politische raumordnerische und individuelle immer mehr an Bedeutung. So gelten Standortfaktoren heute nicht nur als Kostenvorteile, sondern auch als Entscheidungsfaktoren für die Erhaltung und Stärkung von Wirtschaftsstandorten (Kreus, Lindner, & von der Ruhren, 2004, S. 61f.).
3.1 Standortfaktoren
Unterschieden werden Standortfaktoren heute zwischen harten und weichen Faktoren. Harte Standortfaktoren sind quantifizierbare Strukturdaten, wie z.B. soziodemographische Merk-male, Verkehrsinfrastruktur, Lagebeziehungen zu anderen Orten oder politisch-administrative Vor- und Nachteile. Alle haben sie einen enormen Einfluss auf die unternehmerische Tätigkeit. Weiche Standortfaktoren lassen sich nur schwer messen und ihre Bedeutung wird von subjektiver Wertung beeinflusst. Doch auch sie können von enormer Bedeutung für die Standortentscheidung des Unternehmens sein (Grabow & Hahne, 1995). Allgemein sind harte und weiche Faktoren komplementär, eng miteinander verknüpft und bedingen sich wechselseitig (Kreus, Lindner, & von der Ruhren, 2004, S. 61f.). Darüber hinaus variiert die Relevanz einzelner Standortfaktoren über die Zeit. Der Stellenwert der Produktions-, Transport- und Logistikkosten, sowie die der Produktivität verliert unter Umständen an Gewicht. Das Marktpotenzial, die Verfügbarkeit qualifizierter Mitarbeiter, die Produktionsauslastung, die Nähe zu Märkten mit innovativen Kunden, die Möglichkeit, flexibel und qualitativ hochwertig zu produzieren sowie die Nähe von Produktion und Entwicklung gewinnen dagegen unter Umständen an Bedeutung. Von besonderer Relevanz sind künftig Faktoren, wie die Nähe zu Lieferanten, Kunden und Kompetenzzentren oder Branchenclustern sowie die Höhe der Betreuungs-, Koordinations- und Managementkosten (Melde, Pohlenz, & Gürges, 2015, S. 4).
3.2 Determinanten der internationalen Standortwahl
In Abhängigkeit zum Internationalisierungsmotiv eines Unternehmens lassen sich erfolgskritische Kriterien der Standortwahl herleiten. Es wird dabei zwischen den folgenden vier üblichen Internationalisierungsstrategien unterschieden:
1. Markterschließung
2. Kostenreduktion durch Ansiedlung in Niedriglohnländern
3. Verlagerung der Produktion zu Schlüsselkunden
4. Technologieerschließung (Kinkel, 2009, S. 5)
Im Rahmen des Verbundprojekts BESTAND erforschen von 2000 bis 2003 drei Forschungsinstitute und zehn Unternehmen mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), mit Unterstützung des Projektträgers, des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und unter der Koordination des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) Aspekte der Standortbewertung und entwickeln eine neue Standortfaktorensystematik.
Die folgende Abbildung erteilt einen Überblick über die erarbeitete Einteilung von Standortfaktoren, welche auf eine strategisch fundierte, ganzheitliche Bewertung bestehender sowie neu geplanter Projekte abzielt (Melde, Pohlenz, & Gürges, 2015, S. 5ff.). Die Einteilung berücksichtigt neben den klassischen Produktions- und Marktfaktoren auch Performance-faktoren, sprich aktiv gestaltbare Indikatoren. Diese Performancefaktoren erlauben es den Unternehmen, standortspezifische Leistungsindikatoren in einer Kategorie zusammenzufassen und sind von zentraler Bedeutung für die Schaffung strategischer Wettbewerbsvorteile (Kinkel, 2009, S. 60f.).
Abb. 23: Die Einteilung von Standortfaktoren nach der BESTAND-Standortfaktorensystematik
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Produktionsfaktoren der Abb. 23 beeinflussen hier die Kosten und Produktivität der Produktion. Die Marktfaktoren beinhalten Gesichtspunkte, welche die Distanz zu Kunden und Absatzmärkten erfassen und helfen, das Marktpotenzial oder den Auslastungsgrad der Produktion zu bewerten. Performancefaktoren sind jene, welche die Leistungsfähigkeit eines Unternehmensstandortes reflektieren und teilweise durch die Unternehmen aktiv beeinflusst werden können. Die Netzwerkfaktoren ermöglichen die Messung von Qualität und Quantität der an einem Standort zur Verfügung stehenden Kooperationsmöglichkeiten und Netzwerke. Unterhalb der Ebene der Markt-, Produktions- und Performancefaktoren unterscheidet die Systematik qualitative und quantitative Standortfaktoren, wodurch unterstützt wird, dass diese jeweils durch die für sie geeigneten Bewertungsinstrumente untersucht werden (Melde, Pohlenz, & Gürges, 2015, S. 9f.).
3.3 Erfolgskritische Standortfaktoren
Die Ableitung erfolgskritischer Standortfaktoren in Abhängigkeit zur jeweiligen Internationalisierungsstrategie bildet einen der wichtigsten Bausteine für die strategiekonforme Kriterien-Selektion und hilft den Fokus auf Kriterien zu richten, die für die jeweilige Internationalisierungsstrategie von besonderer Bedeutung sind. Für die vier zuvor erwähnten leitenden Internationalisierungsstrategien werden durch die oben veranschaulichte Standortfaktorensystematik Checklisten mit jeweils zehn erfolgskritischen Standortfaktoren identifiziert, die für den Erfolg ausschlaggebend sind. (Kinkel, 2009, S. 63) In der vorliegenden Arbeit wird der Schwerpunkt auf die Internationalisierungsstrategie „Kostenreduktion im Niedriglohnland“ gesetzt, weshalb Marktfaktoren im weiteren Verlauf nicht berücksichtigt werden.
Erfolgskritische Standortfaktoren der Internationalisierungsstrategie „Kosten-reduktion im Niedriglohnland“:
- Stufe 1: Einzelkosten der Herstellung i.w.S.
1. Lohn- und Gehaltskosten inkl. Nebenkosten, Material- und Vorleistungskosten, Transportkosten
2. Zukünftige Entwicklung (Angleichung) der Lohnkosten und Preise vor Ort
- Stufe 2: Übergang zu Stückkosten
3. Produktivitätsniveau vor Ort
4. Verfügbarkeit und Fluktuation von Arbeitskräften
5. Anlaufzeiten und -kosten (zur Sicherung der notwenigen Qualität und Produktivität)
- Stufe 3: Einbezug von Gemeinkosten
6. Am deutschen Stammsitz anfallende Gemeinkosten („Overheads“): Betreuungs-, Koordinations-, Kommunikations-, Kontrollkosten
7. Qualifizierungs- und Trainingskosten (zur Erreichung des notwendigen Qualifikations-niveaus)
- Stufe 4: Einbezug von „versunkenen Kosten“
8. Kosten der Technologieanpassung an das Qualifikationsniveau
9. Kosten für den Netzwerkaufbau vor Ort (Lieferanten ausreichender Qualität und Zuverlässigkeit, flexible Dienstleister etc.)
10. „Weiche Faktoren“ am deutschen Stammsitz: Vertrauen, Motivation, Konflikte
Nicht ausschlaggebend sind: Subventionen, Fördermittel, Steuern & Abgaben. (Melde, Pohlenz, & Gürges, 2015, S. 6)
4 Eine Analyse der Standortfaktoren Serbiens und der Visegrád-Staaten anhand des Analytic Hierarchy Process
In Kapitel 4 sollen die Standortfaktoren der Visegrád-Staaten und Serbiens zum Vergleich des Investitionspotentials der einzelnen Länder anhand der Methode des Analytic Hierarchy Process (AHP), des Mathematikers Thomas L. Saaty, systematisch analysiert, gewichtet und bewertet werden. Im Fokus stehen soll dabei die eingangs gestellte Frage: „Welches der Länder bietet das größte Investitionspotential für deutsche Produktionsunternehmen?“ Hierzu wird in folgender Reihenfolge vorgegangen:
1.)
- Formulierung einer Frage zur Problemstellung: Welches der Länder bietet das größte Investitionspotential für deutsche Produktionsunternehmen?
- Benennung der Bewertungskriterien sowie Attribute in Form von Standortfaktoren:
- Gesamtwirtschaftliche Indikatoren: Wachstumsraten des realen pro-Kopf-BIP, FDI-Zuflüsse und Stocks, Ease of doing Business
- Arbeitsmarkt: Bildungsniveau im Alter 25-54, Bildungsniveau im Alter 20-24, Arbeitsproduktivität, Komplexität der Findung qualifizierter Mitarbeiter
- Kosten: Beschäftigungskosten, Energiekosten, Transportkosten
- Steuerbelastung: Höhe der Steuern
- Infrastruktur: Verkehrsnetzdichte
- Internationale Handelsabkommen und Präferenzsysteme
- Investitionsförderung
- Sonstige Indizes: Innovationsindex, Index politischer Transformation
2.)
Vergleich und Bewertung der Kriterien in 2 Unterschritten:
a. Präferenzanalyse: Paarweise Gegenüberstellung aller Standortfaktoren
b. Bewertung der Präferenzen anhand einer Skala von 1-9 (1= gleiche, 3= etwas größere, 5= deutlich größere, 7= sehr viel größere, 9= absolut dominierende Bedeutung; 2, 4, 6, 8 = Zwischenwerte)
3.) Präzise Gewichtung der einzelnen Bewertungen der Kriterien in einem mathematischen Modell in Form von Berechnung der Eigenvektoren zwecks Entstehung einer prozentualen Reihenfolge.
4.) Auswertung (Saaty & Katz, 1990, S. 9ff.)
4.1 Gesamtwirtschaftliche Indikatoren
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 24: Die Entwicklung des realen BIP/Kopf und seiner Wachstumsraten der V4 und Serbiens (2010 – 2020)
Abb. 24 zeigt die Entwicklung des realen BIP pro Kopf der V4 und Serbiens (primär vertikale Achse), sowie seine Wachstumsraten (sekundär vertikale Achse). Es ist eine klare Rangordnung zu erkennen, wobei Tschechien führt und im Jahr 2020 ein BIP von 17.340 € pro Kopf erreicht. Die Slowakei verfügt hier während des gesamten Zeitverlaufs über Werte unterhalb des V4 Durchschnitts, erreicht 2020 ein BIP von 15.180 € pro Kopf und stellt das Land mit dem zweithöchsten realen Pro-Kopf-BIP dar. Darauf folgen Ungarn und Polen, wobei es Polen schafft, Ungarn im Jahr 2020 mit einem Wert von 12.700 € pro Kopf einzuholen. Ungarn kommt hier auf einen Wert von 12.680 € pro Kopf. Serbien bildet mit deutlichem Abstand das Schlusslicht und erreicht 2020 ein BIP von 5.890 € pro Kopf. Der Durchschnitt der V4 beträgt 15.948 € und bildet sogar das 2,7-fache des serbischen realen pro-Kopf-BIP. Betrachtet man nun jedoch die Wachstumsraten der einzelnen Länder, ergibt sich eine veränderte Reihenfolge und es ist festzustellen, dass Polen mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 3,1 % das größte Wachstum verzeichnet und somit die VWL mit der größten Entwicklung darstellt. Die Slowakei schließt sich daran mit einem Wert von 2,3 % an. Die durchschnittliche Wachstumsrate der restlichen Länder fällt in ähnlicher Höhe aus, mit 1,9 % in Ungarn, 1,8 % in Tschechien und 1,6 % in Serbien (Eurostat, 2022d; Eurostat, 2022e).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 25: Die Entwicklung von FDI-Zuflüssen und -Stocks zu aktuellen Preisen (2010–2020)
Betrachtet man die Entwicklung der FDI-Zuflüsse im Zeitverlauf, stellt man, wie in Abb. 25 zu sehen, vor allem bei den V4 eine hohe Volatilität fest. Das Land Polen verfügt mit 150.233 Mio. € im gesamten Zeitverlauf über die höchsten FDI mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 34,97 %. Gefolgt wird das Land von Tschechien mit insgesamt 80.874 Mio. € und einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 206,44 %, welche durch eine höhere Volatilität gekennzeichnet ist. Darauf folgt Serbien mit 39.009 Mio. € und einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 29,10 % und Ungarn mit 36.723 Mio. € und einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 34,31 %. Das Schlusslicht bildet die Slowakei mit FDI im Wert von insgesamt 15.832 Mio. € und einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 96,58 %, welche ebenfalls sehr volatil verläuft (Eigene Berechnung; UNCTAD, 2022).
Tab. 2: Das Ranking des Ease of Doing business
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Ease of doing Business Index stellt eine weltweite Studie zur Unternehmensregulation dar, bei der regelmäßig Experten und Ökonomen aus 190 Ländern befragt werden. Die Platzierung eines Landes in der Rangliste wird durch folgende Indikatoren bestimmt: Gründung eines neuen Unternehmens, Erwerb einer Baugenehmigung, Zugang zu Elektrizität, Eigentumsregistratur, Zugang zu Krediten, Schutz von Investoren, Steuern, Internationaler Handel, Vertragssicherheit und Insolvenzverfahren (World Bank, 2022a). Tab. 2 zeigt das Ranking des Ease of doing Business im Jahre 2015 und 2019 und lässt verschiedene, im Folgenden zu analysierende Entwicklungen erkennen. Polen erreicht in beiden Jahren den Bestplatz der Gruppe, rutscht jedoch von 2015 bis 2019 um 8 Plätze nach unten und landet auf Rang 40. Tschechien erreicht im Jahr 2019 den zweitbesten Rang, schafft es sich von 2015 bis 2019 um drei Plätze zu verbessern und landet auf Rang 41. Darauf folgt Serbien auf Rang 44 im Jahr 2019. Interessant ist hier zu beobachten, dass das Land vom Jahr 2015 bis 2019 einen Sprung von 47 Plätzen erreicht und es schafft, seine Unternehmensregulationen enorm zu verbessern. Knapp dahinter auf Rang 45 befindet sich die Slowakei, die sich seit dem Jahr 2015 um acht Plätze verschlechtert. Das Schlusslicht bildet Ungarn auf Platz 52 im Jahr 2019, welches sich von 2015–2019 um 2 Plätze verbessert. (World Bank, 2022b)
Die Top-3-Sektoren gemessen am Investitionsvolumen im Jahre 2018 bilden in der Region der V4 und Serbiens, wie in Abb. 26 zu sehen, das verarbeitende Gewerbe, das Versicherungs- und Finanzwesen und der Groß- und Einzelhandel, wobei das verarbeitende Gewerbe die größten Investitionen auf sich vereint. Für Polen und Serbien6 bestehen die Top-3-Sektoren (Verarbeitendes Gewerbe - RS: 5,79 Mrd. €, PL: 63,65 Mrd. €; Versicherungs- und Finanzwesen: RS: 3,26 Mrd. €, PL: 36,72 Mrd. €; Groß- und Einzelhandel: RS: 2,95 Mrd. €; PL: 29,58 Mrd. €) aus o.g. Reihenfolge, gefolgt vom Immobiliensektor (19,65 Mrd. €) und den freiberuflichen-, wissenschaftlichen- und technischen Aktivitäten (13,79 Mrd. €) in Polen und dem Bauwesen (2,29 Mrd. €) sowie dem Transport- und Logistiksektor (1,58 Mrd. €) in Serbien. In Tschechien und Ungarn liegen die meisten Investitionen im Versicherungs- und Finanzsektor (CZ: 44,74 Mrd. €, HU: 5,52 Mrd. €), gefolgt vom verarbeitenden Gewerbe (CZ: 40,73 Mrd. €, HU: 5,29 Mrd. €) und dem Groß- und Einzelhandel (CZ: 13,05 Mrd. €, HU: 1,58 Mrd. €). Daraufhin folgen in Tschechien der Immobiliensektor (11,90 Mrd. €) und die freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Aktivitäten (10,18 Mrd. €), sowie in Ungarn die Energieversorgung (1,12 Mrd. €) und der Informations- und Kommunikationssektor (0,73 Mrd. €). Die Slowakei erhält die größten Investitionen in folgender Reihenfolge: 1. Verarbeitendes Gewerbe (0,38 Mrd. €), 2. Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten (0,34 Mrd. €), 3. Groß- und Einzelhandel (0,16 Mrd. €), 4. Information und Kommunikation (0,14 Mrd. €), 5. Immobilien (0,10 Mrd. €) (Czech National Bank; National Bank of Poland; OECD.Stat; wiiw; WKO, 2018; 2018; 2022; 2021; 2021b).
Abb. 26: Die Top 3 Sektoren für Investitionen in der Region V4 und RS im Jahr 2018
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.2 Der Arbeitsmarkt der Visegrád 4 und Serbiens im Vergleich
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 27: Das Bildungsniveau im Alter von 25-54 Jahren (2020)
Das Bildungsniveau im Alter von 25-54 im Jahr 2020 ist auf Abb. 27 zu sehen. Man erkennt, dass Polen mit einem Anteil von 38 % über den größten Anteil an Menschen mit hohem Bildungsniveau und Serbien mit 14,7 % über die meisten Menschen mit niedrigem Bildungsniveau verfügt. Summiert man die Kategorien des mittleren und hohen Bildungsniveaus ergibt sich folgende Rangfolge: 1. CZ, 2. PL, 3. SK, 4. HU, 5. RS. Verglichen mit dem EU-Durchschnitt ist der Bildungsstand der Länder insgesamt positiv zu bewerten. In den Kategorien niedriges und mittleres Bildungsniveau erzielt jedes der betrachteten Länder einen besseren Wert als der EU-Durchschnitt. Lediglich in der Kategorie hoher Bildungsabschluss bewegen sich die Länder, bis auf Polen, unterhalb des EU-Durchschnitts (Eurostat, 2022b).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 28: Die Bevölkerung im Alter von 20-24 Jahren, die mindestens die Sekundar-stufe II abgeschlossen hat (2020)
Bei der Betrachtung der Bevölkerung im Alter von 20–24 Jahren, die mindestens die Sekundarstufe II abgeschlossen hat, wie in Abb. 28 dargestellt, erhalten wir eine veränderte Rangfolge. Die meisten Abschlüsse werden hier mit insgesamt 93,6 % in Serbien erzielt. Darauf folgen Polen mit 89,9 %, die Slowakei mit 89,7 %, Tschechien mit 87,4 % und Ungarn mit 85,7%. In Serbien, der Slowakei und Tschechien ist der Anteil von Männern etwas höher und in Polen und Ungarn überwiegt der Frauenanteil (Eurostat, 2022b).
Abb. 29: Die Komplexität der Findung von qualifizierten Mitarbeitern (2017–2019 )
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Skala: Inwieweit können Unternehmen in ihrem Land Personen mit den erforderlichen Qualifikationen finden, um ihre offenen Stellen zu besetzen? 1 = überhaupt nicht, 7 = in hohem Maße)
Betrachtet man die Entwicklung der Komplexität der Findung qualifizierter Mitarbeiter wie in Abb. 29 gezeigt, stellt man fest, dass man in Ungarn mit einem Skalenwert von 3 im Jahr 2019 die größten Probleme hat qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Daraufhin folgen Tschechien und die Slowakei mit einem Wert von 3,25 und 3,43 im Jahr 2019. Als nächstes folgt Polen mit dem Wert 4,09 und der Spitzenreiter Serbien mit 4,44, der selbst den Welt-Durchschnitt von 4,25 übersteigt. Des Weiteren ist zu erkennen, dass lediglich Ungarn und Serbien sowie der Durchschnitt der Welt im betrachteten Zeitraum einen positiven Wachstumstrend verfolgen. Polen und Tschechien verfolgen einen negativen Wachstumstrend und in der Slowakei entwickelt sich die Komplexität zuerst negativ und dann positiv (World Bank, 2022c).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 30: Die Arbeitsproduktivität der V4 und Serbiens im Vergleich anhand der EU FAT im Bereich Industrie, Baugewerbe und Dienstleistung (2019)
Die Slowakei stellt mit 489.185,41 € Umsatz pro Beschäftigten das Land mit der größten Arbeitsproduktivität dar (siehe Abb. 31). Ungarn folgt der Slowakei mit 469.185,75 € worauf Polen mit 345.595,17 € und Tschechien mit 286.627,50 € folgen. Serbien weist mit 83.275,36 € pro Beschäftigten die mit Abstand niedrigste Arbeitsproduktivität auf, welche der Spitzenreiter Slowakei fast versechsfacht (Deutsche Bundesbank, 2020; Eurostat, 2022c).
4.3 Verschiedene Kostenarten im Überblick
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 31: Die Beschäftigungskosten bei Sachgütererzeugung (2020)
Abb. 31 verdeutlicht die Ungleichmäßigkeit der Beschäftigungskosten bei Sachgüter-erzeugung im Jahr 2020. Die niedrigsten Beschäftigungskosten hat das Land Serbien mit insgesamt 5,70 € pro Arbeitsstunde, während es gleichzeitig mit knapp 16 % der Gesamt-kosten über den kleinsten Anteil an indirekten Arbeitskosten bzw. Sozialbeiträgen verfügt. Über die zweitniedrigsten Beschäftigungskosten verfügt Ungarn mit 10,60 € pro Stunde und einem Anteil an indirekten Kosten von rund 17 %. Darauf folgen Polen mit insgesamt 10,70 € pro Stunde, während die indirekten Kosten knapp 19 % ausmachen, die Slowakei mit Beschäftigungskosten von 13,70 € pro Stunde und einem Anteil an indirekten Arbeitskosten von 2 4%, welche den V4-Durchschnitt von 12,30 € pro Stunde und einem Anteil an indirekten Kosten von 22 % bereits überschreitet. Tschechien weist die höchsten Beschäftigungskosten mit 14,10 € pro Stunde und den höchsten Anteil an indirekten Arbeitskosten mit ca. 26 % auf. Das durchschnittliche Nettoäquivalenzeinkommen verteilt sich in derselben Rangordnung, wobei Serbien über ein durchschnittliches Nettoäquivalenzeinkommen von 4.281 € verfügt, darauf folgt Ungarn mit 7.278 €, Polen mit 8.907 €, die Slowakei mit 9.003 € und Tschechien mit 11.885 €. Das durchschnittliche Nettoäquivalenzeinkommen der V4 beträgt 9.268 € und bildet mehr als das doppelte des serbischen Einkommens (WKO, 2021a; WKO, 2021c).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 32: Die B2B-Energiekosten der V4 und Serbiens (2022) 7
Die Verteilung der Energiekosten, wie in Diagramm 32 zu sehen, fällt sehr unterschiedlich aus. Folgende Rangordnung ergibt sich bei den Benzinkosten: 1. HU, 2. PL, 3. RS, 4. SK, 5. CZ, beim Erdgas: 1. RS, 2. CZ, 3. HU, 4. PL, 5. SK, beim Flüssiggas ergibt sich: 1. PL, 2. RS, 3. SK, 4. CZ, 5. HU und bei den Stromkosten: 1. CZ und RS, 2. HU, 3. PL, 4. SK. Es ist zu erkennen, dass das Land Serbien mit 0,031 €/kWh Erdgas und 0,094 €/ kWh Strom in gleich zwei Kategorien über den günstigsten Preis verfügt und insgesamt die günstigsten Bedingungen bietet. In der Kategorie Flüssiggas verfügt das Land mit 0,87 €/l über den zweitgünstigsten Preis sowie beim Benzin mit 1,43€/l über den drittgünstigsten Preis. Die höchsten Energiekosten weist das Land Slowakei auf, welches in den Kategorien Erdgas mit 0,071 €/kWh und Strom mit 0,15 €/kWh die höchsten Preise bietet. In der Kategorie Benzin belegt die Slowakei mit 1,74 €/l den 4. Platz und beim Flüssiggas verfügt sie über den drittbesten Preis. Insgesamt ergibt sich bei der Höhe der Energiekosten folgendes Ranking: 1. RS, 2. PL, 3 CZ, 4. HU, 5. SK. (Global Petrol Prices, 2022; NIS Petrol, 2022)
Die wichtigsten europäischen Handelspartner im deutschen Außenhandel sind im Jahr 2021 die Länder Belgien, Italien, Frankreich, Niederlande, Österreich, Polen, Schweiz, Spanien, Tschechien und das Vereinigte Königreich (DESTATIS, 2022, S. 2ff.).
Tab. 3 zeigt die Entfernungen der V4 und Serbiens in Straßenkilometern sowie die Transportkosten in Form von Arbeitskosten zu den Hautstädten der zehn wichtigsten europäischen Handelspartner Deutschlands. Für die Berechnungen wird eine Geschwindigkeit von 100km/h angenommen. Die Tabelle lässt erkennen, dass Tschechien mit insgesamt 9.709km über die geringsten Entfernungen zu den wichtigsten Handelspartnern Deutschlands verfügt. Darauf folgt die Slowakei mit 11.580 km, Ungarn mit 13.221 km und Polen mit 13.671 km. Serbien weist mit 16.428 km die größten Distanzen auf. Die Berechnung der Transportkosten ((Distanz/100)*Arbeitskosten pro Stunde) ergibt jedoch eine andere Rangordnung. Hier verfügt Serbien, trotz der größten Distanz, über die insgesamt niedrigsten Transportkosten mit 1.558,40 €. Das Land mit den zweitniedrigsten Transportkosten, die das knapp 1,5-fache von denen Serbiens betragen, ist Tschechien mit 2.281,66 €. Darauf folgen Ungarn mit 2.335,61 € und Polen mit 2.428,11 €. Die höchsten Transportkosten hat die Slowakei mit 2.644,78 € (Eigene Berechnung; WKO, 2021a; Google Maps, 2022).
Tab. 3: Die Transportkosten in Form von Arbeitskosten und Entfernungen der V4 und Serbiens zu den Hauptstädten der wichtigsten europäischen Handelspartnern Deutschlands
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.4 Verschiedene Steuerarten im Überblick
Tab. 4: Die Steuerbelastung von Unternehmen in den V4 und Serbien
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 4 schafft einen Überblick über die verschiedenen Steuerarten der V4 und Serbiens und ermöglicht einen Vergleich der Unternehmensbesteuerung. Die Einkommenssteuer ist mit 10 % in Serbien am niedrigsten. Bei Einkommen, die einen Wert von 62.913 € überschreiten, wird der Überschuss mit 15 % besteuert. Den zweitniedrigsten Steuersatz hat Ungarn mit einem Pauschalsatz von 15 % für alle Einkommensgruppen, worauf das Land Tschechien ebenfalls mit einem Pauschalsatz von 15 %, jedoch einer zusätzlichen Solidaritätssteuer von 7 % für alle Einkommen die 966.945 € überschreiten, folgt. Über die höchsten Einkommenssteuersätze verfügen Polen mit 17 % für Jahreseinkommen unter 25.955,49 € (Überschuss mit 32 %) und die Slowakei mit 19 % für Einkommen unter 37.163 € (Überschuss mit 25%). Die Gewerbesteuer wird bis auf in Ungarn mit 2 %, in keinem der restlichen betrachteten Länder erhoben. Die Körperschafts- oder Gewinnsteuer ist mit einem Einheitssatz von 9 % in Ungarn mit Abstand am niedrigsten. Darauf folgt Serbien mit einem Einheitssatz von 15 % und Polen mit einem Standardsatz von 19 % sowie einer zusätzlichen Unterscheidung von Unternehmen mit Umsätzen, die einen Wert kleiner als 2 Mio. € erwirtschaften, für die eine Steuerbelastung von lediglich 9 % Gewinnsteuer gilt. In Tschechien gilt ein Einheitssatz von 19 % und in der Slowakei ein Standardsatz von 21 % sowie 15 % für Unternehmen mit Umsätzen geringer als 100.000 €. Für die Umsatzsteuer gibt es in den Ländern Polen, Tschechien und Ungarn drei verschiedene Steuersätze, den Standardsatz und den ermäßigten Satz, den es auch in den anderen beiden Ländern gibt und der meist u.a. Lebensmittel, Arznei und Bücher betrifft. Beim niedrigeren Satz gilt in Polen eine Besteuerung von 5 % auf unverarbeitete Lebensmittel, Bücher und Fachpresse, in Tschechien 10 % für u.a. unverzichtbare Babynahrung, bestimmte Arznei und Mühlenprodukte und 5 % in Ungarn für Arznei, Bücher und Zeitschriften. Polen verfügt des Weiteren über einen weiteren niedrigeren Steuersatz der Umsatzsteuer, welcher sich auf innergemeinschaftliche Lieferungen und Warenexporte bezieht und 0 % beträgt. Der Standardsatz ist mit 20 % in Serbien am geringsten. Den zweitniedrigsten Standardsatz mit 20 % hat die Slowakei. Darauf folgt Tschechien mit einem Standardsatz von 21 % und Polen mit 23 %. In Ungarn ist die Umsatzsteuerbelastung mit einem Standardsatz von 27 % mit Abstand am höchsten. Ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland besteht für jedes der betrachteten Länder, wobei Tschechien mit insgesamt 92 und Polen mit 90 über Doppelbesteuerungsabkommen mit den meisten Ländern verfügen. Darauf folgen Ungarn mit 73, die Slowakei mit 70 und Serbien mit 62. Für die Gesamtbewertung der verschiedenen Steuerarten ergibt sich folgende Rangordnung: 1. RS, 2. CZ, 3. HU, 4. PL, 5. SK.
4.5 Die geographische Lage und Verkehrsinfrastruktur
Tab. 5: Die Transport- und Strukturdaten der V4 und Serbiens im Vergleich
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 5 schafft einen Überblick über einige Transport- und Strukturdaten der V4 und Serbien. Betrachtet man die Dichte des Straßen-, Eisenbahn-, Autobahn- und Wasserverkehrsnetzes, stellt man fest, dass das Land Ungarn über das mit Abstand am besten ausgebaute Verkehrsnetz verfügt, gefolgt von Polen, der Slowakei und Tschechien. Serbien bietet das am schlechtesten ausgebaute Verkehrsnetz der betrachteten Ländergruppe.
Quelle: Cushman & Wakefield (2019)
Abb. 33: Die wichtigsten europäischen Logistikkorridore der Zukunft
Durch die Zunahme des Frachtaufkommens, der Transportkosten, des Fachkräftemangels sowie der Überlastung der Straßen ist der Logistiksektor von ständiger Entwicklung geprägt. Eurostat prognostiziert einen Anstieg der Güterverkehrsnachfrage in Kontinentaleuropa von 182 % zwischen den Jahren 2010 und 2050. Um die Entwicklung der europäischen Logistikindustrie zu unterstützen, veröffentlicht das internationale Consulting-Unternehmen Cushman & Wakefield einen Bericht, der einige der wichtigsten neuen Transportkorridore der Zukunft aufzeigt. Denn Europas wichtigster Verteilungskorridor, die so genannte „blaue Banane“, hat sich als Reaktion auf die EU-Erweiterungen sowie den Bau neuer Autobahnen in mehrere Korridore verwandelt. Auch in Zukunft werden sich diese Korridore weiter entwickeln und zusätzlich durch Veränderungen, hervorgerufen durch den elektronischen Handel, neue Technologien sowie multimodale Konnektivität und Verkehrsnetze, verstärkt. Cushman & Wakefield identifiziert acht primäre Logistikkorridore, welche die europäische Logistik wahrscheinlich bestimmen werden und klassifiziert sie entweder als neue Märkte, 2025-Märkte oder 2030-Märkte, je nachdem, wann sie voraussichtlich funktionsfähig sein werden. Die von Cushman & Wakefield ermittelten künftigen Vertriebskorridore sind: 1. Die ursprüngliche blaue Banane, 2. Der Korridor des Vereinigten Königreichs, 3. Der irische Korridor, 4. Der iberische Korridor, 5. Der mitteleuropäische Korridor, 6. Der Nordseekorridor, 7. Der Schwarzmeerkorridor und 8. Der baltische Korridor. Die Abb. 33 enthält zusätzlich Markierungen, welche die Lage des hier betrachteten Länderfokus kennzeichnet und einen Überblick verschafft, welche Korridore für diese von strategischer Relevanz sind.
- Der baltische Korridor: Die wachsende Bedeutung des Baltikums als Produktionsstandort hängt vom Bau des TEN-T Autobahn- und Schienennetzes ab. Dieses soll die Region mit Finnland, Polen, Tschechien und Deutschland verbinden. Dieser Verteilungskorridor wird sich aufgrund erheblicher Infrastrukturinvestitionen voraussichtlich eher langfristig entwickeln.
- Der mitteleuropäische Korridor: Der Ausbau der TEN-T Autobahnen- und Eisenbahnverbindungen hat den Vertrieb entlang dieses bestehenden Korridors bereits verbessert. Sollte der Korridor schließlich bis nach Norditalien reichen, könnte er an die ursprüngliche „blaue Banane“ angeschlossen werden.
- Der Schwarzmeerkorridor: Ein künftiger Verteilungskorridor, der mit der „Banane“ Mitteleuropas verbunden sein wird, sobald der Zweig des TEN-T Eisenbahnnetzes Rhein- Donau, das Budapest mit dem Schwarzen Meer verbindet, fertiggestellt ist.
Abbildung 33 lässt die günstige Lage der betrachteten Ländergruppe, vor dem Hintergrund der erwarteten Entwicklungen einiger der zukünftigen Logistikkorridore, erkennen. Serbien ist hierbei das einzige Land, dass sich lediglich in der Nähe der aufgezeigten Korridore befindet, von diesen jedoch noch nicht gekreuzt wird. Die restlichen Länder werden voraussichtlich allesamt jeweils von mindestens einem der Korridore gekreuzt (Cushman & Wakefield, 2019).
4.6 Internationale Handelsabkommen und Präferenzsysteme
4.6.1 Internationale Handelsabkommen und Präferenzsysteme Serbiens
Das Land Serbien verfügt über eine Reihe von internationalen Handelsabkommen und profitiert zudem von verschieden Präferenzsystemen. Die Handelsabkommen öffnen dem Land einen Markt von mehr als 280 Mio. Verbrauchern, zieht man die Länder, die Serbien in seinem Präferenzsystem berücksichtigt hinzu, sind es über 1 Mrd. Verbraucher.
- Freihandelsabkommen Serbien – Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU):
Das Abkommen ist in Kraft seit dem 10. Juli 2021 und betrifft die Länder Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgistan und Russland. Es beinhaltet die zollfreie Lieferung fast aller Ursprungswaren in die EAWU für Serbien, den zollfreien Zugang zu Serbien für Produkte aus Armenien und Kirgistan sowie Zollerleichterungen in Serbien für Produkte aus Belarus, Kasachstan und Russland .
- European Free Trade Association (EFTA):
Das Freihandelsabkommen EFTA ist in Kraft seit 2010 und betrifft die Länder Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. Es beinhaltet mit wenigen Ausnahmen die zollfreie Einfuhr von gewerblichen Waren, Fisch- und Fischerzeugnissen mit Ursprung aus Serbien. Für den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen wurden zusätzlich bilaterale Abkommen geschlossen .
- Abkommen über Handel und Schifffahrt zwischen der föderalen Volksrepublik Jugoslawien (FRJ) und Japan:
Zur Vertragsunterzeichnung kommt es bereits im Jahre 1959. Das Abkommen beinhaltet die bevorzugte Behandlung aller Länder der ehemaligen jugoslawischen Republik . Bis heute, ebenfalls festgehalten im heutigen allgemeinen Präferenzsystem Japans, genießt Serbien Zollvergünstigungen .
- Freihandelsabkommen Serbien – Türkei:
Seit 2010 ist das Freihandelsabkommen zwischen Serbien und der Türkei in Kraft und beinhaltet Zollpräferenzen und Zollfreiheit für Industriewaren sowie besondere Regeln für die Einfuhr landwirtschaftlicher Produkte (Baltic-Supukovic, 2022).
- Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) mit der EU:
Das SAA ist in Kraft seit dem Jahre 2013 und regelt den freien Zugang zu EU-Märkten für nahezu alle Güter aus Serbien und den stufenweisen Zollabbau für Ursprungswaren der EU. Seit 2014 besteht Zollfreiheit für knapp 95 % aller Waren mit Präferenzursprung der EU. Ziele sind die politische Stabilisierung, die Entwicklung einer funktionierenden Marktwirtschaft, die Förderung regionaler Zusammenarbeit sowie die sukzessive Angleichung der Gesetze an EU-Vorschriften. Ein weiterer Teil des Abkommens ist die diagonale Kumulierung, was bedeutet, dass Waren den präferenziellen Ursprung eines Staates durch die dort durchgeführte ausreichende Be- oder Verarbeitung erhalten. Die Kumulierungszone konstituiert sich aus der EU, der Türkei und den westlichen Balkanländern (Baltic-Supukovic, 2022).
- Das allgemeine Präferenzsystem (APS) der USA:
Das APS der USA beinhaltet die Gewährung von Handelspräferenzen seitens der USA zur Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Vertragspartner. Hierfür erhält Serbien den zollfreien Zugang für fast 5.000 Produkte. Es handelt sich dabei überwiegend um Endprodukte, Halbfabrikate sowie bestimmte landwirtschaftliche Produkte und Rohstoffe. Als Bedingung wird vorausgesetzt, dass die Ware zu min. 35 % aus Serbien stammt und von dort aus versandt wird (Office of the United States Trade Representative, 2022; Office of the United States Trade Representative, 2020).
- Partnership, trade and cooperation Agreement: UK - Serbia
Das Abkommen ermöglicht die Fortführung eines präferenzbegünstigten Handels zwischen dem Vereinigten Königreich und Serbien und soll zudem die zukünftige politische, wie auch wirtschaftliche Partnerschaft fördern und stützen (Hoffmann & Eich, 2022).
- Open Balkan (ehemals Mini-Schengen):
Open Balkan ist eine Initiative der Länder Albanien, Nordmazedonien und Serbien. Ab dem 01. Januar 2023 fallen Grenzkontrollen im Personenverkehr weg, die Arbeitsmärkte werden schrittweise geöffnet und der regionale Handel erleichtert. Des Weiteren soll eine Zusammenarbeit im Katastrophenschutz stattfinden (Baltic-Supukovic, 2022).
4.6.2 Internationale Handelsabkommen und Präferenzsysteme der EU
Die EU hat derzeit abgeschlossene Handelsabkommen mit rund 77 Ländern von denen bereits 51 in Kraft sind (Hoffmann, 2021).
Die V4 sind Mitglieder der Europäischen Union und der Warenverkehr innerhalb der EU ist grundsätzlich frei. Verbrauchssteuerpflichtige Waren unter Steueraussetzung müssen in einem elektronischen Verfahren registriert werden (Generalzolldirektion, 2022b).
Zahlreiche Länder profitieren von den Präferenzregelungen im Warenverkehr. Diese können durch Abkommen mit einem oder mehreren Ländern oder durch autonome Rechtssetzung der EU für Ländergruppen gelten.
- Regionales Übereinkommen über die Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln:
Waren erwerben demnach den präferenziellen Ursprung eines Staates durch die dort durchgeführte ausreichende Be- oder Verarbeitung. Vertragsparteien sind dabei die EU, EFTA-Staaten, Färöer-Inseln, Teilnehmer des Barcelona-Prozesses (Algerien, Ägypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marokko, Syrien, Tunesien, Westjordanland, Gazastreifen), Teilnehmer des SAP der EU (WB6), Republik Moldau, Georgien sowie die Ukraine .
- Allgemeines Präferenzsystem für Entwicklungsländer (APS):
Die Fokussierung von Zollpräferenzen geschieht in unterschiedlichem Ausmaß auf am wenigsten entwickelte Länder oder auf Länder, die über keinen anderen präferenziellen Zugang zum EU-Markt verfügen. Vertragsparteien sind die Länder im karibischen Raum sog. CARIFORUM (CAF), Länder in Zentralafrika (CAS), Staaten des östlichen und des südlichen Afrika (ESA), Market Access Regulation- und Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Ländern des afrikanischen, karibischen und pazifischen Raumes (MAR), South African Developing Community (SADC), Assoziation der überseeischen Länder und Gebiete mit der Europäischen Union (OCT), West-Pazifik-Staaten (WPS), Zentralamerika (CAM) und der Europäische Wirtschaftsraum (EWR).
- Freihandelsabkommen EU - Japan (JEFTA):
Das Abkommen ist seit 2019 in Kraft. Über 90 % der EU-Ausfuhren genießen bereits die Zollfreiheit in Japan und der Rest soll stufenweise weiter abgebaut werden. Zahlreiche EU-Einfuhren genießen ebenfalls Zollfreiheit und auch diese sollen stufenweise weiter abgebaut werden. Weitere Vereinbarungen sind der vereinfachte Zugang für EU-Unternehmen auf den japanischen Markt sowie Vereinbarungen zum Schutz des geistigen Eigentums, zum öffentlichen Auftragswesen, zum Wettbewerbsrecht, zum Dienstleistungshandel, Subventionen, staatseigenen Unternehmen, Schutzmaßnahmen, Handelserleichterungen und zur Streitbeilegung, aber auch zur Nachhaltigkeit und kleinen und mittleren Unternehmen (Hoffmann, 2021).
- Handels- und Kooperationsabkommen (TCA):
Seit 2021 besteht ein Abkommen über den Handel und die Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich mit Präferenzregelungen in ausgewählten Bereichen (Europäische Kommission, 2022b).
- Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR):
Das Abkommen über den EWR bringt Island, Liechtenstein und Norwegen in den EU-Binnenmarkt und gewährleistet freien Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr seit Inkrafttreten des Abkommens im Jahre 1994 (Europäische Kommission, 2022a).
- Freihandelsabkommen EU – Südkorea:
Das Abkommen zwischen der EU und Südkorea tritt 2011 in Kraft. Es regelt die Zollfreiheit für bereits 98,7 % der Waren, soll nichttarifäre Handelshemmnisse beseitigen und für eine weitgehende Öffnung der Dienstleistungsmärkte auf beiden Seiten sorgen (Europäische Kommission, 2022c).
4.6.3 Die wichtigsten deutschen Handelspartner außerhalb der EU und bestehende Handelsabkommen mit der EU und Serbien
Tab. 6: Die wichtigsten deutschen Handelspartner außerhalb der EU (2021) und bestehende Handelsabkommen mit der EU und Serbien
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Kapitel 4.6.1. und 4.6.2. informieren über einige ausgewählte Handelsabkommen und Präferenzsysteme der EU und Serbiens, die für die vorliegende Arbeit und betreffende Investitionsentscheidungen von strategischer Relevanz sind. Tab. 6 verschafft einen Überblick über die zehn wichtigsten Handelspartner Deutschlands außerhalb der EU und mit diesen bereits bestehende Abkommen, sowie Abkommen, die sich noch in Verhandlung befinden. Die EU verfügt über Abkommen mit fünf der größten Handelspartner Deutschlands, während das Land Serbien über sechs Abkommen, mit diesen, verfügt. Betrachtet man nun die fünf Handelspartner mit den größten Umsätzen, stellt man fest, dass Serbien innerhalb dieser Gruppe über vier Abkommen verfügt und die EU über lediglich zwei. Ebenfalls interessant sind hier vor allem die sich noch in Verhandlung befindenden Abkommen. Kommt es zum Abschluss des Vertrages zwischen Serbien und China verfügt Serbien über Abkommen mit jedem der fünf wichtigsten Handelspartner Deutschlands außerhalb der EU. Die EU hingegen, verfügt selbst bei Abschluss des Abkommens mit den USA, über nur drei Abkommen innerhalb dieser Gruppe.
4.7 Investitionsförderung
Fallbeispiel:
Ein Großunternehmen im verarbeitenden Gewerbe plant eine Investition von 10 Mio. € zu tätigen, wobei 100 neue Arbeitsplätze für Arbeitssuchende entstehen sollen, die bereits länger als sechs Monate als arbeitslos gemeldet sind. 40 % der Investitionssumme soll in die Beschaffung neuer Technologien investiert werden. Welches der Länder bietet die größten Investitionsanreize für die besagte Investition?
Tab. 7: Die Investitionsanreize für das verarbeitende Gewerbe in den V4-Staaten und Serbien im Vergleich
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 7 vergleicht die Investitionsanreize für Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe der V4 und Serbien vor dem Hintergrund des oben beschriebenen Fallbeispiels. Serbien ist das einzige der Länder, dass neben den allgemeinen Vergünstigungen zusätzliche Vergünstigungen innerhalb seiner Freizonen bietet und über keinerlei Beihilfehöchstintensitäten für die verschiedenen Investitionsanreize verfügt. Damit stellt Serbien das Land mit den größten Investitionsanreizen für ausländische Investoren dar. Darauf folgt die Slowakei mit einem Set verschiedener Anreize und regionsabhängigen Beihilfehöchstintensitäten zwischen 30 und 50 %. Als nächstes folgt das Land Polen, welches eine Befreiung der Körperschaftssteuer in Höhe von 10-50 % (regionsabhängig) bietet. Den vierten Platz belegt Tschechien mit einer Reihe verschiedener Anreize und der maximalen Förderung von 20-40 %. Das Schlusslicht bildet das Land Ungarn, welches eine Steuerbefreiung in Höhe von 0-50 % lediglich für Holding Strukturen und Kapitalgewinne auf Aktien oder geistiges Eigentum vorsieht. Des Weiteren bestehen verschiedene Ausbildungssubventionen. Zusammenfassend lässt sich die Frage „Welches der Länder bietet die größten Investitionsanreize für die besagte Investition?“ mit Serbien beantworten (Chamber of Commerce and Industry of Serbia, 2021; Czech Invest, 2022a,b; Development Agency of Serbia, 2020; Embassy of Hungary, 2022; IHK Ostbrandenburg, 2022a; Slovak Investment and Trade Development Agency, 2022a-c).
4.8 Sonstige Indizes
Tab. 8: Der Stand politischer Transformation nach dem Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung (2020), (Indexwerte 1-10)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 8 zeigt den Stand politischer Transformation nach dem Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung, welcher anhand von Expertenbewertungen von 18 Indikatoren in fünf Kriterien zusammengefasst wird, aus denen der Indexwert als Gesamtnote berechnet wird. Die Daten lassen erkennen, dass Tschechien mit einem Indexwert von 9,30 den weitesten Stand an politischer Transformation erlebt. Darauf folgt die Slowakei mit 8,75 und Polen mit 7,50. Über den geringsten Stand an politischer Transformation verfügen die Länder Ungarn mit 6,35 und Serbien mit 6,25 (Bertelsmann Stiftung, 2022).
Tab. 9: Der globale Innovationsindex 2021 – Serbien und die V4 im Vergleich
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 9 zeigt die Innovationsfähigkeit der aufgeführten Volkswirtschaften in Form des Rangs sowie der erreichten Punktzahl im globalen Innovationsindex (GII) der World Intellectual Property Organization (WIPO). Diese bewertet jährlich die Leistungen von Innovationsökosystemen, wozu rund 80 verschiedene Indikatoren untersucht werden. Des Weiteren wird zwischen dem Rang der jeweiligen Einkommensgruppe unterschieden, welche in hohe Einkommen (insgesamt 51 Länder), obere mittlere Einkommen (insgesamt 34 Länder), untere mittlere Einkommen (insgesamt 34 Länder), und geringe Einkommen (insgesamt 13 Länder), unterteilt werden. Die Länder Tschechien, Ungarn, Slowakei und Polen werden hier in die Kategorie der Länder mit hohem Einkommen gestuft und das Ranking fällt in gleicher Reihenfolge aus. Die Volkswirtschaft Serbien hat hier mit 35,0 die niedrigste Punktzahl im GII und belegt damit den 54 Platz. Serbien wird hier jedoch in die Gruppe der Länder mit oberem mittlerem Einkommen gestuft und belegt innerhalb der Einkommensgruppe sogar den achten Platz. Des Weiteren ist Serbien das einzige der hier betrachteten Länder dessen Innovationsleistung in Leistungen über den Erwartungen des Entwicklungsstandes eingestuft wird. Die Innovationsleistung der restlichen hier betrachteten Länder wird als im Einklang mit dem Entwicklungsstand eingestuft (WIPO, 2021).
4.9 Auswertung der Analyse
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 34: Die Gewichtung der Standortfaktoren und das Ranking der Länder
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 35: Das Ergebnis des Gesamtrankings
Die Abbildungen 34 und 35 stellen das Ergebnis der vorliegenden Analyse dar. Für die Auswertung der Ergebnisse wird die Datenanalysesoftware Analytic Hierarchy Process Software von Spice Logic Inc. verwendet. Hierzu wird zuerst paarweise die Priorisierung der Standortfaktoren anhand einer Skala von 1-9 vorgenommen. Die Standortfaktoren werden dabei in drei Kategorien aufgeteilt. Die erste Kategorie sind die erfolgskritischen Standortfaktoren und die Kategorien 2. und 3. sind jeweils sechs Standortfaktoren, die gemäß der Unternehmensbefragung zur Bedeutung von Standortfaktoren für Industrie und Dienstleistungen Aussagekraft besitzen. Zusätzlich wird vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln zwischen in- und ausländischen Standorten unterschieden und priorisiert (Calahorrano, et al., 2013). Die Gewichtung erfolgt anhand der Berechnung von Eigenvektoren der Standortfaktoren in einer Matrix (siehe Tab. 10 im Anhang). Anschließend werden die Länder zu jedem Standortfaktor nach Rang bewertet und diese Bewertungen wie in Abb. 36 zu sehen zu einer Summe zusammengefasst. Zusätzlich wird eine Konsistenzprüfung durchgeführt, welche die Logik der Bewertungen zueinander bemisst und eine Aussage über die Qualität der ermittelten Entscheidung ermöglicht. Die Konsistenz soll laut dem Entwickler der hier verwendeten Methode, Thomas L. Saaty einen Wert kleiner oder gleich 0,1 betragen. Das Konsistenzverhältnis für die vorliegende Analyse beträgt 0,093. (Spice Logic Inc., 2022)
Das Land Polen punktet vor allem mit der Höhe der FDI-Zuflüsse, den Wachstumsraten des realen BIP sowie im Ease of doing Business, während die Slowakei die höchste Arbeitsproduktivität bietet. Tschechien überzeugt mit seiner Innovationsfähigkeit, dem Stand politischer Transformation sowie dem Bildungsstand im Alter zwischen 25 und 54 Jahren, während Ungarn über das mit Abstand am dichtesten ausgebaute Verkehrsnetz verfügt. In Serbien können vor allem Kosten eingespart werden, denn das Land bietet in jeder der betrachteten Kostenkategorien die niedrigsten Preise. Des Weiteren verfügt Serbien über die meisten Handelsabkommen mit den wichtigsten Handelspartnern Deutschlands außerhalb der EU, die geringste Unternehmenssteuerbelastung sowie die größten Investitionsanreize. Außerdem ist die Komplexität der Mitarbeiterfindung hier am geringsten und bietet die meisten Menschen im Alter von 20-24 Jahren, mit einem Abschluss der Sekundarstufe II oder höher. Die Auswertung der Analyse der Standortfaktoren ergibt die folgende Platzierung: 1. Serbien, 2. Polen, 3. Tschechien, 4. Slowakei, 5. Ungarn, wobei Serbien mit Abstand zu Polen, und Polen mit Abstand zu den restlichen Ländern, die Führung übernehmen, während die Bewertung für die Slowakei, Tschechien und Ungarn in ähnlicher Höhe ausfällt. Zusammenfassend kann somit die zu Beginn des Kapitels gestellte Forschungsfrage „Welches der Länder bietet das größte Investitionspotential für deutsche Produktionsunternehmen?“ mit Serbien beantwortet werden.
5 Fazit
Die Entwicklung des Welthandels und -BIP sowie die Anteile ausländischer Wertschöpfung an der inländischen Nachfrage innerhalb einer Wirtschaftsregion weisen auf den weltweiten Trend zur Regionalisierung und mögliche künftige Verlagerungen von Investitionsbeständen hin. Während zahlreiche deutsche Unternehmen (61 %) innerhalb einer Befragung der DIHK und AHK angeben zu planen ihre Produktion ins Inland zu verlagern, planen 27 % eine Verlagerung in das nähere Umfeld, nach Europa. Dies hängt unter anderem mit dem anhaltenden Fachkräftemangel in Deutschland zusammen, welcher sich insbesondere auf einige Berufe der Industrie bezieht. Die Handelsanteile Europas außerhalb der EU deuten auf eine mögliche Relevanz Osteuropas im deutschen Außenhandel, welche sich bei der Betrachtung der Anteile Osteuropas (ca. 20 %) am deutschen Außenhandelsvolumen im Zeitverlauf bestätigt. Die nähere Betrachtung des deutschen Außenhandels lässt die langjährige Handelspartnerschaft zwischen Deutschland und den Visegrád-Staaten erkennen, während die Anteile der FDI-Zuflüsse am BIP vor allem eine Region in den Vordergrund rücken, den Westbalkan. Hier befinden sich vier der sechs Länder unter den Top-5. Die Betrachtung der Entwicklung deutscher FAT im Westbalkan zeigt, dass deutsche Unternehmen seit bereits vielen Jahren zunehmend investieren. Die aufgeführten Gegebenheiten führen zum Fokus auf die Regionen Westbalkan in Kapitel zwei und vier und die Visegrád-Region ebenfalls in Kapitel vier.
Die Covid-19-Pandemie wirkt als Beschleuniger der Regionalisierung von Produktions-stätten. Eine Fragmentierung der Lieferketten wird erwartet. Entscheider in Unternehmen sowie staatlichen Organisationen sollten ihre bislang weit verzweigten Wertschöpfungsketten vermehrt auf Risiken überprüfen und anpassen, um sie bewusster steuern zu können. „Eine komplette Nationalisierung oder Regionalisierung der Lieferkette ist jedoch genauso suboptimal und risikoreich wie sämtliche Produkte aus einem Land zu beziehen“ (Bernhard, 2020). Die Reduzierung der Kosten, Distanzen und des CO2-Fußabdrucks dürfen dabei nicht das einzige Ziel sein. Vielmehr sollten künftig stabile Versorgungsnetze aufgebaut werden, die lokale und regionale Lieferanten gleichermaßen wie Bezugsquellen aus den USA, China und Europa intelligent einbinden. Der gezielte Aufbau entsprechender Redundanzen trägt maßgebend hierzu bei (Dachser SE, 2020).
Die nähere Betrachtung des Westbalkans in Kapitel zwei zeigt, dass der Handel zwischen der EU und dem Westbalkan sowie die deutschen FDI im Westbalkan seit bereits vielen Jahren einen positiven Wachstumstrend verfolgen. Das größte Investitionsvolumen innerhalb des Zeitraums 2010-2019 erhält die Region jedoch von den Niederlanden, während sich Deutschland auf Platz fünf der Top-5 Investoren befindet. Die attraktivsten Zielbranchen sind in demselben Zeitraum, mit deutlichem Abstand, das verarbeitende Gewerbe und der Finanz- und Versicherungssektor, sowie mit geringerem Abstand, der Groß- und Einzelhandel.
Die Betrachtung der gesamten Investitionsbestände der jeweiligen Länder lässt erkennen, dass Serbien mit großem Vorsprung die größten Investitionen erhält, worauf Albanien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien und der Kosovo folgen. Auch die deutschen Investitionen sind in Serbien am höchsten, worauf hier die Länder Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien, Albanien, der Kosovo und Montenegro folgen. Des Weiteren ist festzustellen, dass die Abhängigkeit von den deutschen Investitionen in Bosnien und Herzegowina am stärksten und in Albanien am geringsten ausgeprägt ist. Insgesamt weisen jedoch, bis auf Albanien, alle Länder eine hohe Abhängigkeit von deutschen Investitionen auf. Die Betrachtung der Höhe der Investitionen im Verhältnis zur Landesgröße lässt eine Korrelation zwischen diesen zwar nicht vollständig ausschließen, sie ist jedoch, wenn sehr gering. Schließlich lässt sich die in Kapitel eins gestellte Forschungsfrage „Das Investitionspotential der Länder des Westbalkan – Wohin geht der Trend?“ beantworten. Der Investitionstrend innerhalb der Region des Westbalkan geht eindeutig nach Serbien.
In Kapitel vier wird das Investitionspotential der Länder des Westbalkan anhand der Gewichtung und Bewertung von Standortfaktoren am Beispiel von Serbien im Vergleich zu den Visegrád-Staaten durchgeführt. Die Analyse zeigt klare Ergebnisse. Bei der Betrachtung der gesamtwirtschaftlichen Indikatoren erreicht Polen in allen drei Kategorien, FDI-Zuflüsse, Wachstumsraten des realen BIP und Ease of doing Business, den Bestplatz. Im Bereich des Arbeitsmarktes, bieten Tschechien in der Kategorie Bildungsniveau, Serbien mit der Komplexität der Mitarbeiterfindung und die Slowakei mit ihrer Arbeitsproduktivität die besten Gegebenheiten. Innerhalb der verschiedenen Kostenarten und Steuern sticht besonders das Land Serbien hervor und bietet die geringsten Ausgaben in allen Kategorien. Die Infrastruktur ist in Ungarn mit Abstand am besten ausgebaut und das Land bietet die größte Verkehrsnetzdichte. Des Weiteren besitzt Serbien ebenso über die attraktivste Investitionsförderung und eine größere Anzahl an abgeschlossenen Handelsabkommen mit den größten deutschen Handelspartnern außerhalb der EU, als die EU selbst. Der Stand politischer Transformation und die Innovationsfähigkeit des Landes ist in Tschechien am fortgeschrittensten. Aufholbedarf besteht für Serbien in den Bereichen Arbeitsproduktivität, Bildungsniveau sowie Verkehrsinfrastruktur. Für Tschechien sind dies die Beschäftigungskosten und für die Slowakei die Unternehmenssteuerbelastung sowie Energie- und Transportkosten. In Ungarn sind es die Komplexität der Mitarbeiterfindung, der Ease of doing Business und die Investitionsförderung, während Polen das einzige der Länder ist, welches in keiner der Kategorien den Letztplatz erreicht. Die Auswertung der Analyse ergibt folgendes Ranking: 1. Serbien, 2. Polen, 3. Tschechien, 4. Slowakei, 5. Ungarn
Abschließend lassen sich die beiden weiteren Forschungsfragen „Das Investitionspotential der Länder des Westbalkan – ein potentieller Produktionsstandort für Deutschland?“ und „Serbien und die Visegrád-Staaten im Vergleich - Welches der Länder bietet das größte Investitionspotential für deutsche Produktionsunternehmen?“ beantworten. Der Westbalkan kann durch die aufgeführten Entwicklungen und Gegebenheiten durchaus als potentieller Produktionsstandort identifiziert werden. Der Vergleich der Standortfaktoren der Westbalkan- und der Visegrád-Staaten am Beispiel von Serbien ergibt, dass Serbien das größte Investitionspotential innerhalb der betrachteten Ländergruppe aufweist.
Anhang:
Tab. 10: Die Prioritäten Kompromisse der Standortfaktoren
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 11-26: Der paarweise Vergleich der Länder je Standortfaktor
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Literaturverzeichnis
AHK Serbien: (2013), Übersicht der wichtigen Steuerarten in Serbien. Quelle: https://serbien.ahk.de/filehub/deliverFile/806d7034-7c87-45f5-9ecc-13dfe9d6650e/750682/UEbersicht_der_wichtigen_Steuerarten_in_Serbien_aktuell_Oktober_2013.doc, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
Appel, Karin: (2021), Freihandelsabkommen zwischen Serbien und der EAWU tritt in Kraft. Quelle: https://www.gtai.de/de/trade/eawu/zoll/freihandelsabkommen-zwischen-serbien-und-der-eawu-tritt-in-kraft-675080, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Baltic-Supukovic, Amira: (2022), Zoll und Einfuhr kompakt – Serbien. Bonn. Quelle: https://www.gtai.de/de/trade/serbien/zoll/zoll-und-einfuhr-kompakt-serbien-565006, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Bardt, Hubertus: (2020), Corona in der automobilen Lieferkette. Köln. Quelle: https://www.iwkoeln.de/studien/hubertus-bardt-corona-in-der-automobilen-lieferkette-472918.html, Zugriffsdatum: 03. 12 2021.
Beocontrol Logistic: (2022), Recni transport robe. Quelle: https://transportrobe.com/recni-transport/, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Bernhard, Simon: (2020), Lokal statt Global? Lieferketten im Wandel. Quelle: https://www.dachser.de/de/mediaroom/lieferketten-im-wandel-7824, Zugriffsdatum: 18.06.2022.
Bertelsmann Stiftung: (2022), Politische Transformation. Quelle: https://bti-project.org/de/index/politische-transformation, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
Bessler, Patrick: (2018), Partner auf Augenhöhe. OWC - Wachstumsmärkte. Berlin.
Brügmann, Mathias & Münchrath, Jens: (2021), Das neue Kraftwerk Europas: Drei Länder sorgen für erstaunliches Wachstum im Osten. Berlin. Quelle: https://www.handelsblatt.com/politik/international/konjunktur-das-neue-kraftwerk-europas-drei-laender-sorgen-fuer-erstaunliches-wachstum-im-osten/27372406.html#:~:text=Die%20drei%20L%C3%A4nder%20wachsen%20in,um%20fast%20sieben%20Prozent%20ein., Zugriffsdatum: 04.06.2022.
Bundesministerium der Finanzen: (2020), Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich. Berlin. Quelle: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2021-06-21-die-wichtigsten-steuern-im-internationalen-vergleich-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=9, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: (2021a), Fachkräfte für Deutschland. Quelle: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/fachkraeftesicherung.html, Zugriffsdatum: 03. 12 2021.
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: (2021b), Fakten zum deutschen Außenhandel. Berlin. Quelle: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Aussenwirtschaft/fakten-zum-deuschen-aussenhandel.pdf?__blob=publicationFile&v=20, Zugriffsdatum: 03. 12 2021.
Busch, Berthold: (2021), IW-Analysen 144: Die mittel- und osteuropäischen Staaten in der EU. Köln. Quelle: https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/IW-Analysen/PDF/2021/Analysen_Nr._144.pdf, Zugriffsdatum: 05.06.2022.
Calahorrano, Lena; Demary, Markus; Grömling, Michael; Kroker, Rolf; Lichtblau, Karl; Matthes, Jürgen; & Schröder, Christoph: (2013), Industrielle Standortqualität - Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich?. Köln. Quelle: https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/IW-Studien/PDF/Studien_Industrielle-Standortqualit%C3%A4t_oben.pdf, Zugriffsdatum: 18.06.2022.
CEIC Data: (2022), Tschechische Republik Monatliches Einkommen. Quelle: https://www.ceicdata.com/de/indicator/czech-republic/monthly-earnings#:~:text=Tschechische%20Republiks%20Monatliches%20Einkommen%20belief,Dollar%20f%C3%BCr%202021%2D09%20dar, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
Chamber of Commerce and Industry of Serbia: (2021), Benfits for Investors in the Republic of Serbia. Belgrad. Quelle: https://api.pks.rs/storage/assets/Benefits%20for%20Investors,%20june%2020211.pdf, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Cushman & Wakefield: (2019), Cushman & Wakefield Report Reveals Europe´s Eight Key Future Logistics Corridors. Quelle: https://www.cushmanwakefield.com.ua/en/cushman-wakefield-report-reveals-europes-eight-key-future-logistics-corridors, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Czech Invest: (2019), Fact Sheets. Quelle: https://www.czechinvest.org/de/Uber-CzechInvest/Download/allgemeine-Materialien, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Czech Invest: (2021), Steuersystem. Quelle: https://www.czechinvest.org/de/Unsere-Dienstleistungen/Unternehmen-in-der-Tschechischen-Republik-de/Steuersystem, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
Czech Invest: (2022a), Investitionsanreize. Quelle: https://www.czechinvest.org/de/Unsere-Dienstleistungen/Investitionsanreize, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Czech Invest: (2022b), Investitionsanreize für die verarbeitende Industrie in der Tschechischen Republlik. Quelle: https://www.czechinvest.org/getattachment/Unsere-Dienstleistungen/Investitionsanreize/Investitionsanreize-MFG_DE_2022.pdf, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Czech National Bank: (2018), Foreign Direct Investment. Quelle: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/en/statistics/bop_stat/bop_publications/pzi_books/PZI_2018_EN.pdf, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Czech Statistical Office: (2021), Dopravni infrastruktura – casove rady. Quelle: https://www.czso.cz/csu/czso/dopravni_infrastruktura_casove_rady, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Czech Statistical Office: (2022), Dopravni infrastruktura v kraji k 1.1.2022. Quelle: https://www.czso.cz/csu/xc/infrastruktura-silnicni-dopravy-v-kraji-k-1-1-2022, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Dachser SE: (2020), Lokal statt Global? Lieferketten im Wandel. Quelle: https://www.dachser.de/de/mediaroom/lieferketten-im-wandel-7824, Zugriffsdatum: 03. 12 2021.
DESTATIS: (2022), Außenhandel - Rangfolge der Handelspartner im Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland. Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Aussenhandel/Tabellen/rangfolge-handelspartner.pdf?__blob=publicationFile, Zugriffsdatum: 03. 12 2021.
Deutsche Bundesbank: (2015), Bestandserhebung über Direktinvestitionen. Quelle: https://www.bundesbank.de/resource/blob/669662/29a8442149292a854c51e129486a16e2/mL/statso10-2015-data.pdf, Zugriffsdatum: 15.03.2022.
Deutsche Bundesbank: (2019), Direktinvestitionsstatistiken. Quelle: https://www.bundesbank.de/resource/blob/804078/0280ca65f3176fceec9dc1b8dc7adb84/mL/0-direktinvestitionen-data.pdf, Zugriffsdatum: 15.03.2022.
Deutsche Bundesbank: (2020), Statistik über Struktur und Tätigkeit von Auslandsunternehmenseinheiten deutscher Investoren. Quelle: https://www.bundesbank.de/resource/blob/768894/65fd516c6e29910ba6367ac98bb45d9e/mL/statistik-outward-fats-data.pdf, Zugriffsdatum: 10. 12 2021.
Deutsche Bundesbank: (2021a), Foreign affiliates statistics (FATS). Quelle: https://www.bundesbank.de/en/statistics/external-sector/direct-investments/foreign-affiliates-statistics-fats--795240, Zugriffsdatum: 03. 12 2021.
Deutsche Bundesbank: (2021b), Foreign direct investment stock statistics. Quelle: https://www.bundesbank.de/resource/blob/799218/17635cdc364e9178f933859c8f953901/mL/statso10-2019-data.pdf, Zugriffsdatum: 15.03.2022.
Deutscher Bundestag: (2020), Die Erbschaft- und Vermögensteuer in den EU- Mitgliedstaaten und ausgewählten anderen Staaten. Quelle: https://www.bundestag.de/resource/blob/692216/040336c319946ab4b7fcd97c84c06f37/WD-4-019-20-pdf-data.pdf, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
Development Agency of Serbia: (2020), Free Zones. Quelle: http://ras.gov.rs/en/invest-in-serbia/why-serbia/free-zones, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Development Agency of Serbia: (2022), Financial Benefits and Incentives. Quelle: http://ras.gov.rs/en/invest-in-serbia/why-serbia/financial-benefits-and-incentives, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
DIHK: (2019), Konjunkturumfrage Herbst 2019. Quelle: https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/wirtschaftspolitik/konjunktur-und-wachstum/dihk-konjunkturumfrage-herbst-2019-13970, Zugriffsdatum: 03.12.2021.
DIHK: (2020), AHK World Business Outlook - Sonderumfrage zu den COVID-19 Auswirkungen. Berlin. Quelle: https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/internationales/ahk-world-business-outlook/wbo-3424, Zugriffsdatum: 03. 12 2021.
EFTA: (2009), EFTA und Serbien unterzeichnen Freihandelsabkommen. Genf. Quelle: https://www.efta.int/sites/default/files/documents/about-efta/Communiques/press%20releases%20-%20albania%20and%20serbia/serbia/EFTA-Serbia-Agreement-Signature-Press-Release-German.pdf, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Ekapija: (2022), EU: Serben kann bis zu seinem Beitritt zur Union frei mit China handeln. Quelle: https://www.ekapija.com/de/news/3581330/eu-serbien-kann-bis-zu-seinem-beitritt-zur-union-frei-mit-china, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Embassy of Hungary: (2022), Investment Incentives in Hungary. Quelle: https://doha.mfa.gov.hu/eng/page/investment-incentives-in-Hungary, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Europäische Kommission: (2022a), Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Quelle: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/de/content/abkommen-ueber-den-europaeischen-wirtschaftsraum-ewr#:~:text=Das%20Abkommen%20%C3%BCber%20den%20Europ%C3%A4ischen,(Wettbewerb%2C%20Verkehr%2C%20Energie%2C, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Europäische Kommission: (2022b), Das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Quelle: https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_de, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Europäische Kommission: (2022c), Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südkorea. Quelle: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/de/content/freihandelsabkommen-zwischen-der-eu-und-suedkorea, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Europäische Kommission: (2022d), Overview of FTA and other trade negotiations. Quelle: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Europäische Kommission: (2022e), Türkei: Zollunion und Präferenzregelungen. Quelle: https://ec.europa.eu/taxation_customs/turkey-customs-unions-and-preferential-arrangements_de, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Eurostat: (2021), Western Balkans-EU - international trade in goods statistics. Quelle: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Western_Balkans-EU_-_international_trade_in_goods_statistics&action=statexp-seat&lang=de, Zugriffsdatum: 04.01.2022.
Eurostat: (2022a), Autobahnstrecken insgesamt. Quelle: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TTR00002__custom_2532271/default/table?lang=de, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Eurostat: (2022b), Educational attainment statistics. Quelle: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Educational_attainment_statistics#Level_of_educational_attainment_by_age, 31.05.2022.
Eurostat: (2022c), Outward FATS, Hauptmerkmale – NACE Rev. 2. Quelle: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/fats_out2_r2/default/table?lang=de, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
Eurostat: (2022d), Reales BIP pro Kopf (online Datencode: SDG_08_10). Quelle: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SDG_08_10__custom_2409980/default/table?lang=de, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
Eurostat: (2022e), Wachstumsrate des realen BIP – Volumen (Online Datencode: TEC00115). Quelle: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TEC00115__custom_2409734/default/table?lang=de, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
Gawrich, Andrea & Stepanov, Maxim: (2014), German Foreign Policy toward the Visegrad Countries. Berlin. Quelle: https://dgap.org/system/files/article_pdfs/2014_17_german_foreign_policy_toward_the_visegrad_countries.pdf, Zugriffsdatum: 04.01.2022.
Generalzolldirektion: (2022a), Allgemeines Präferenzsystem. Quelle: https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/Praeferenzen/Praeferenzraeume/Allgemeines-Praeferenzsystem/allgemeines-praeferenzsystem_node.html, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Generalzolldirektion: (2022b), Das elektronische Verfahren EMCS. Quelle: https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Alkohol-Tabakwaren-Kaffee/Steueraussetzung/Befoerderung-unter-Steueraussetzung/Elektronisches-Verfahren-mit-EMCS/elektronisches-verfahren-mit-emcs_node.html, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Generalzolldirektion: (2022c), Regionales Übereinkommen über die Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln. Quelle: https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/Praeferenzen/Praeferenzraeume/Regionales-Uebereinkommen/regionales-uebereinkommen_node.html, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Getbybus: (2022a), Slowakei – Liste der Flughäfen. Quelle: https://getbybus.com/de/blog/flughaefen-slowakei/, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Getbybus: (2022b), Ungarn – Liste der Flughäfen. Quelle: https://getbybus.com/de/blog/flughaefen-ungarn/#:~:text=In%20Ungarn%20gibt%20es%20insgesamt,Flugh%C3%A4fen%20eine%20bessere%20Alternative%20sein.&text=Der%20Flughafen%20Budapest%20Ferenc%20Liszt,erw%C3%A4hnt%2C%20der%20Hauptflughafen%20in%20Ungarn, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Global Petrol Prices: (2022), Fuel prices, electricity prices, natural gas prices. Quelle: https://www.globalpetrolprices.com/countries/, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
Google Maps: (2022), Brüssel/ Berlin/ Paris/ Rom/ Amsterdam/ Wien/ Warschau/ Bern/ Madrid/ Prag/ London. Quelle: https://www.google.com/maps/?hl=de, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Grabow, Busso & Hahne, Ulf: (1995), Harte und weiche Standortfaktoren. Berlin. Quelle: https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=infothek_artikel&extra=TERRA%20EWG-Online&artikel_id=95151&inhalt=klet, Zugriffsdatum: 04.06.2022.
Gyarmathy & Partners: (2021), Gemeindesteuern in Ungarn. Quelle https://www.gyarmathy.hu/newsinsights-themen-und-informationen/gemeindesteuern-in-ungarn#:~:text=Zus%C3%A4tzlich%20zur%20K%C3%B6rperschaftsteuer%20von%209,einem%20H%C3%B6chstsatz%20von%202%25%20entrichten, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
Haas, Hans-Dieter; Neumair, Simon-Martin & Schlesinger, Dieter: (2022), Industriestandorttheorie. Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/industriestandorttheorie-37380, Zugriffsdatum: 04.06.2022.
Hermes, Oliver: (2021), OWC: Mittel- und Osteuropa Jahrbuch 2021. Berlin. S. 6f.
Hoffmann, Melanie: (2021), Die wichtigsten EU-Freihandelsabkommen im Überblick. Quelle: https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/die-wichtigsten-eu-freihandelsabkommen-im-ueberblick--541366, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Hoffmann, Melanie & Eich, Stefanie: (2022), Neue Freihandelsabkommen für das Vereinigte Königreich. Bonn. Quelle: https://www.gtai.de/de/trade/vereinigtes-koenigreich/zoll/neue-freihandelsabkommen-fuer-das-vereinigte-koenigreich-262388, https://www.gtai.de/de/trade/vereinigtes-koenigreich/zoll/neue-freihandelsabkommen-fuer-das-vereinigte-koenigreich-262388, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
IHK Ostbrandenburg: (2022a), Steuerbefreiung für neue Investitionen. Quelle: https://www.ihk.de/ostbrandenburg/zielgruppeneinstieg-gruender/polen-recht/steuerbefreiungen-fuer-neue-investitionen-4122790, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
IHK Ostbrandenburg: (2022b), Steuern in Polen. Quelle: https://www.ihk.de/ostbrandenburg/zielgruppeneinstieg-gruender/polen-recht/steuerarten-in-polen-2575734, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
International Visegrad Fund: (2021), About the Visegrad Group. Quelle: https://www.visegradgroup.eu/about/about-the-visegrad-group, Zugriffsdatum: 04. 01 2022.
Kinkel, Steffen: (2009), Erfolgsfaktor Standortplanung. Berlin. Quelle: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-540-88471-2.pdf, Zugriffsdatum: 04.06.2022.
KOFA: (2019), Fachkräftesicherung in Deutschland - diese Potenziale gibt es noch. Köln. Quelle: https://www.kofa.de/fileadmin/Dateiliste/Publikationen/Studien/Fachkraefteengpaesse_2019_2.pdf, Zugriffsdatum: 03. 12. 2021.
Kooperation International: (2022), Europa: Länder Westbalkan. Quelle: https://www.kooperation-international.de/laender/europa/europa-laender-westbalkan/, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Kreus, Arno, Lindner, Paul & von der Ruhren, Norbert: (2004), Fundamente, Kursthemen: Industrie/Dienstleistungen. Quelle: https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/29260X-6202.pdf, Zugriffsdatum: 04.06.2022.
Laenderdaten: (2022a), Serbien. Quelle: https://www.laenderdaten.info/Europa/Serbien/index.php#:~:text=Serbien%20ist%20ein%20Binnenstaat%20auf,und%20weltweit%20auf%20Rang%20113, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Laenderdaten: (2022b), Polen. Quelle: https://www.laenderdaten.info/Europa/Polen/index.php#:~:text=Das%20Land%20hat%20eine%20Gesamtfl%C3%A4che,%25)%20wohnt%20innerhalb%20der%20St%C3%A4dte, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Laenderdaten: (2022c), Slowakei. Quelle: https://www.laenderdaten.info/Europa/Slowakei/index.php#:~:text=Die%20Slowakei%20ist%20ein%20Binnenstaat,und%20weltweit%20auf%20Rang%20131, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Laenderdaten: (2022d), Tschechien. Quelle: https://www.laenderdaten.info/Europa/Tschechien/index.php, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Laenderdaten: (2022e), Ungarn. Quelle: https://www.laenderdaten.info/Europa/Ungarn/index.php#:~:text=Das%20Land%20hat%20eine%20Gesamtfl%C3%A4che,%25)%20z%C3%A4hlt%20zur%20urbanen%20Bev%C3%B6lkerung, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Laenderdaten: (2022f), Verkehr und Infrastruktur in der Slowakei. Quelle: https://www.laenderdaten.info/Europa/Slowakei/verkehr.php, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: (2022a), Länderprofil Albanien. Quelle: https://osteuropa.lpb-bw.de/albanien-laenderprofil, Zugriffsdatum: 15.03.2022.
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: (2022b), Länderprofil Bosnien und Herzegowina. Quelle: https://osteuropa.lpb-bw.de/bos-herz-laenderprofil, Zugriffsdatum: 15.03.2022.
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: (2022c), Länderprofil Kosovo. Quelle: https://osteuropa.lpb-bw.de/kosovo-laenderprofil, Zugriffsdatum: 15.03.2022.
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: (2022d), Länderprofil Montenegro. Quelle: https://osteuropa.lpb-bw.de/monegro-laenderprofil, Zugriffsdatum: 15.03.2022.
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: (2022e), Länderprofil Nordmazedonien. Quelle: https://osteuropa.lpb-bw.de/mazedonien-laenderprofil, Zugriffsdatum: 15.03.2022.
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: (2022f), Länderprofil Serbien. Quelle: https://osteuropa.lpb-bw.de/serbien-laenderprofil, Zugriffsdatum: 15.03.2022.
LAVDIS: (2022), Verejne pristavy. Quelle: https://www.lavdis.cz/vodni-cesty/verejne-pristavy, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Magyarorszag Kormanya: (2021), Tajekoztatas a külfölfröl hazatero magyar munkvallalok es csaladtagjaik szamara. Quelle: https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/download/4/fb/f1000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20a%20Magyarorsz%C3%A1gra%20visszatelep%C3%BCl%C5%91k%20sz%C3%A1m%C3%A1ra.pdf, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
Melde, Adrienne, Pohlenz, Nico & Gürges, Karl: (2015), Identifikation und Bewertung von Investorenquellmärkten und Branchen. Leipzig. Quelle: https://www.imw.fraunhofer.de/content/dam/moez/de/documents/Working_Paper/Investorenquellm%C3%A4rkte.pdf, Zugriffsdatum: 04.06.2022.
Ministry of Finance of the Czech Republic: (2022), Prehled platnych smluv. Quelle: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv, Zugriffsdatum: 15.04.2022.
Ministry of Finance in Poland: (2018), Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Quelle: https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
Ministry of Finance of the Slovak Republic: (2022), Zoznam platnych a ucinnych zmluv o zamedzeni dvojiteho zdanenia. Quelle: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/dane-z-prijmu/zmluvy-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia/zmluvy-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia/zoznam-platnych-ucinnych-zmluv-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia/, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
Ministry of Foreign Affairs of Japan: (2021), Generalized System of Preferences. Quelle: https://www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/explain.html#ORIGIN, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Ministry of Foreign Affairs of Serbia: (2022), Japan. Quelle: https://www.mfa.gov.rs/lat/spoljna-politika/bilateralna-saradnja/japan, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
National Bank of Poland: (2018), Foreign Direct Investment in Poland 2018. Quelle: https://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/publikacje/ziben/ziben.html, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Nationale Autobahngesellschaft der Slowakei: (2018), Podnikatelsky Plan 2019. Quelle: http://web.archive.org/web/20200428085239/https:/ndsas.sk/uploads/media/a39a35851b05aa27a1aeadfda2dcf185fec28b62.pdf, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
NIS Petrol: (2022), Veleprodajni cenovnik. Quelle: https://www.nisgazprom.rs/pravna-lica/veleprodaja/cenovnik/, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
OECD.Stat: (2022), FDI income by industry BMD4. Quelle: https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=64216, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Office of the United States Trade Representative: (2020), Countires eligible for GSP. Quelle: https://ustr.gov/sites/default/files/gsp/countrieseligiblegsp.pdf, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Office of the United States Trade Representative. (2022), Generalized System of Preferences. Quelle: https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-programs/generalized-system-preference-gsp#:~:text=GSP%20is%20the%20largest%20and,basic%20information%20on%20the%20program, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Optimal Banking Akademie: (2022), Vermögenssteuern in Europa. Quelle: https://www.deutscheskonto.org/de/steuertipps/vermoegenssteuer-europa/, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft: (2012), Deutscher Osthandel. Quelle: https://www.ost-ausschuss.de/sites/default/files/pm_pdf/Handelszahlen_MOE_2013.pdf, Zugriffsdatum: 05.06.2022.
Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft: (2014), Deutscher Osthandel. Quelle: https://www.ost-ausschuss.de/sites/default/files/pm_pdf/Handelszahlen-Osteuropa-2014_0.pdf, Zugriffsdatum: 05.06.2022.
Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft: (2016), Deutscher Osthandel. Quelle: http://www.ost-ausschuss.de/sites/default/files/pm_pdf/Handelszahlen%20Januar%20-%20Dezember%202016_0.pdf, Zugriffsdatum: 05.06.2022.
Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft: (2017-2020), Deutscher Osthandel. Quelle: https://www.ost-ausschuss.de/de/statistik, Zugriffsdatum: 03.12.2021.
Overhoff, Christian: (2021), Sourcingchancen auf dem Westbalkan. Bonn. Quelle: https://www.gtai.de/resource/blob/642192/1b864e45c8d6f83b4b4f0a11b2320816/IF%20Westbalkan%2021266%20neu.pdf, Zugriffsdatum: 05.06.2022.
Plovput: (2022), Medjunarodni i medjudrzavni vodni putevi u Republici Srbiji. Quelle: http://www.plovput.rs/medjunarodni-plovni-putevi, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Polish Investment & Trade Agency: (2022), Strategic location in the heart of Europe. Quelle: https://www.paih.gov.pl/Strategic_location_in_the_heart_of_Europe, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Putevi Srbije: (2022), O nama. Quelle: https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/o-nama/o-nama-content, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Putuj Sigurno: (2019), Aerodromi u Srbiji – medjunarodni, domaci i vojni aerodromi. Quelle: https://putujsigurno.rs/magazin/aerodromi-u-srbiji-medjunarodni-domaci-i-vojni-aerodromi/, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Quiring, Anja: (2021), OWC: Mittel- und Osteuropa Jahrbuch 2021. Berlin. S. 40f.
Saaty, Thomas L. & Katz, Joseph M.: (1990), How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process. Pittsburgh. Quelle: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34802958/06F167EF-B243-48ED-8C45-F7466B3136EB-WebPublishings-How_to_make_decision_AHP-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1655214198&Signature=W27pMqg9Ksxqo5WTPU2Sh1X88bfbh0GkIdqkPlqa8~e1MwIE7E-27KGEyf8tKXVQvpzRqflU7ZZTK-lbP7PPUVfojG4QYdW8MqrXQHTdCOqAKutS7hjDDgdCuWWkm0PitYkrUHx3Bg3cxBmnnUcwEvrx6LTQxo1o0U4VtYsNqrHAN5EszHF56e8BQYc9zzuDnkzCflVt8BXxw1MIBskChPgfiguEePrBLWadn35FBkbXjPuMgeVqC2hA-VCNp5nM4hslHKp6pxHi~ZXwC6ijoVTMtqq7x-E9t2zvb5GVv2g7zzSYgIG8IOiVg3t5ZGS~xGHAZ-tAlAHtXBhVK9lN2A__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Seair: (2022a), Major Ports List of serbia. Quelle: https://www.seair.co.in/foreign-country/serbia-ports.aspx, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Seair: (2022b), Major Ports List of hungary. Quelle: https://www.seair.co.in/foreign-country/hungary-ports.aspx, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Slovak Investment and Trade Development Agency: (2022a), Investent Incentives and Other Support Mechanisms. Quelle: https://www.sario.sk/en/invest/investment-incentives, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Slovak Investment and Trade Development Agency: (2022b), Investment Incentives in Slovakia. Quelle: https://sario.sk/sites/default/files/sario-investment-aid-eng-2022-02-24.pdf, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Slovak Investment and Trade Development Agency: (2022c), Regional Investment Incentives. Quelle: https://www.sario.sk/en/invest-slovakia/support-investors/regional-investment-aid, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Spice Logic Inc.: (2022), Analytic Hierarchy Process Software. Quelle: https://www.spicelogic.com/Products/ahp-software-30, Zugriffsdatum: 18.06.2022.
Statistisches Bundesamt: (2022), Exporte, Importe, Außenhandelssaldo. Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Aussenhandel/Tabellen/lrahl01.html;jsessionid=942DAC788AC49D48D918E51C51B7CC8F.live742, Zugriffsdatum: 17.06.2022
UNCTAD: (2022), Foreign direct investment Inward and outward flows and stock, annual. Quelle: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
Wagener, Jens: (2020), Logistik 2020 - Struktur- und Wertewandel als Herausforderung. Hamburg. Quelle: http://www.logistikweisen.de/wAssets/docs/ergebnisbericht-logistikweisen-2020.pdf, Zugriffsdatum: 03. 12 2021.
Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche: (2012), FDI in Central, East and Southeast Europe. Wien. Quelle: https://wiiw.ac.at/short-lived-recovery-dlp-2572.pdf, Zugriffsdatum: 15.03.2022.
Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche: (2013), FDI Report: Growth Engine Stutters. Wien. Quelle: https://wiiw.ac.at/growth-engine-stutters-dlp-2903.pdf, Zugriffsdatum: 15.03.2022.
Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche: (2014), FDI Report: Hit by Deleveraging. Wien. Quelle: https://wiiw.ac.at/hit-by-deleveraging-dlp-3261.pdf, Zugriffsdatum: 15.03.2022.
Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche: (2015), FDI Report: Recovery in the NMS, Decline in the CIS. Wien. Quelle: https://wiiw.ac.at/recovery-in-the-nms-decline-in-the-cis-dlp-3592.pdf, Zugriffsdatum: 15.03.2022.
Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche: (2016), FDI Report: Slump despite Global Upturn. Wien. Quelle: https://wiiw.ac.at/slump-despite-global-upturn-dlp-3899.pdf, Zugriffsdatum: 15.03.2022.
Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche: (2017), FDI Report: Recovery amid Stabilising Economic Growth. Wien. Quelle: https://wiiw.ac.at/recovery-amid-stabilising-economic-growth-dlp-4223.pdf, Zugriffsdatum: 15.03.2022.
Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche: (2018), FDI Report: Declines due to Disinvestment. Wien. Quelle: https://wiiw.ac.at/declines-due-to-disinvestment-dlp-4548.pdf, Zugriffsdatum: 15.03.2022.
Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche: (2019), FDI Report: Foreign Investments Mostly Robust Despite Global Downturn Shift into Services. Wien. Quelle: https://wiiw.ac.at/foreign-investments-mostly-robust-despite-global-downturn-shift-into-services-fdi-in-central-east-and-southeast-europe-dlp-4947.pdf, Zugriffsdatum: 15.03.2022.
Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche: (2020), FDI Report: Foreign Investments Hit by COVID-19 Pandemic. Wien. Quelle: https://wiiw.ac.at/foreign-investments-hit-by-covid-19-pandemic-fdi-in-central-east-and-southeast-europe-dlp-5540.pdf, Zugriffsdatum: 15.03.2022.
Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche: (2021), Getting Stronger After COVID-19: Nearshoring Potential in the Western Balkans. Wien. Quelle: https://wiiw.ac.at/getting-stronger-after-covid-19-nearshoring-potential-in-the-western-balkans-dlp-5814.pdf, Zugriffsdatum: 04.01.2022.
WIPO: (2021), Globaler Innovationsindex (2021). Globaler Innovationsindex 2021. Quelle: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/de/wipo_pub_gii_2021_exec.pdf, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
WKO: (2020), Arbeitskosten. Quelle: http://wko.at/statistik/eu/europa-einkommenarmut.pdf, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
WKO: (2021a), Arbeitskosten. Quelle: http://wko.at/statistik/eu/europa-arbeitskosten.pdf, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
WKO: (2021b), Branchenreport Slowakei. Quelle: https://www.go-international.at/export-know-how/branchenreports/slowakei-IO-anlagenbau-smart-factory.pdf, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
WKO: (2021c), Einkommen & Armutsgefährdung. Quelle: http://wko.at/statistik/eu/europa-einkommenarmut.pdf, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
WKO: (2022a), Länderprofil Serbien. Quelle: https://wko.at/statistik/laenderprofile/lp-serbien.pdf, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
WKO: (2022b), Steuersätze in den EU-Ländern. Quelle: https://www.wko.at/service/steuern/Steuersaetze_in_den_EU-Laendern.html, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
World Bank: (2022a), Business enabling environment. Quelle: https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
World Bank: (2022b), Ease of doing business rank – Poland, Serbia, Czech Republic, Slovak Republic, Hungary. Quelle: https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ?locations=PL-RS-CZ-SK-HU, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
World Bank: (2022c), Ease Of Finding Skilled Employees. Quelle: https://tcdata360.worldbank.org/indicators/hb0fb9929?country=SRB&indicator=41401&countries=POL,SVK,HUN,CZE&viz=line_chart&years=2017,2019, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
World Bank: (2022d), GDP per capita (constant LCU) – Serbia, Albania, Montenegro, North Macedonia, Kosovo, Bosnia and Herzegowina. Quelle: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KN?locations=RS-AL-ME-MK-XK-BA&start=2010, Zugriffsdatum: 31.05.2022.
World Economic Forum: (2019), The Global Competitiveness Report. S. 27f. Quelle: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
Zurfluh, Stephan: (2022), Klima, Natur und Verkehr. Quelle: https://serbien.reisen/klima-natur-und-verkehr/, Zugriffsdatum: 16.06.2022.
[...]
1 Partnerländer: Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Moldau, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Russische Föderation, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tadschikistan, Tschechien, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Usbekistan
2 2015: No Data
3 Exkl. Albanien und Montenegro
4 Daten zum Kosovo 2010-2013 und Montenegro 2018 fehlen
5 Montenegro: No Data
6 RS: FDI-Zuflüsse im Zeitraum 2010-2019
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus der Analyse in diesem Dokument?
Die Analyse konzentriert sich auf das Investitionspotential in Mittel- und Osteuropa, insbesondere auf die Visegrád-Staaten (V4) und die Westbalkanstaaten, wobei Serbien als Beispiel dient.
Welche Länder gehören zu den Visegrád-Staaten (V4)?
Die Visegrád-Staaten (V4) sind Polen, die Slowakei, Tschechien und Ungarn.
Welche Länder gehören zum Westbalkan (WB6)?
Zum Westbalkan gehören Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien.
Welche Faktoren werden bei der Analyse des Investitionspotentials berücksichtigt?
Es werden verschiedene Standortfaktoren berücksichtigt, darunter gesamtwirtschaftliche Indikatoren, Arbeitsmarktmerkmale, Kosten (Beschäftigung, Energie, Transport), Steuerbelastung, Infrastruktur, internationale Handelsabkommen, Investitionsförderung und sonstige Indizes wie Innovationsindex und Index politischer Transformation.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse in Bezug auf das Investitionspotential des Westbalkans?
Die deutschen Investitionen im Westbalkan sind stark produktionsorientiert, wobei Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien und insbesondere Serbien die beliebtesten Zielländer sind.
Welche Internationalisierungsstrategie wird in der Analyse besonders berücksichtigt?
Die Internationalisierungsstrategie der "Kostenreduktion im Niedriglohnland" wird besonders berücksichtigt.
Was ist der "Analytic Hierarchy Process" (AHP) und wie wird er in dieser Analyse eingesetzt?
Der "Analytic Hierarchy Process" (AHP) ist eine Methode zur systematischen Analyse, Gewichtung und Bewertung von Standortfaktoren. Er wird verwendet, um das Investitionspotential der einzelnen Länder zu vergleichen und zu bewerten.
Wie werden Standortfaktoren im AHP gewichtet?
Standortfaktoren werden durch paarweise Vergleiche und eine Präferenzanalyse gewichtet. Die Bewertungen werden dann in einem mathematischen Modell (Eigenvektoren) präzise gewichtet.
Welches Land bietet laut der Analyse das größte Investitionspotential für deutsche Produktionsunternehmen?
Laut der Analyse bietet Serbien das größte Investitionspotential für deutsche Produktionsunternehmen, gefolgt von Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn.
Welche Stärken hat Serbien als Investitionsstandort?
Serbien punktet besonders mit niedrigen Kosten, einer geringen Unternehmenssteuerbelastung, attraktiven Investitionsanreizen und einer vergleichsweise geringen Komplexität bei der Mitarbeiterfindung. Zudem verfügt Serbien über eine Vielzahl von Handelsabkommen mit wichtigen deutschen Handelspartnern ausserhalb der EU.
Welche Handelspartner werden betrachtet?
Es werden die wichtigsten europäischen Handelspartner im deutschen Außenhandel im Jahr 2021 betrachtet (Belgien, Italien, Frankreich, Niederlande, Österreich, Polen, Schweiz, Spanien, Tschechien und das Vereinigte Königreich).
Welche Länder der V4 haben die meisten Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland?
Tschechien und Polen verfügen über die meisten Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland.
Welche Länder haben Open Balkan (Mini-Schengen) initiiert?
Die Open Balkan Initiative wurde von den Ländern Albanien, Nordmazedonien und Serbien initiiert.
Was ist die BESTAND-Standortfaktorensystematik?
Die BESTAND-Standortfaktorensystematik ist eine Einteilung von Standortfaktoren, welche auf eine strategisch fundierte, ganzheitliche Bewertung bestehender sowie neu geplanter Projekte abzielt.
- Quote paper
- Jovana Erakovic (Author), 2022, Das Investitionspotential der Länder des Westbalkans. Ein potentieller Produktionsstandort für Deutschland?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1302901