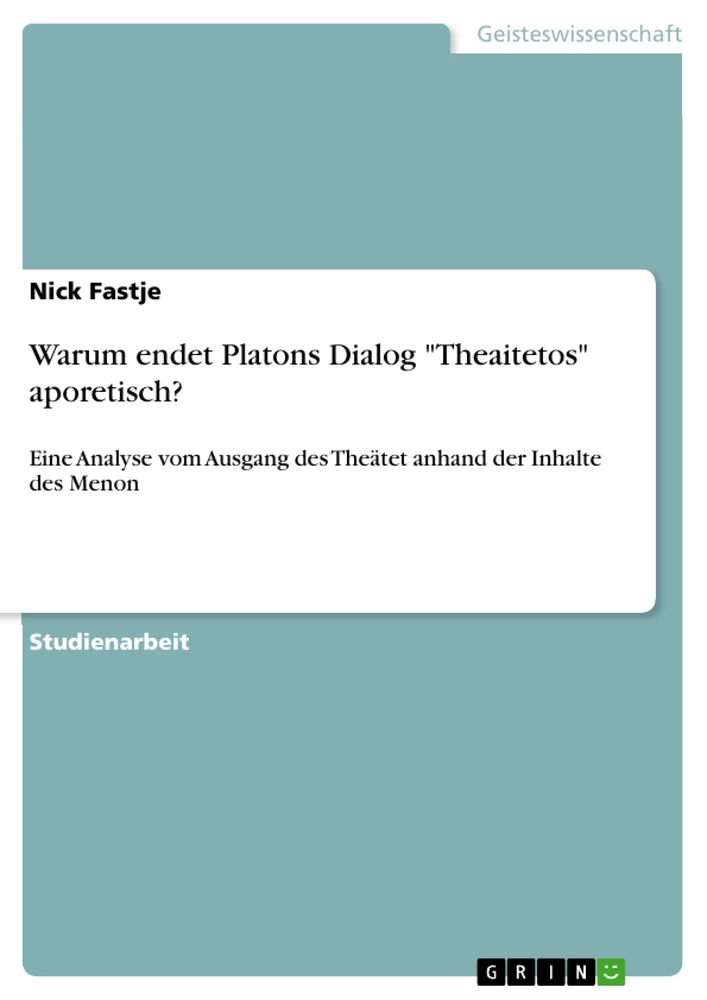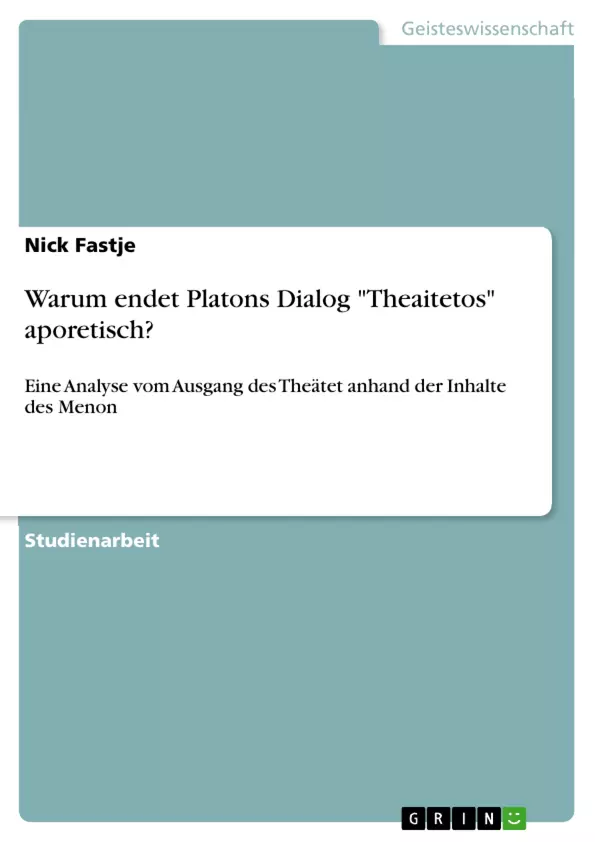In dieser Arbeit wird untersucht, wieso der Dialog Theaitetos aporetisch endet. Es stellt sich die Frage, wieso Platon einen Dialog verfasst, der die Ausgangsfrage nicht beantwortet. Im Theaitetos wird zu Beginn die Frage „Was ist Erkenntnis (έπιστήμη = episteme)“ gestellt.
(...)
Es werden drei Definitionsversuche vorgeschlagen, wie auch analysiert und von Sokrates widerlegt. Der Dialog endet damit ohne eine Definition von Wissen, also aporetisch.
Um der Frage des aporetischen Ausgangs nachzugehen, wurden Antworten in einem anderen Dialog Platons gesucht: dem „Menon“. Der Menon handelt um die Frage „Was ist Tugend (arete)“. Die Tugendfrage wird von Sokrates Gesprächsteilnehmer Menon, einem adeligen Thessalier, zu Beginn des Dialogs gestellt. Der Menon endet für die Leser*innen eher unbefriedigend, da die Lösung der Frage was Tugend sei am Ende eher als eine ironische Antwort des Sokrates verstanden werden kann.
(...)
Nach dem deskriptiven Teil sollen die Ergebnisse, Methodiken und die Verfahren, die wir aus dem Menon kennengelernt haben, genutzt werden, um das aporetische Ende des Theaitetos zu rechtfertigen. (...) Diese Erklärung nutzt für seine Rechtfertigung die Inhalte des Menon in Anwendung auf den Theaitetos. Die Methodiken und hermeneutischen Verfahren die Platon seinen Sokrates in beiden Dialogen nutzen lässt spielen dabei eine wichtige Rolle. Anhand der eingeführten Methodiken und Verfahren von Platon, soll die Absicht des aporetischen Endes des Theaitetos gedeutet werden. Am Ende wird eine mögliche Erklärung gegeben, wieso eine Aporie und eine nicht beantwortete Ausgangsfrage gewollt sein könnte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theaitetos
- 2.1 Kurze Zusammenfassung
- 2.2 Das Ende - Ein letzter Definitionsversuch (Tht. 201d-210d)
- 3. Menon
- 3.1 Kurze Zusammenfassung
- 3.2 Die Geometriestunde des Sklaven
- 3.3 Das Ende des Menon
- 4. Sokrates Methodiken - Elenchos, Mäeutik, Aporie und Anamnesis
- 4.1 Die Methodiken Sokrates im Menon
- 4.2 Methodiken im Theaitetos
- 5. Menon und Theaitetos - Der Umgang mit der Methodik Sokrates anhand des Wissensbegriffs
- 5.1 Warum der Theaitetos aporetisch enden muss
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den aporetischen Ausgang von Platons Dialog „Theaitetos“. Ziel ist es, die Intention Platons hinter dem unbefriedigend wirkenden Ende zu klären, in dem die zentrale Frage nach der Erkenntnis nicht beantwortet wird. Dazu wird der Dialog „Menon“ herangezogen, um die angewandten sokratischen Methoden und deren Rolle im Verständnis des aporetischen Endes zu beleuchten.
- Analyse des aporetischen Endes des „Theaitetos“
- Vergleichende Betrachtung der sokratischen Methoden in „Theaitetos“ und „Menon“
- Untersuchung der Definitionen von Wissen im „Theaitetos“
- Interpretation der Rolle der Aporie in Platons Philosophie
- Rekonstruktion einer möglichen Intention Platons hinsichtlich des offenen Ausgangs
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Gründen für das aporetische Ende des „Theaitetos“ dar. Sie verweist auf die Unbefriedigtheit der Leserschaft mit diesem offenen Ende und kündigt den Vergleich mit dem „Menon“ an, um eine mögliche Erklärung zu finden. Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der auf einer vergleichenden Analyse beider Dialoge basiert und die sokratischen Methoden in den Mittelpunkt stellt.
2. Theaitetos: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Übersicht über Platons „Theaitetos“, konzentriert sich aber insbesondere auf den erkenntnistheoretischen Kern des Dialogs und die drei (bzw. vier) Definitionsversuche von Wissen, die von Sokrates schrittweise analysiert und widerlegt werden. Die Zusammenfassung beleuchtet die methodische Vorgehensweise Sokrates‘, der durch Dialektik und kritische Auseinandersetzung mit den Vorschlägen Theaitetos' zu der Aporie gelangt. Besonderes Augenmerk liegt auf dem letzten, gescheiterten Definitionsversuch, der im weiteren Verlauf der Arbeit im Zusammenhang mit dem „Menon“ analysiert wird.
3. Menon: Die Zusammenfassung dieses Kapitels konzentriert sich auf die im „Menon“ behandelte Frage nach der Tugend und die darin dargestellten sokratischen Methoden wie Elenchos, Mäeutik und Anamnesis. Die Geometriestunde des Sklaven wird als Beispiel für die Anamnesis-Theorie erläutert, und das unbefriedigende Ende des Dialogs wird im Kontext der sokratischen Methode der Aporie interpretiert. Die Bedeutung der Methoden für das Verständnis des Wissensbegriffs wird herausgestellt, um den späteren Vergleich mit dem „Theaitetos“ vorzubereiten.
4. Sokrates Methodiken - Elenchos, Mäeutik, Aporie und Anamnesis: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die verschiedenen sokratischen Methoden, die im „Menon“ und „Theaitetos“ Anwendung finden. Es erklärt die Begriffe Elenchos (Widerlegung), Mäeutik (Hebammenkunst), Aporie (Verfahren der Ratlosigkeit) und Anamnesis (Erinnerung) und analysiert ihre Bedeutung für die Erkenntnisgewinnung in Platons Philosophie. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Aporie als nicht notwendigerweise negatives Ende, sondern als methodisches Instrument zur Förderung der Erkenntnis.
5. Menon und Theaitetos - Der Umgang mit der Methodik Sokrates anhand des Wissensbegriffs: Dieses Kapitel verbindet die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Kapiteln und analysiert, wie Sokrates die verschiedenen Methoden in „Menon“ und „Theaitetos“ einsetzt. Es untersucht, inwiefern die Aporie im „Theaitetos“ nicht als Scheitern, sondern als gezieltes methodisches Vorgehen interpretiert werden kann, welches durch den Vergleich mit dem „Menon“ verständlicher wird. Es wird eine Brücke zwischen den beiden Dialogen geschlagen, um den aporetischen Ausgang des „Theaitetos“ im Lichte der sokratischen Methode zu rechtfertigen.
Schlüsselwörter
Platon, Theaitetos, Menon, Erkenntnis, Wissen (epistéme), Tugend (arete), Sokrates, Elenchos, Mäeutik, Aporie, Anamnesis, Definitionsversuche, Dialoganalyse, Erkenntnistheorie, methodischer Vergleich.
Platon: Theaitetos und Menon - Eine Analyse des aporetischen Ausgangs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert den aporetischen (ohne befriedigende Lösung endenden) Ausgang von Platons Dialog „Theaitetos“. Sie untersucht die Intention Platons hinter diesem unbefriedigenden Ende und vergleicht dazu die sokratischen Methoden in „Theaitetos“ und „Menon“, um mögliche Erklärungen zu finden.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Analyse des aporetischen Endes des „Theaitetos“, einen vergleichenden Blick auf die sokratischen Methoden in beiden Dialogen, die Untersuchung der Wissensdefinitionen im „Theaitetos“, die Rolle der Aporie in Platons Philosophie und eine Rekonstruktion der möglichen Intention Platons bezüglich des offenen Ausgangs.
Welche Dialoge werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht ausführlich Platons Dialoge „Theaitetos“ und „Menon“. Der „Menon“ dient als Vergleichsdialog, um die im „Theaitetos“ angewandten sokratischen Methoden und deren Beitrag zum Verständnis des aporetischen Endes zu beleuchten.
Welche sokratischen Methoden werden untersucht?
Die Arbeit untersucht detailliert die sokratischen Methoden Elenchos (Widerlegung), Mäeutik (Hebammenkunst), Aporie (Verfahren der Ratlosigkeit) und Anamnesis (Erinnerung). Der Fokus liegt dabei auf dem Verständnis der Aporie als methodisches Instrument und nicht nur als negatives Ende.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Zusammenfassung des Theaitetos, Zusammenfassung des Menon, detaillierte Beschreibung der sokratischen Methoden, Vergleichende Analyse von Menon und Theaitetos bezüglich der sokratischen Methoden und des Wissensbegriffs, und ein Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse des jeweiligen Themas.
Was ist das zentrale Ergebnis der Arbeit?
Das zentrale Ergebnis ist die Interpretation des aporetischen Ausgangs des „Theaitetos“ nicht als Scheitern, sondern als gezieltes methodisches Vorgehen Sokrates', das durch den Vergleich mit dem „Menon“ verständlicher wird. Die Arbeit rekonstruiert eine mögliche Intention Platons hinter dem offenen Ende des Dialogs.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Platon, Theaitetos, Menon, Erkenntnis, Wissen (epistéme), Tugend (arete), Sokrates, Elenchos, Mäeutik, Aporie, Anamnesis, Definitionsversuche, Dialoganalyse, Erkenntnistheorie, methodischer Vergleich.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich akademisch mit Platons Philosophie, insbesondere mit den Dialogen „Theaitetos“ und „Menon“, auseinandersetzen möchten. Sie eignet sich besonders für Studierende der Philosophie und der klassischen Altertumswissenschaften.
- Arbeit zitieren
- Nick Fastje (Autor:in), 2022, Warum endet Platons Dialog "Theaitetos" aporetisch?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1302356