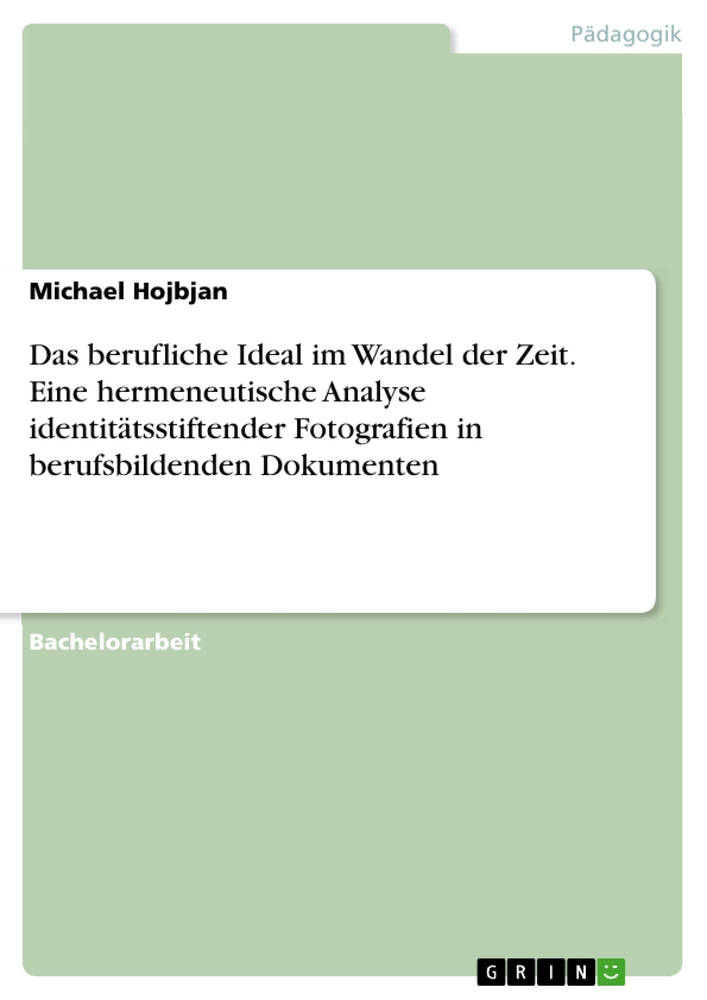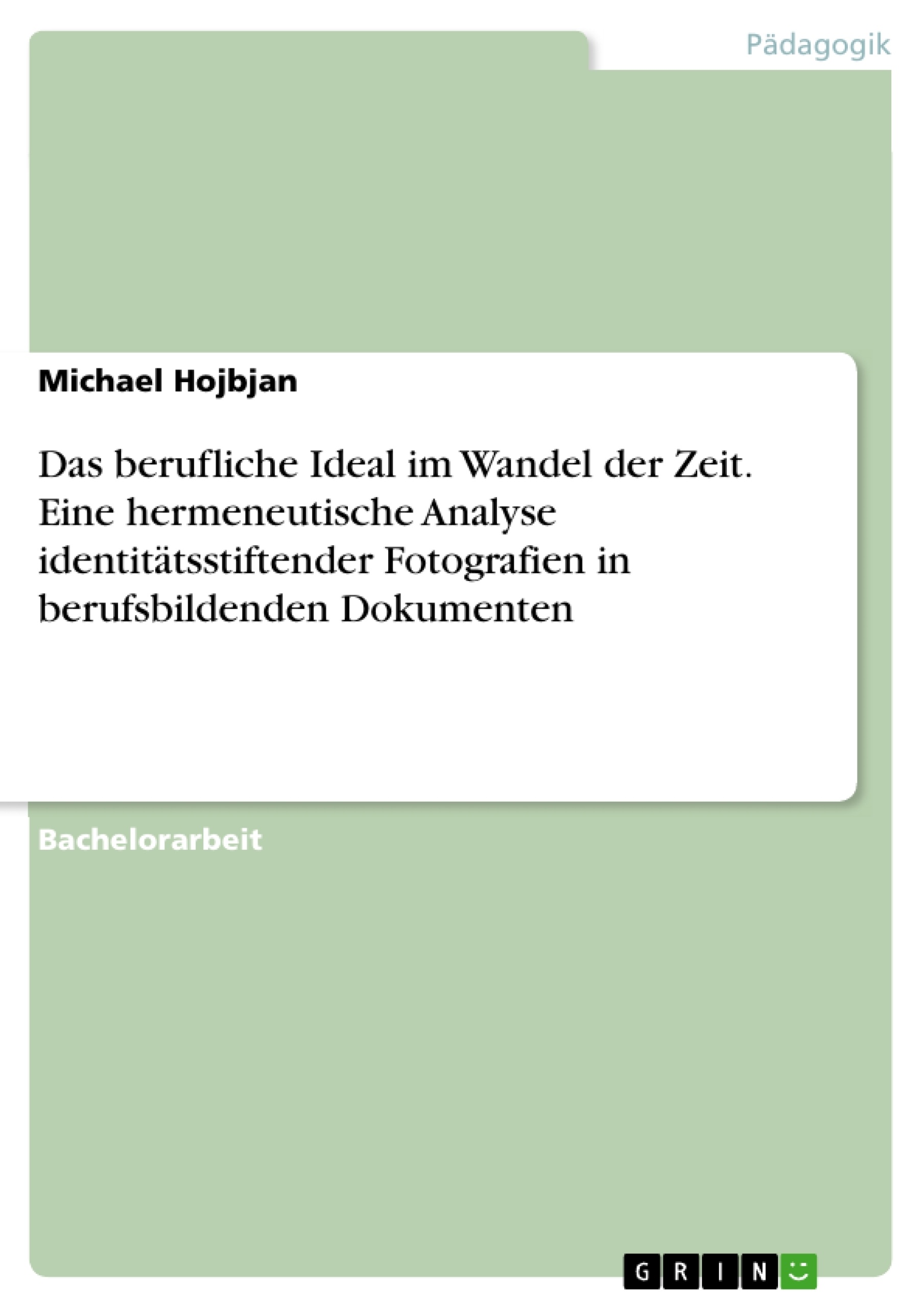Technologiesprünge und soziologische Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte bilden den Hintergrund für eine Untersuchung ihrer Auswirkungen auf die Bildung beruflicher Identität. Fotografien machen historische und berufssoziologische Hintergründe greifbar. Eine hermeneutische Analyse prägnanter Bilder aus Lehrbüchern und Berufsbildern leuchtet Merkmale aus, durch die berufliche Mythen transportiert werden. Die Logik der Sender- und Empfängerseite von Bildaussagen eröffnet die Grundlage für Rückschlüsse auf Wirkmechanismen der Identitätsbildung bzw. -findung und bietet Einblicke in Darstellung und Wahrnehmung des beruflichen Ideals. Den Vorannahmen der empirischen Untersuchung entsprechend, spiegeln die Fotografien Tendenzen von Informalisierung, Individualisierung und beruflichen Differenzierung. Beide Berufsgruppen - Krankenpflege und Elektromontage – lassen das Aufweichen beruflicher Geschlechtsspezifität erkennen. Für die Elektroberufe finden sich Hinweise auf fortschreitende Digitalisierung und dynamischer Veränderlichkeit beruflichen Selbstverständnisses, während sich die Pflegeberufe zu eigenständigen Professionen mit hohem Identifikationspotential herausgebildet haben. Das innovative Potenzial der Herangehensweise an den Untersuchungsgegenstand begründet sich in der Einbeziehung zweier grundlegend verschiedener Berufsgruppen und der bislang noch zu wenig Verbreitung findenden Methode fotografischer Bildanalyse. Die Arbeit veranschaulicht die immense Bedeutung von Abbildungen als Quelle für die empirische Bildungsforschung. Sie verdeutlicht, dass es gilt Fotografien als Gestaltungselement bei der Entwicklung von Lehrmedien die gebührende Aufmerksamkeit zu widmen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Danksagung
1 Einleitung
1.1 Leitfragen
1.2 Begriffe
1.3 Überblick
2 Berufsausbildung und Identität im Wandel
2.1 Berufsausbildung im Wandel
2.2 Berufliche Identität
2.3 Lehrbuchgestaltung
2.4 Verschlüsselte Bildnachrichten
3 Empirische Erhebungsmethode
3.1 Hermeneutische Fotoanalyse
3.2 Methode nach Beck
3.3 Quellenauswahl
3.4 Bild- und Berufswahl
4 Beschreibung der relevanten Bildmerkmale
4.1 Globalcharakteristik Krankenpflege
4.2 Globalcharakteristik Elektromontage
5 Diskussion der Ergebnisse
5.1 Schlussfolgerungen zur Krankenpflege
5.2 Schlussfolgerungen zur Elektromontage
5.3 Abstraktive Gegenüberstellung beider Berufe
6 Reflexion der Gütekriterien
7 Bildungswissenschaftliche Implikation
8 Schluss
Literaturverzeichnis
Bildnachweis
Anhang
Anhang 1: Leitfaden
Anhang 2: Auswertung
Bildanalyse 1: Operationsschwester mit Infusionsapparat 1916
Bildanalyse 2: Krankenpflegerin mit Plexiglasmaske 1984
Bildanalyse 3: Krankenpflegerin bei der Arztvisite 2014
Bildanalyse 4: Montage elektrischer Licht- und Kraftanlagen 1903
Bildanalyse 5: Berufsbild Elektromonteur 1980
Bildanalyse 6: Elektroinstallation in Wohngebäuden 2018
Abstract
Deutsch: Die Innovationssprünge und soziologischen Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte bilden den Hintergrund für die Untersuchung ihre Auswirkungen auf die Bildung beruflicher Identität. Fotografien machen historische und berufssoziologische Hintergründe greifbar. Eine hermeneutische Analyse prägnanter Bilder aus Lehrbüchern und Berufsbildern lokalisiert Merkmale, die das Potential besitzen, berufliche Mythen zu transportieren. Die Logik der Sender- und Empfängerseite von Bildaussagen eröffnet Rückschlüsse auf Wirkmechanismen der Identitätsbildung bzw. -findung und bietet Einblick in Darstellung und Wahrnehmung des beruflichen Ideals. Den Vorannahmen entsprechend, spiegeln die untersuchten Objekte Tendenzen der Informalisierung, Individualisierung und beruflichen Differenzierung. Beide Berufsgruppen - Krankenpflege und Elektromontage – lassen das Aufweichen beruflicher Geschlechtsspezifität erkennen. Für die Elektroberufe finden sich Hinweise auf Digitalisierung und dynamischer Veränderlichkeit beruflichen Selbstverständnisses, während sich die Pflegeberufe zu eigenständigen Professionen mit hohem Identifikationspotential herausgebildet haben. Die Arbeit veranschaulicht die immense Bedeutung von Abbildungen als Quelle für die empirische Bildungsforschung. Sie verdeutlicht, dass es gilt Fotografien als Gestaltungselement bei der Entwicklung von Lehrmedien die gebührende Aufmerksamkeit zu widmen.
English: The innovative leaps and sociological changes of the past decades form the background for the study of their effects on the formation of professional identity. Photographs make historical and occupational sociological backgrounds tangible. A hermeneutic analysis of concise images from textbooks and job descriptions locates features that have the potential to convey occupational myths. The logic of the sender and receiver side of image statements opens up conclusions about mechanisms of identity formation or finding and offers insight into the representation and perception of the professional ideal. In accordance with the presuppositions, the examined objects reflect ten-dencies of informalization, individualization and professional differentiation. Both occupational groups - nursing and electrical assembly - reveal the softening of occupational gender specificity. For the electrical professions, there are indications of digitalization and dynamic change in professional self-image, while the nursing professions have developed into independent professions with high identification potential. The work illustrates the immense importance of illustrations as a source for empirical educational research. It illustrates the need to give due attention to photographs as a design element in the development of educational media.
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Operationsschwester mit Infusionsapparat
Abb. 2: Allgemeine Krankenpflegerin mit Plexiglasmaske
Abb. 3: Krankenpflegerin als Mitarbeiterin bei der Arztvisite
Abb. 4: Altenpfleger im Betreuungseinsatz
Abb. 5: Montage einer Dynamomaschine
Abb. 6: Elektromonteure im Rohbau
Abb. 7: Installation eines Schaltkastens
Abb. 8: Elektroinstallation in Wohngebäuden
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Markante Beobachtungsresultate
Danksagung
An dieser Stelle sei ein besonderer Dank meiner Frau Ilona sowie den Kindern Alice und Richard gesagt, die mir über viele Monate hinweg die Umsetzung des Projekts ermöglichten.
1 Einleitung
Berufliche Tätigkeit erfüllt einen Großteil der Lebenszeit. Das macht sie identitätsprägend, sinngebend: im Idealfalle trägt sie zur Befriedigung bei. Berufsbildung ist eng mit Persönlichkeitsbildung verbunden (vgl. Gruber 2001: 188). Der nachgewiesene Zusammenhang von Berufsausbildung und Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Schallberger et al. 1983: 112; 1988: 206) prägt Auszubildende bis in die Individualbereiche (vgl. 1988: 209). Allerdings sind im Zuge jüngerer gesellschaftlicher Veränderungen sowohl Berufswelt als auch Berufsausbildung einem raschen Wandel unterworfen (vgl. Ertl 2005: 28 f.).
Wie steht es angesichts dessen mit beruflicher Identität? Wenn Arbeitsmarktfähigkeit das zunehmend gelobte Ziel beruflicher Ausbildung ist, dann verändert sich das individuelle Verhältnis zur Arbeitstätigkeit (vgl. Grote und Raeder 2004: 11). Die eindringliche Forderung bei der Entwicklung der Lehrpläne und Ausbildungsordnungen von Berufen auf ein hohes Identifikationspotential zur Erhöhung ihrer Attraktivität zu achten, erscheint daher nicht verwunderlich (vgl. Rauner 2019: S. 206). Prägnanz und Eigenständigkeit von Berufen erzeugen Idealvorstellungen, die diese attraktiv machen, bzw. jemanden dazu beeinflussen, sich für oder gegen einen bestimmten Beruf zu entscheiden. Von Interesse dabei ist das identitätsstiftende Moment, welches - im Unterbewusstsein - nachhaltig berufliches Selbstverständnis zu entfachen vermag.
Eine besondere Rolle spielen Abbildungen in Berufsbildern und Fachbüchern zur Berufsausbildung, indem sie Denkbilder erzeugen und auf das Individuum transportieren (vgl. Müller 2015: 20). Damit beeinflussen sie unweigerlich das Bild der Realität und beeinflussen die Selbstwahrnehmung (vgl. ebd.: 13). Als erste Berührungspunkte zum Beruf wirken sie nachhaltig auf künftige Fachkräfte, erzeugen Erwartungshaltungen, idealisieren Berufsbilder - „unscheinbare Details brennen sich in das Mentalbild und damit in das Gedächtnis der Bildbetrachter ein“ (ebd.: 83) - sie übertragen einen Mythos. Bislang ist in den Sozialwissenschaften der Informationswert von Illustrationen allzu oft verkannt worden (vgl. ebd.: 80). Trotz ihrer Stellung unter den „wichtigsten Informationsträgern unserer Zeit“ (Pilarczyk und Mietzner 2005: 7) und ihrem prägenden Wirken auf die Betrachtenden, verwundert die Tatsache, „dass sich die Fotografie als Forschungsquelle bisher nicht ebenso etablieren konnte wie der Text“ (ebd.). Wenn die Welt neben ihren räumlichen Berührungspunkten auch über Bilder erfahrbar ist und damit Fotografien in der Bildung eine besondere Rolle zugesprochen wird (vgl. ebd.: 19), dann ist es logische Konsequenz, diese, zur Schließung der Forschungslücke, einer näheren Untersuchung zu unterziehen. Meine Arbeit setzt hier an, womit sie einen Beitrag zur Sozialgeschichte beruflicher Idealvorstellungen leistet und den Transport von Mythen durch Fotografien in Dokumenten beruflicher Bildung analysiert. Die Ergebnisse verdeutlichen die Bedeutung von Illustrationen für die Lehrbuchgestaltung.
1.1 Leitfragen
Antworten zu folgenden Forschungsfragen sollen gefunden werden: Welche Hinweise finden sich in den Fotografien in Lehrbüchern verschiedener Jahrzehnten zur beruflichen Identität? Welche Erwartungen und Ideale werden den Lernenden kommuniziert – welche Berufsmythen transportiert? Bilder haben eine Adressaten- und eine Senderseite – daher gilt der Frage, welche Idealvorstellung vom typischen Berufsvertreter zum untersuchten Zeitpunkt bestand, besonderes Interesse, und damit: Wie veränderten sich Anforderungen und Erwartungen an künftige Fachkräfte? Unter Anforderungen seien hierbei die zur Ausübung des jeweiligen Berufs erforderlichen und mit ihm gekoppelten Fähigkeiten und Kompetenzen verstanden (vgl. Tiemann 2014: 97).
1.2 Begriffe
Fischer definiert Berufsbilder als präzise Darstellung von „Arbeitsgebiet, Anforderungen, Ausbildungsgänge und Aufstiegschancen“ (Fischer 2013: 33) in Berufsbeschreibungen. In ihrer Form als Broschüren bei berufsberatenden Institutionen stellen sie eine interessante Forschungsquelle dar, da mit ihrer Hilfe angehenden Auszubildenden der angepeilte Beruf nähergebracht wird. Sie zeichnen sich in aller Regel durch üppige Bebilderung aus.
Identität ist wortverwandt mit Identifikation und bedeutet „völlige Übereinstimmung, Gleichheit und Wesenseinheit“ (ebd.: 39). Das mittellateinische identitās ist ein Abstraktum vom lateinischen īdem (derselbe), die eine Erweiterung des lateinischen is (er, der) ist. Das entsprechende Adjektiv ist identisch, das Verb identifizieren (vgl. Kluge 1995: 393). Für die Untersuchung beruflicher Identität ist das Moment der Passung relevant – inwieweit stimmen die suggerierten Erwartungen in Berufsbildern mit beruflicher Realität überein? Gelingt es aufgrund authentischer Beschreibungen Identität zu stiften? Aber auch in Bezug auf Fotografien: Wie eng stimmen Abbild und Denkbild überein (vgl.: Müller 2015: 20)? Hierbei lassen sich motivationale Schlüsse zur Adressaten- und Senderseite ziehen. Kulturelle Identität ist in diesem Zusammenhang das „erworbene (gelernte) Selbstverständnis eines Individuums, einer Gruppe oder Nation im Hinblick auf Werte, Fähigkeiten und Gewohnheiten“ (Stubenrecht 1999: 584), was die Bedeutung der Prämisse einer Existenz beider Seiten – der Adressat*innen und der Sender*innen - für die Entwicklung von (beruflicher) Identität unterstreicht.
Persönlichkeitsentwicklung stellt die Entfaltung des Individuums dar. Ein Aspekt dieser Entwicklung sind die Herausbildung von Identitätsbewusstsein und Charakter. Dieser Prozess ist in der Jugendzeit besonders ausgeprägt, wodurch beruflicher Bildung und -profilierung, nach langer und relativ einheitlicher Schulausbildung, eine besondere Rolle für die menschliche Entfaltung zufällt. Der Beruf, als angepeiltes Lebensziel Jugendlicher, steht für „Persönlichkeitsentfaltung, Integration und Internalisierung von Normen“ (Bühler 2005: 212).
Der Begriff Mythus (griech. Mythos) (vgl. Schoeck 1972: 237) ist mit dem Aspekt von Konstruktion verbunden: Der Mythos ist „das Resultat einer sich auch in der Moderne noch vollziehenden Mythisierung (›neue Mythen‹) im Sinne einer Verklärung von Personen, Sachen, Ereignissen oder Ideen zu einem Faszinosum von bildhaftem Symbolcharakter“ (Stubenrecht 1999: 271). Auf die Soziologie bezogen sind Mythen Ideenkomplexe, Ideologien, die aufgrund ihrer Vieldeutigkeit oft in irrationaler Weise Gruppen solidarisieren und anspornen (vgl.: Schoeck 1972: 237). Berufsmythen sind somit Vorstellungen über Berufe, die auf Informationen in berufsbildender Literatur und Berufsbildern mit allen ihren begleitenden Informationen (Bilder eingeschlossen) konstruiert werden. Sie „versprechen Geborgenheit und gewährleisten Stabilisierung, Identität und Integration in einem kulturellen und sozialen Kontext“ (Stubenrecht 1999: 273). Angehende Fachkräfte sind bei ihren ersten Wahrnehmungen des anvisierten Berufs besonders empfänglich für alles, was ihre künftige Identität ausmachen wird und dieser Aspekt ist auch Autor*innen von Berufsbildern und Fachbüchern bewusst. Dieser Zeitpunkt ist für das Wirken des Initialfunken für Berufsmythen optimal. Berufe sind einerseits etwas allgemein Bekanntes (jeder weiß, was ein Schneider, Bäcker, Apotheker ist), andererseits ist Laien die eigentliche Arbeit (die konkreten Abläufe, Anforderungen und Fachwissen) unbekannt: Ein Spannungsfeld, in dem Berufsmythen ihre Wirkungskraft entfalten. Im Vorfeld der Ausbildung ist das Element der Mythisierung am größten, da sich die Berufsanwärter*innen vom Hörensagen, in ihrer Phantasie, ein gedankliches Bild ihrer Zukunft machen. Im Laufe der Ausbildung tritt anstelle des Mythos, bei der Identitätsbildung durch Lernen und Erfahrung, zunehmend berufliche Realität.
1.3 Überblick
Ausgehend von Gesichtspunkten des Wandels der Arbeitswelt, beleuchtet Abschnitt 2 die wissenschaftliche Sicht auf Berufsbildung. Stichworte sind der Qualifizierungsdiskurs und der neuzeitliche Begriff der Kompetenz. Nach einem Blick auf unterschiedliche Sichtweisen zur Identität, wird der Forschungsstand zu Lehrbuchgestaltung und Bildanalyse erschlossen. Im Anschluss geht Abschnitt 3 auf die Methodik der empirischen Arbeit ein. Es folgt die theoretische Begründung der Wirkungsweise von Bildern, worauf die Hermeneutik als qualitatives Verfahren näher beschrieben wird. Zur Operationalisierung wurde die Methode Becks verwandt. Worin bestehen die Besonderheiten dieser Methode? Was macht sie für vorliegendes Projekt geeignet? Der Abschnitt schließt mit Begründungen zur Auswahl der Bildquellen und der Berufskategorien. Abschnitt 4 beschreibt die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevanten Besonderheiten der einzelnen Bilder und resümiert Überlegungen aufgrund der Globalcharakteristik aller Bilder. In Abschnitt 5 wird Raum geschaffen, um die Beobachtungsergebnisse zur beruflichen Identität kritisch zu diskutieren, relevante Theorien werden einbezogen und beide Berufsgruppen miteinander verglichen. Das methodische Vorgehen reflektiert Abschnitt 6, wobei Gütekriterien besondere Beachtung finden. Der vorletzte Abschnitt widmet sich der Frage nach praktischen Anwendungsfeldern für die Rückschlüsse aus den Forschungsergebnissen, also dem Sinn und Nutzen der Arbeit. Abschließend werden die Analyseresultate zusammengefasst und damit die Antwort auf die Forschungsfragen pointiert geliefert, das methodische Vorgehen reflektiert und Ausblick auf künftige Forschungsfelder geboten.
2 Berufsausbildung und Identität im Wandel
2.1 Berufsausbildung im Wandel
Seit Beginn der industriellen Revolution lässt sich die Entwicklung der Arbeitswelt unter anderem durch „fortschreitende Technisierung“, „Anwachsen der Betriebsgrößen“, „strukturellen Wandel im Beschäftigtenaufbau“ und „zunehmende fachliche und funktionsmäßige Spezialisierung“ (Baumann 1956: 100) charakterisieren. In jüngster Zeit finden sich in der Literatur zur Beschreibung der Arbeitskultur Stichworte wie „Vernetzung, Entgrenzung und Prekarisierung“ (Groth et al. 2020: 12) - Zeitdiagnosen, deren Einflüsse ebenso wie Rationalisierungsprozesse bis auf Ebene „des Alltags“ (ebd.) und „der Individuen“ (Gruber 2001: 28) einwirken. Es verwundert kaum, dass auch Berufsbilder von diesen Tendenzen berührt sind (vgl. Groth et al. 2020: 14). Aus den Berufen als „der einstigen Sinnquelle schlechthin“ (Bühler 2005: 52), wurde „ein kaum fassbares Gehäuse für die persönliche Entfaltung und Selbstverwirklichung“ (ebd.).
An einige Stationen der Berufsausbildung auf dem Weg in Moderne und Postmoderne soll in Knappheit erinnert werden. Ein erstes markantes Datum ist das Jahr 1869. Die Gewerbeordnung trat in Kraft, durch welche die Befugnis Lehrlinge auszubilden nicht mehr an einen besonderen Befähigungsnachweis gebunden war; Lehrlinge wurden der erzieherischen Gewalt des Lehrherren unterworfen – zwischen Hausarbeit, beruflicher Ausbildung und Arbeit wurde kein Unterschied gemacht, ein Fakt von immenser Relevanz für die Identitätsbildung (vgl. Pätzold et al. 2015: 53). Infolge fortschreitender Industrialisierung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, wurde die Qualifizierung der Industriearbeiterschaft, die bislang aus qualifizierten Handwerkern und Ungelernten bestand, zunehmend problematisch (vgl. ebd.: 49). Um den Anforderungen der Produktion an fachliches Können und moralische Erziehung der Belegschaft gerecht werden zu können, wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Facharbeiterausbildung für die Industrie aufgebaut (vgl. ebd.: 68 f.). Die Jahre bis zum Ende des Ersten Weltkrieges waren vom Ausbau der Aus- und Weiterbildung in den Lehrwerkstätten von Großbetrieben gekennzeichnet; 1908 wurde in Solingen eine überbetriebliche Gemeinschaftslehrwerkstätte gegründet, die ähnliche Ziele verfolgte, wie die heutige Berufsausbildung (vgl. ebd.: 1). Noch herrschte kein einheitliches Lehrlingsrecht, vielerorts erfolgte berufliche Ausbildung nicht in geordneten Lehrverhältnissen, zunehmend verlor sich die familiäre Prägung der Ausbildung (vgl. ebd.: 90). 1926 wurde in Verbindung mit dem "Deutschen Ausschuss für Technisches Schulwesen" (DATSCH) und führenden wirtschaftlichen Organisationen der Arbeitsausschuss für Berufsausbildung gegründet, dessen Hauptziele in der industriellen Berufsausbildung und der Abgrenzung der Berufsbilder bestand (vgl. ebd.: 91). Die NS-Politik der 1930er und 1940er Jahre betrachtete die reichseinheitlich eingeführte Lehrlingsrolle als ein von wehrwirtschaftlichen Strategien abhängiges Kontrollinstrument, durch das sich Nachwuchs lenken und erziehen ließ (vgl. ebd.: 99). Beruf und Arbeit wurden zu identitätsprägenden ideologischen Begriffen von außerordentlichem Stellenwert für die Berufsbildung; bislang noch bestehende Mängel in der Ausbildung wurden während der Diktatur aus dem Weg geräumt (vgl. ebd.: 100). Nachdem in den Wiederaufbaujahren der jungen Bundesrepublik die Ausbildung nach Mustern, wie sie vor der NS-Diktatur bestanden, restauriert wurde (vgl. ebd.: 106), bildete das Berufsbildungsgesetz von 1969 einen weiteren Meilenstein 1969. Dieses hatte die Stärkung der Chancen der Arbeitnehmer, weitere Normierung der Ausbildung und die „Verbesserung der Anpassungsfähigkeit des Berufsbildungssystems an den technologischen und strukturellen Wandel“ (ebd.: 108) zum Ziel. Die Folgejahre waren von Modernisierungsdiskussionen zur Rationalisierung des Dualen Systems geprägt (vgl. Pätzold et al. 2015: 112). Schlüsselqualifikationen, Lernortkooperation, Handlungsorientierung und der Kompetenzdiskurs sind Stichworte, welche unter dem Druck technologischer Veränderungen die Anpassungsbemühungen zu entsprechender beruflicher Bildung bestimmten (vgl. ebd.: 113). Am 1. April 2005 trat das Berufsbildungsreformgesetz in Kraft, dessen Zielsetzung die Sicherung der Ausbildungschancen und die Qualität der beruflichen Ausbildung junger Menschen war. Jüngster markanter Entwicklungsschritt war die Einführung des Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen, der am 1. Mai 2013 in Kraft trat (vgl. ebd.: 3). Nunmehr ist, auch angesichts der zunehmenden Zahl privater beruflicher Bildungsinstitutionen auf internationaler Ebene, eine bessere Einordung und Vergleichbarkeit beruflicher Qualifikationsstufen erreicht.
Diese Rückschau auf die letzten 150 Jahre zeigt, dass je nach wirtschaftlicher Interessenlage Berufsbildung Diversifikation zu berücksichtigen hatte, häufig begleitet vom Entstehen neuer Spezialisationsrichtungen, aber auch beeinflusst vom Aussterben von Fertigkeiten, Wissen und ganzer Berufe, bzw. dessen Verlagerung in andere Erdteile. Diffusion moderner Technologien führte zu stetig schneller werdendem Verlust des Wertes individuell erworbener beruflicher Bildung (vgl. Stolz und Camenzind 1992: 43). Einen bemerkenswerten Beweis für politischen Einfluss auf die Berufsbildung liefert nicht nur die NS-Zeit: Als in der DDR 1975 per Gesetz die „Zahl der Handwerksberufe von rund hundertfünfzig auf dreiundsechzig“ (Pätzold et al. 2015: 113) reduziert wurde, führte dies zum nahezu völligen Verschwinden der betroffenen Berufe. Mit Verweis auf ausbildende Handwerksmeister*innen, die zu jener Zeit mit ihrer Qualifikation nichts mehr anfangen konnten, wird die Kopplung von persönlicher und beruflicher Identität plastisch erfahrbar.
Berufliche Bildung, und damit Identitätsbildung, unterlag zudem Paradigmenwechseln in Bezug auf die verwendeten Leitbegriffe. Der Verwertungslogik beruflicher Bildung folgend, lag - nach dem in den 1960er Jahren noch diffus erscheinenden Bildungsbegriff - in den 1970er und 1980er Jahren der Fokus auf Qualifikation (womit Arbeitsaufgaben erfüllt werden können); dem Begriff entsprechend wurden Lernaktivitäten durch Erfüllen jeweils spezifischer Anforderungen zu Qualifikationen zusammengefasst (vgl. Ertl 2005: 25 f.). Nach dem schnellen Gehaltsverlust des Mitte der 1980er-Jahre eingeführten Begriffs der Schlüsselqualifikation (vgl. Reetz 1999: 35), entstehen auch beim, seit den 1990er Jahren (vgl. Ertl 2005: 28) zunächst mit großen Hoffnungen versehenen, Kompetenzbegriff Schwierigkeiten bei der empirischen Bedarfserfassung (vgl. ebd.: 30). Als im breiten Stil verwendetes „Modewort“ (Ertl und Sloane 2005: 4), droht ihm zunehmend inflationärer Sinnverlust. Tatsächlich ist es schwierig, den Anforderungen eines stetig komplexer werdenden Systems gerecht zu werden (vgl. Botkin et al. 1981: 25). Individualisierung (vgl. Beck 1986) und Informalisierung (vgl. Wouters 2007) sind Erklärungsansätze von Tendenzen, die eine Anpassung der Individuen an das Arbeitsumfeld begründen. Womit Grundsatzfragen in den Fokus rücken. Welche Anforderungen können an Bildung gestellt werden? Welche müssen gestellt werden? Eine Position stimmt nachdenklich: „Die Schule hat aus Bildung Schulbildung gemacht“ (Hentig 2009: 45). Wie steht es dann mit beruflicher Bildung? Sie sieht sich beschriebener Unsicherheitsproblematik konfrontiert, bei der es interpretationsbedürftiges Expertenwissen erschwert, effiziente Lösungen zu finden (vgl. Kurtz 2010: 16).
2.2 Berufliche Identität
Obwohl das Feld beruflicher Identität bereits gut erforscht ist, gibt es noch Lücken in der qualitativen Untersuchung des Verhältnisses, welches Individuen zu ihren Berufen unterhalten (vgl. Bühler 2005: 9), auch existiert nur wenig Literatur zur Homogenität von Berufen (vgl. Tiemann 2014: 81). Auf das Jahr 1983 datiert eine Längsschnittstudie an Jugendlichen, die deren Persönlichkeitsveränderungen vor dem Hintergrund der erfassten Ausbildungs- und Arbeitsmerkmale analysiert (vgl. Schallberger et al. 1983: 2). Eine Frage bestand darin, inwiefern sich die Merkmale der Maskulinität, Feminität und Androgynie während der Berufslehre verändern (vgl. ebd.: 69 f.). Beim maskulinen Selbstbild wirkte signifikant berufliche Sozialisation: die weiblichen Lehrlinge in Männerberufen wurden maskuliner; bezüglich Feminität kam es eher zu einer Verwischung, wobei diese bei männlichen Lehrlingen in Frauenberufen massiv abnahm, was ein Hinweis dafür ist, dass sie Schwierigkeiten darin haben, berufliche Anforderungen mit dem Selbstbild abzustimmen (vgl. ebd.: 70). Die Zusammenhänge von Berufsausbildung und Persönlichkeitsentwicklung konnten in sämtlichen Einzelanalysen belegt werden (vgl. ebd.: 112; Schallberger et al. 1988: 206). Die Auswirkungen der Berufsausbildung reichen weit über berufsbezogene Aspekte hinaus in die gesamte individuelle Persönlichkeit (vgl. ebd.: 209). Damit gehört „die Berufsausbildung zu den wichtigsten Determinanten des Entwicklungsgeschehens im Jugendalter“ (ebd.).
Lempert untersucht Sozialisation durch Lehrpersonen beruflicher Schulen (vgl. 2002: 160 ff.) und Ausbildende in Betrieben (vgl. ebd. 144 ff.). Analysiert werden vier Berufe: Gärtnerlehre, Schilder- und Lichtreklameherstellerin, Schiffbaulehre, Industrieelektroniker (vgl. ebd.: 17 ff.). Die Absolvent*innen der Ausbildung werden als “‘Produkte’ der beschriebenen Bedingungen und Verläufe beruflicher Sozialisation“ betrachtet“ (ebd.: 28), wobei die Fragestellung auf Strukturen und Prozessen liegt, auf denen die Veränderungen basieren (vgl. Lempert 2002: 28). Fischer sieht den Lernort Praxis als wichtigsten Einflussfaktor für Identitätsentwicklung (vgl. 2013: 289). Identität ist „etwas Dynamisches, Veränderliches, was die Person höchstpersönlich und individuell gestaltet“ (Fischer 2013: 106). Triebfeder ist die Relation zu anderen, dessen Person nachgeahmt wird (vgl. ebd.: 107). Es existiert ein enger Zusammenhang zwischen beruflicher Identität und der Entwicklung von Handlungskompetenz, die ihrerseits Ausbildungserfolg und Dauer des Verbleibs im Beruf begünstigt (vgl. ebd.: 269).
Bühler sieht aufgrund ihrer Untersuchungen die Begründung einer starken subjektiven Berufsbindung in Abhängigkeit vom jeweiligen Berufsfeld, in dessen Kultur der Arbeitsethos für die Weitergabe grundlegender Handlungsweisen und Einstellungen zentral ist (vgl. 2005: 209). Weil Berufsübertragung für Ehrgeiz und Kreativität kaum förderlich ist, kommt sie zu dem Schluss, dass sich die Übernahme des Familienberufes vielfach nicht vorteilhaft auf die Entwicklung von Identität auswirkt (vgl. ebd.: 211). Individuelles Selbstverständnis ist in der individualisierten Gesellschaft nicht mehr ausschließlich an den Beruf gebunden, was einer Schwächung des Bezuges von Beruf und Identität entspricht (vgl. ebd.: 8). Bühler geht gar einen Schritt weiter und sagt: „Die Zeit, in der die meisten Menschen sich über den Beruf definieren, scheint vorbei zu sein. Die soziologische Schlüsselkategorie für die Erklärung der sozioökonomischen Stellung der Biografie, der Betriebsbindung und der Selbstentfaltung löst sich auf.“ (ebd.: 43). Über persönliche Identifikation entscheiden nunmehr konkrete Arbeitsinhalte und berufliches Umfeld (vgl. Bühler 2007: 33).
Mansel und Kahlert erforschen die Wirkung von Arbeit auf das Individuum und sehen in Arbeitsorientierung und Auswahl des Berufes einen Kernbestandteil persönlicher Identität (vgl. 2007: 7). Es gilt als nachgewiesen, dass berufliche Tätigkeiten auf persönliche Vorlieben und „die Gestaltung der anderen Lebensbereiche“ (ebd.) wirken. Die Wahl des beruflichen Ausbildungsweges hat damit gravierenden Einfluss auf die Identitätsentwicklung (vgl. ebd.). Aufgrund des soziokulturellen Wandels und daraus resultierendem Anpassungsdrucks ist das Erreichen einer stabilen Identität gegenwärtig wenig vorteilhaft, was zählt sind „Beweglichkeit und innere Vielfalt“ (ebd.: 8). Dem lauter werdenden Ruf nach fachlicher Flexibilität der Arbeitskräfte gilt es durch in Eigenregie erworbene Qualifikation zu entsprechen (vgl. Arens et al. 2007: 204). Arens et al. analysieren Qualifizierungsbedürfnisse Lernender, die sich mit E-Learning bzw. Blended-Learning weiterbilden (vgl. ebd.: 201 ff.). Dabei wurden die Annahmen bestätigt, dass die untersuchten Lehr- bzw. Lernmethoden den Bedürfnissen nach Selbst-Rationalisierung und „dem flexiblen Umgang mit Lernprozessen bzw. dessen autonomer Organisation und Steuerung des eigenen Lernverhaltens“ (ebd.: 213) entsprechen. Die Betrachtung beschreibt Handlungsmuster „des Arbeitskraftunternehmer-Konzepts in Selbst-Kontrolle, Selbst-Ökonomisierung und Selbst-Rationalisierung“ (Arens et al. 2007: 217). Altersspezifische Abweichungen konnten nicht verzeichnet werden (ebd.).
Zahlreiche Autoren sehen in beruflicher Kompetenz und beruflicher Identität eine untrennbare Einheit (vgl. Fischer 2013: 109). Dieser Sichtweise folgend hat der Wandel von Arbeitsmethoden und -anforderungen, das Entstehen neuer, sowie die Verdrängung traditioneller Berufe zwangsläufig Einfluss auf die Identifikation des arbeitenden Individuums mit ihrem Beruf (vgl. Bühler 2005: 8). Diese, seit Beginn der industriellen Revolution verstärkt auftretenden berufssoziologischen Veränderungen, schwächen die Kopplung von persönlicher Identität und Beruf (vgl. ebd.). Aufgrund von Individualisierung wandeln sich beeinflussende Faktoren von Identitätsbildung und -erhalt (vgl. Arnold 1999: 23). Wenn Eindeutigkeit unmöglich und nicht erstrebenswert erscheint, komme es zur Abkehr von stabiler Identität, hin zu Flexibilität und innerer Vielfalt (vgl. Mansel und Kahlert 2007: 8). Sich stetig wandelnde Kompetenzanforderung drängen das Individuum zu kontinuierlicher Anpassung – Identität als solche wird dynamischer und veränderlicher (vgl. Fischer 2013: 106). Womit sich die Frage stellt: „Wie verändert sich unser Verhältnis zur Arbeit, bleibt sie Kernbestandteil unserer persönlichen Identität, auch wenn sich unsere Arbeitstätigkeiten und vielleicht sogar unsere Berufe immer häufiger ändern?“ (Grote und Raeder 2004: 11). Eine Schwächung der stabilisierenden Bedeutung des Berufs für den Lebenslauf, kann zu Identitätsverlust mit neuen Unsicherheiten und Orientierungsschwierigkeiten führen (vgl. ebd.: 12). Nicht selten wird Dissonanz zwischen der ursprünglichen Vorstellung vom Wunschberuf und beruflicher Realität spürbar (vgl. Rauner 2019: 40). Ein Grund für diese Unstimmigkeit kann darin bestehen, dass die Wahl des Berufs häufig auf „eher zufälligen und oberflächlichen Informationen“ (ebd.: 43) beruht.
Quellen solcher Wahrnehmung können Bildeindrücke aus Berufsbildern sein, in denen durch gestellte Fotografie die Gefahr besteht, dass „keine Wirklichkeit, sondern ein Ideal“ (Fuhs 2003: 47) abgebildet wird. Mitunter wird Arbeit auf gestellten Fotos „romantisiert“ (Feldmann et al. 2020: 165) dargestellt. So gerät selbst der vermeintlich sichere Vorteil des Idealfalls – Identität durch eine Ausbildung im lange angestrebten Wunschberuf zu entwickeln (vgl. Rauner 2019: 153) – ins Ungewisse. Um „Berufsverlust“ (Bühler 2005: 209) durch „Wegfallen und die Entwertung beruflicher Handlungsformen“ (ebd.) entgegenzuwirken, sei daran erinnert, dass die Attraktivität der einzelnen Berufe und ihrer spezifischen Anforderungen in Berufsbildern vom jeweiligen Identifikationspotential abhängt (vgl. Rauner 2019: 206). Offenbar wird mitunter die Zielsetzung beruflicher Identitätsentwicklung und damit verbundener Leistungsbereitschaft im Rahmen der Berufsausbildung verkannt (vgl. Rauner 2019.: 202). Dabei ist der Lernort Praxis wichtigster Einflussfaktor auf das berufliche Identitätsempfinden (vgl. Fischer 2013: 289), der dessen aktiven Entwicklungsprozess fördert (vgl. ebd.: 111). Untersuchungen ergaben, dass geschwächte berufliche Identitätsentwicklung in mangelhafter berufsorientierter Bildung gründet (vgl. Rauner 2019: 72).
Das Auftauchen stets neuer soziologischer Phänomene und technischer Innovationen, stellt Berufstätige, sich beruflich bildende Individuen, Bildungsinstitutionen und Lehrbuchverlage kontinuierlich vor Herausforderungen. Erstere fördern ihre Identität mit der zugehörigen Kompetenz und Verantwortungswahrnehmung durch die Prägnanz des Berufs zu entwickeln (vgl. Rauner 2019: 2), während Letztere sich der Veränderungen bewusst und bemüht sind, ungeachtet des Dilemmas künftige Fachkräfte professionell „auf den Umgang mit Unsicherheit und Komplexität“ (Ertl 2005: 28 f.) vorzubereiten.
Bereits die Wortbedeutung von Identität beinhaltet den Aspekt des Anderen, der Relation zu einem Vorbild (vgl. Fischer 2013: 107). Identität wird „mitgestaltet durch die sozialen Bedingungen, die persönliche Lebenssituation und die in der jeweiligen Lebensphase dominierenden Institutionen“ (Mansel und Kahlert 2007: 9). Es sind signifikant Andere, durch die Erwartungen übertragen und internalisiert werden, und die somit institutionell-identitätsbildend wirken (vgl. Luckmann und Dreher 2007: 237). Solch ein repräsentatives Vorbild als Täger des beruflichen Mythos kann – wie oben dargelegt - durchaus eine markante Fotografie in berufsbildender Literatur darstellen.
2.3 Lehrbuchgestaltung
Bislang sind weder Gestaltung noch Nutzung von Lehrbüchern umfassend erforscht worden; ein spezieller Forschungszweig für diese Medien existiert nicht (vgl. Schlösser 2012: 22). Lehrbuchforschung ist gegenwärtig weder institutionell verankert (vgl. ebd.: 24), noch „klar umrissenes Forschungsfeld“ (Fuchs et al. 2014: 21). Im Rahmen der Schulbuchforschung werden interdisziplinär quellen- und kulturhistorische, sowie Textanalyse und Medienforschung betreffende Felder bearbeitet; Aufbau, Wirkung und künftige mediale Ausstattung sind Gegenstand des Interesses (vgl. Schlösser 2012: 23). Fuchs et al. erarbeiten einen Überblick über das Feld und stellen fest, dass die historische Bildungsmedienforschung ein sehr kleines Forschungsgebiet ist (vgl. Fuchs et al. 2014: 38). Entsprechend knapp fällt in ihrem Abriss die Beschreibung der Bildliterarität als Teil der kognitionspsychologischen Aspekte der Schulbuchforschung aus (vgl. ebd.: 67 ff.). Schlösser untersucht betriebswissenschaftliche Studienliteratur anhand von Experteninterviews betriebswirtschaftlicher Lehrbuchverlage und Fragebögen an Studierende zur Feststellung ihrer Bedürfnisse (vgl. Schlösser 2012). Stöhr und Sarsted konstatieren eine Forschungslücke in Marktforschung, Kundenwünsche und Kaufauslöser (vgl. 2007: 1), wobei sie Erfolgsfaktoren für Marketingfachbücher untersuchten (vgl. ebd.: 19). Obwohl Lehrbücher entsprechend der Entwicklung technischer und grafischer Möglichkeiten bebildert wurden, fiel der Fokus lange Zeit nicht auf Fotografien als Forschungsquelle (vgl. Müller 2015: 137).
Nach anfänglichem Interesse, werden Fotografien in jüngerer Zeit in den Erziehungswissenschaften kaum noch analysiert, was einen Grund im fehlenden Beachten der Bedeutung visueller Wirkungen auf Heranwachsende und bei Bildungsprozessen hat (vgl. Pilarczyk und Mietzner 2005: 7). Ganz im Gegensatz zu Texten, die auf ihren Nachrichtenfaktor hin immer wieder Gegenstand der Forschung werden, „ist die Wirkung visuell vermittelter Informationen noch kaum erforscht“ (Müller 2015: 83). Fachbücher, durch die berufsspezifisches Wissen an berufsbildenden Schulen und in Lehrbetrieben vermittelt wird, sind eine wertvolle Quelle, den beruflichen Wandel zu untersuchen. Spezielle Aufmerksamkeit verdienen Bilder, insbesondere Fotografien, da diese sowohl Erwartungen der Leser erzeugen, als auch Intentionen von Verfasser*innen und Lehrenden abbilden. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts verwies Lichtwark auf die beidseitige erzieherische Wirkung der Fotografie (vgl. Pilarczyk und Mietzner 2005: 23).
In seinen Handbuch, einer Übersicht zur Gestaltung von Lernmaterial, erkennt Ballstaedt in Bildern den Ausdruck der Vorstellung der Autor*innen (vgl. 1997: 17): In der Fotografie kann etwas verankert sein, was dessen Autor für wichtig hält (vgl. ebd.: 202). Bilder machen Lehrmaterialien anschaulicher, visualisieren Nichtsichtbares und verbessern so Verarbeitung und Gedächtnisspeicherung (vgl. Ballstaedt und Will 1994: 48). Im Vergleich zu Beschreibungen durch Worttexte können Abbildungen „bestimmte Informationen effizienter mitteilen“ (ebd.: 49). Die positive Lehrwirkung von Bildern besteht in deren auflockernder Wirkung, gleichsam einer geschickten Einladung zum Weiterlesen (vgl. Ballstaedt 1996: 192). Fotos sind sehr realitätsnahe Abbildung, die es ermöglichen, die Wahrnehmung durch Eingrenzung des Bildausschnitts auf die Perspektive der Produzierenden zu zentrieren (vgl. ebd.: 198). Will und Weidemann sehen den Grund für die effiziente Lehrwirkung von Bildern darin, dass Lernende (im Gegensatz zu Texten) zusammengehörige Sinngehalte auf einmal – mit einem Blick – erfassen (vgl. Will und Weidemann 1994: 41). Bilder in Lehrbüchern enthalten Mitteilungen, die nach einem ersten Erkennen, gedankliches Verweilen erfordern, wobei Bildindikatoren Schlüsselstellen sind, die zum Erfassen der pädagogischen Absicht beitragen (vgl. Will und Weidemann 1994: 49). Lehrbücher als Printmedien eignen sich ideal zur pädagogischen Zielerreichung, da Bilder beliebig häufig und beliebig lange betrachtet (und zudem mit größtmöglicher Sorgfalt hergestellt und bearbeitet) werden können (vgl. ebd.: 90).
Auch Drewniak stellt „Defizite in der Text-Bild-Forschung“ (1992: 268) und in der Erforschung des Lernens mit Bildern in Texten fest, deren Ursachen in mangelnder Verknüpfung mit der kognitiven Psychologie liegen (vgl. ebd.). Ausgehend vom Verständnis des Potentials von Bildern, Verarbeitungsprozesse anzustoßen, erhebt sie die Forderung im Rahmen von Instructional Design-Ansätzen Bilder als Texten gleichgestellte Medien zu verwenden (vgl. ebd.: 278). Die bisher vernachlässigte Erforschung von Bedingungen für eine optimale Nutzung von Bildern, sowie die empirische Untersuchung der Verarbeitungsprozesse (vgl. ebd.: XII) wurde der Auslöser zweier Studien, in denen nachgewiesen werden konnte, dass „die Performanz beim Lernen mit einem computerpräsentierten illustrierten Instruktionstext insbesondere von Variablen der bildbezogenen Selbstregulation vorhergesagt werden kann“ (ebd.: 269).
Pöggeler macht mit Bezug auf Wandbilder in Klassenräumen die Feststellung, dass die intentionale Bildungswirkung von eindrucksvollen Abbildungen nicht unterschätzt werden darf (vgl. 1992b: 336). Das Bild sind als Wesensbestandteil von Sprache „Impuls eines nonverbalen Bildens“ (ebd.). Vor-Bilder (oder Bild-Ideale) visualisieren beispielhafte Verkörperungen vorbildlicher Verhaltensweisen, sittlicher Haltungen oder charakterstarke Idealbilder, deren normierende Gestaltung die Zustimmung oder Nachahmung der Betrachtenden erzeugen soll (vgl. Pöggeler 1992a: 21). Oft sind pädagogisch eingesetzte Bilder idealisiert dargestellt, indem der Nachfolgecharakter durch die Fokussierung auf die nachahmenswerte, attraktiv dargestellte, Bildinformation gelenkt wird (vgl. ebd.: 25). Winkeler untersucht das Bild des Lehrers in der Kunst des 19. Jahrhunderts (vgl. 1992: 213 ff.) und kommt zu dem Schluss, dass in der Genremalerei ein Lehrertypus des Dorfschulmeisters dominiert (vgl. ebd.: 239). Die analysierten Bilder waren konstruiert: „Wir begegnen hier nicht dem Alltag, sondern einer Wirklichkeit, die aus Elementen montiert ist nach den Regeln eines Designs bürgerlicher Prägung“ (ebd.: 240). Ihm fällt die einheitliche Gestaltung – passend zum damaligen Weltkonzept auf (vgl. ebd.: 240). Seine Schlussfolgerung ist nunmehr kaum überraschend: „Über den naiven Umgang mit Bildern, wie er auch in den Erziehungswissenschaften zum Teil noch heute üblich ist, müssen wir endlich hinauskommen. Diese Forderung bedarf keiner weiteren Begründung.“ (ebd.: 242).
Abschließend sei auf Muckenhaupts Beitrag zur integrativen Betrachtung der Kommunikationsmöglichkeiten von Text und Bild (vgl. 1986: 2) verwiesen, in dem er versucht „Haupttypen der Bildverwendung, neue Aufgabenverteilungen zwischen Text und Bild, sowie Leistungen und Grenzen sprachlicher und bildlicher Kommunikation zu identifizieren“ (ebd.: XV).
2.4 Verschlüsselte Bildnachrichten
Bilder sind für vorliegende Untersuchung zentral, denn sie spielen aufgrund ihrer, anders als in Texten, wirkenden Kraft eine besondere Rolle in Lehrbüchern: einerseits werden sie über die Wahrnehmung der Sinne anders verarbeitet, andererseits werden sie anders erinnert und im subjektiven, wie im kulturellen Gedächtnis abgespeichert (vgl. Müller 2015: 13). Die Aussagekraft von Bildern – seine Bildlichkeit - ist Resultat ihres Wesens, der im Darstellungsprozess beruht und sich damit von Wort-Texten und Gegenständen unterscheidet (vgl. Boehm 1978: 451). Tatsächlich brennen sie sich im kollektiven Gedächtnis prägnanter ein als sprachliche Ausdrucksformen (vgl. Müller 2015: 88). Während Texte durch Lesen zielgerichtet auf ihren fachlichen Informationsgehalt hin aktiv erarbeitet werden müssen, stellen Illustrationen Ruhepunkte dar, die zum Verweilen einladen. Bilder vermitteln nicht nur eine auf äußere Handlungsziele wirkende sachliche Information, sie erzeugen vielmehr durch das ihnen innenwohnende Leben eine „Idealvorstellung des eigenen Subjekts“ (Fellmann 1991: 53).
Schopenhauer sah bereits den Ursprung des Denkens in Bildern (vgl. ebd.: 9). Im Umkehrschluss lassen Bilder, die nicht nur in der Phantasie entstehen, sondern gezielt in bildender Absicht platziert wurden, wertvolle Schlüsse über die Werthaltungen, Ideale und Ziele der Autor*innen und deren tatsächliche Wirkung auf die Betrachtenden zu. Damit gewinnt die Frage an Relevanz, warum gerade dieses eine Bild – und nicht ein anderes – in einem speziellen Kontext seine Verwendung findet (vgl. Müller 2015: 15). Bilder besitzen einen entschlüsselbaren „eigenständigen Nachrichtenfaktor“ (ebd.: 91). Die Ambivalenz von Bildern (auch in Form von Fotografien), ihre Wirkweisen im Erkenntnisprozess und das von ihren erzeugte Spannungsfeld zwischen Denkbildern und Realitäten, macht sie für die Forschung interessant (vgl. ebd.: 130). Aufgrund inhärenter latenter Sinnstrukturen nimmt die Wirkung von Bildern „eine Ebene der Realität eigener Art in Anspruch“ (Oevermann et al. 1979: 381). Das Prinzip, dem visuelle Kommunikation folgt, beruht auf Assoziation, die sich auf Vorbildern gründet. Zwar sind sie als solche rational-argumentativ nicht beschreibbar, doch der Sinngehalt jener Vorbilder ist entschlüssel- und interpretierbar (vgl. Müller 2015: 22).
Im Rahmen vorliegender Arbeit werden Fotografien aus beruflichen Lehrbüchern untersucht. Die gewonnenen Rückschlüsse sollen einen neuen Blick auf Berufsbildung, die transportierten Mythen sowie Identitätsbildung eröffnen. „Das fotografische Bild muss ernst genommen werden“ (Pilarczyk und Mietzner 2005: 8), ein Umstand, dem in den Erziehungswissenschaften bislang zu wenig Rechnung getragen wurde (vgl. ebd.: 7).
Eine vergleichende Analyse der Bildgestaltung von Lehrbüchern unterschiedlicher Epochen soll die Situation, bzw. deren Entwicklung genauer beleuchten. Die gewonnenen Erkenntnisse können dazu beitragen, bei der Gestaltung von Lehrmedien die Wirkung von Fotografien auf die Stärkung beruflicher Identität sowie Aspekte der Persönlichkeits- und Charakterbildung fundierter zu berücksichtigen. Nachdem die besonderen Wirkweisen von Bildern erläutert wurden, widmet sich der nächste Abschnitt dem methodologischen Vorgehen ihrer Dechiffrierung und Deutung.
3 Empirische Erhebungsmethode
3.1 Hermeneutische Fotoanalyse
Ein Vorteil qualitativen Herangehens an den Untersuchungsgegenstand besteht darin, dass im Gegensatz zu quantitativen Methoden keine Hypothesen erforderlich sind, wodurch bei Zugang zum unbekannten Gebiet die geforderte Offenheit erreicht werden kann (vgl. Fuhs 2007: 17). Da Wirkungsweisen von Bildern auf der Inhärenz latenter Sinnstrukturen beruhen, kommt es bei der Erkundung ihrer Wirkweisen auf die „sorgfältige, extensive Auslegung der objektiven Bedeutung“ (Oevermann et al. 1979: 381) dieser Texte an. Voraussetzung dafür ist die Vorannahme, dass sich Bilder versprachlichen lassen und wie Texte behandelt und interpretiert werden können (vgl. Beck 2003: 55). Die Versprachlichung des als visuell archivierte Fixierung vorliegenden Bildes, ermöglicht eine wissenschaftliche Interpretation der Interaktionsbedeutungen solcher bildlicher Protokolle (vgl. Oevermann et al. 1979: 378). Zur Aufschlüsselung der Realität latenter Sinnstrukturen hat sich die objektive Hermeneutik als geeignetes Interpretationsverfahren erwiesen (vgl. ebd.: 381). Besonderes Merkmal der Bildhermeneutik ist ihre an der Wirklichkeit orientierte Ausrichtung, wobei für die Kultursoziologie die Stärke darin besteht, gesellschaftliche Prozesse auszuloten (vgl. Müller 2015: 138 f.). Die Hermeneutik ist „an einer Deutung des Visuellen interessiert“ (Müller 2015: 137). Sehen wird als Denkprozess verstanden - die Zielsetzung der Textanalyse besteht im Verstehen des Sinns (z.B. von in Texten verwandelter Bilder) (vgl. ebd.). Dabei ist Hermeneutik kein willkürliches Vorgehen, sondern unterliegt in ihrer Charakteristik Regeln als Grundlage der Interpretation von Texten (vgl. Ricouer 1978: 83). Eine Bedingung für das Verstehen von Inhalten besteht darin, den Text als zu konstruierendes und zu rekonstruierendes totales Ganzes zu verstehen, nicht bloß als Aneinanderreihung einzelner voneinander unabhängiger Sätze (vgl. Ricouer 1978: 102). Besondere Beachtung für die Interpretation bei der Versprachlichung visueller Dokumente verdient dabei Oevermanns konstitutive Forderung nach Verwendung einer umgangssprachlichen Ausdrucksweise (vgl. Oevermann et al. 1979: 359), was das Verstehen durch die Rekonstruktion des Textes als einheitliches Ganzes durch zirkuläres Herangehen ermöglicht (vgl. Ricouer 1978: 103). Die Gleichrangigkeit aller Elemente ist eine Regel der Erforschung: Wenn das Ganze durch das Zusammenspiel seiner Teile konstruiert wird, dann gibt es auch „keine definitive Entscheidung darüber, was wichtig sein soll, und was unwichtig, was wesentlich und was unwesentlich“ (ebd.). Der hermeneutische Zirkel besteht „in nichts anderem als in der dargestellten Beziehung von Erklären und Verstehen und von Verstehen und Erklären“ (ebd.: 117). Dieses Prinzip macht den Denk- und Forschungsstil qualitativer Forschung aus, bei dem zwar Regeln existieren, jedoch keine streng vorgegebene Normen, wodurch ein interessiert-offenes Vorgehen neue Sichtweisen ermöglicht (vgl. Fuhs 2007: 48 f.). Als bewusst und raffiniert angewandte Methode vermag die Hermeneutik den Dingen ihre Wahrheit durch das „Verstehen aus dem Willen zur Wirklichkeit zu explizieren und zu legitimieren“ (Fellmann 1991: 12). Der differenzierten Explikation von Strukturen wird dabei zentrale Bedeutung zugemessen (vgl. Oevermann et al. 1979: 386). Da diese zeitlos sind, können auch latente Sinnstrukturen untersucht und verstanden werden, die in vergangenen Epochen fixiert wurden (vgl. ebd.: 390). Die Verwendung der Begrifflichkeit der latenten Sinnstrukturen ermöglicht überdies, das „objektive Bedeutungsmöglichkeiten als real eingeführt [wurden], unabhängig davon, ob sie von den an der Interaktion beteiligten Subjekten intentional realisiert wurden oder nicht“ (ebd.: 381). Die „Probleme der Gültigkeit von Rekonstruktionen latenter Sinnstrukturen“ (ebd.: 391) wurden dadurch entschärft, dass eine erkenntnislogische Differenz dem Vorgehen objektiver Hermeneutik als einer Kunstlehre und den Verfahren im Alltagshandeln unterschieden wird (vgl. ebd.). Oevermann fordert die Kunstlehre so zu gestalten, dass „Vorkehrungen getroffen werden, die eine möglichst geringe Trübung von Urteilen der Angemessenheit erreichbar werden lassen“ (Oevermann et al. 1979: 392). Dies wird dadurch erreicht, dass die Methode den realen Reproduktionsprozess nachahmt (vgl. ebd.: 421).
Beck greift die Vorteile der objektiver Hermeneutik auf und zielt auf die Versprachlichung von Bildern, was dazu verhilft deren Sinn hermeneutisch zu entschlüsseln. Der folgende Abschnitt wendet sich seiner Methode zu.
3.2 Methode nach Beck
Bei der Erschließung des Sinngehaltes von Fotografien kann ihr Inhalt nicht einfach gesehen werden, sondern er „wird im Prozess des Sehens aus der komplexen Verschränkung erschlossen, und zwar subjektiv“ (Pilarczyk und Mietzner 2005: 120). Genannte Verschränkung existiert zwischen „oberflächlicher Textur und verstecktem Bedeutungsgehalt“ (Müller 2015: 258). Beck sieht im wirklichkeitskonstruierenden Sinngehalt der Fotografie ihren zentralen Zweck (vgl. Beck 2003: 57). Aus dem ostentativen Akt des Fotografierens schafft die darauf folgende Exteriorisierung des Fotos als Produkt zahlreiche andersartige und überdauernde Bezüge (vgl. ebd.: 58), denen im Rahmen der Analyse Bedeutungen zugewiesen werden (vgl. Müller 2015: 42). Die verwendete Methode wurde unter der Prämisse entwickelt, dass alle Mitglieder einer Gesellschaft auf ähnliche Weise sozialisiert sind und somit Bilder ähnlich wahrnehmen und befähigt sind „Fotografien in ihrem Sinngehalt bis zu einem gewissen Grade angemessen zu interpretieren“ (Beck 2003: 56). Dabei wurde davon ausgegangen, dass sich die fotografische Sicht der Urheber*innen von der Fremdvorstellung der Betrachtenden unterscheiden kann (vgl. ebd.: 55). Beide Betrachtungsweisen werden während der Untersuchung erfasst. Die implizite Aufhebung des Bezuges zu den Adressat*innen der Fotografie erlaubt eine Fremdinterpretation durch Interpretierende, die mit dem Lebensweltbezug nicht vertraut sind, insofern die Fragestellungen das hervorheben, was durch das Foto ausgedrückt wird (vgl. ebd.: 58). Das Verfahren erlaubt die selbständige Fotoanalyse – Fotos sollten „aus sich heraus“ (ebd.: 60) analysiert werden können, ohne dabei auf Informationen aus anderen Quellen zurückzugreifen (vgl. ebd.). Im Vergleich mit Textinterpretationsverfahren, ist die Analyse eines Fotos in verhältnismäßig kurzer Zeit bewältigt, die Rekonstruktion des Entstehungskontextes gestaltet sich einfach; Atmosphäre und Aktion der Entstehung der Fotografie können leichter exakt ausgedrückt werden (vgl. ebd.: 61). Aufgrund gemeinsam geteilter Sehgewohnheiten der Interpretierenden bewährte sich das Verfahren als einfaches Analysetool zur Entschlüsselung ihres Bedeutungsgehaltes von Werbefotografien (vgl. Beck 2003: 66). Da über den Grad der Plausibilität nicht unterschieden werden kann, bleibt der durch verschiedene Lesarten und Deutungsmöglichkeiten für die Analyse von Texten typische und nicht völlig ausschöpfbare Sinnüberschuss bestehen (vgl. ebd.: 67). Obwohl die Analyse in einer Gruppe - durch die Durchmischung von Interpretierenden mit spezifischen Feldkenntnissen und Außenstehenden - Vorteile verspricht, ist die Methode unter sorgfältiger Reflexion der eigenen Wahrnehmung und Deutung anwendbar (vgl. Beck 2003: 67). Die dadurch gewonnene Flexibilität schafft die Voraussetzung für sorgfältiges Vorgehen. Praxistests zeigten, dass die Interpretierenden zu besseren Erkenntnissen über thematisch zentrale Personen und deren Umfeld über den fokussierten Forschungskontext hinaus gewonnen haben (vgl. Beck 2003: 68). Dieser Aspekt war ausschlaggebend für die Wahl der Methode Becks: Gerade wenn es um die schwierige – aber wesentliche - Frage geht, Hinweise für das Identitätsgefühl von Angehörigen subjektiv fremder Berufsgruppen zu verstehen, kann die Methode zu den gewünschten Rückschlüssen verhelfen. Wesentlich einfacher ist es dagegen, aufgrund gedanklich erzeugter Bilder transportierte Berufsmythen der Adressat*innen (denn Beobachter*innen sind stets Adressat*innen) zu deuten. Beide Sichtweisen haben zentrale Funktion bei der Deutung latenter Sinnstrukturen: Fotografien in zu beruflicher Bildung verwendeten Quellen haben einen sozialisierenden Bezug (vgl. Oevermann et al. 1979: 384). „Auf diese Weise wird die Umwandlung von objektiven Verhaltensantrieben in subjektiv verfügbare Intentionen des Handelns mediatisiert“ (ebd.).
Der Beobachtungsleitfaden (vgl. Beck 2003: 62–65) besteht in seiner Grundform aus 15 Fragen, die sich innerhalb von ca. 45 Minuten pro Bild beantworten lassen (vgl. ebd.: 61). Bei der Auswertung der Fotos können relevante Aspekte aufgrund der Interpretation von vier verschiedenen Merkmalsrichtungen eines Bildes - des abgebildeten Ereignisses, der Art und Weise, wie das Foto gemacht wurde, die gedankenexperimentelle Variation des Fotos, sowie hinsichtlich des Bezug der Adressat*innen - herausgearbeitet werden (vgl. ebd. 57 f.). Eine intersubjektive Überprüfung seitens der Leserschaft ist aufgrund des umfassend dargestellten Leitfadens gewährleistet. Ein weiterer relevanter Vorteil der Methode Becks besteht in seinem Vorgehen, das unter Vorgabe der Forschungsleitfrage den Sinngehalt der Fotografien „optimal auszuschöpfen“ (ebd.: 55) vermag, wodurch sehr offen an das Material herangegangen werden kann (vgl. Beck 2003: 55); die Bilder offenbaren ihre Inhalte vom Kontext ihrer Einbindung in die Lehrbücher aus. Der Leitfaden ermöglicht eine praktikable und umfassende Verschriftlichung der erfassten Eindrücke bzw. Wirkungen.
Offenheit wird in vorliegender Arbeit dadurch erreicht, dass die Bildanalyse als Informationsquelle ins Zentrum der Betrachtung rückt. Dem Charakter qualitativen Vorgehens entsprechend, gibt die bewusst relativ weit gefasste Fragestellung, als Rahmung im Sinne einer Eingrenzung, Hinweise auf die Bearbeitung des zu untersuchenden Problemfeldes (vgl. Fuhs 2007: 50).
Angewandt auf die Analyse der Fotografien in berufsbildenden Dokumenten, wurde es aus zwei Gründen erforderlich, den Leitfaden anzupassen. Einerseits sollte die Gefahr der Redundanz verringert werden, denn einige Fragestellungen nach Beck verleiten dazu, dieselben Beobachtungen zu verschiedenen Fragepunkten zu beschreiben. Andererseits erlaubt der Rahmen meiner Arbeit die Kernpunkte zu den forschungsleitenden Fragen in den Fallanalysen im Haupttext zusammenzufassen, während Nebenbeobachtungen im Anhang zu finden sind. Damit wird dem Grundgedanken der Hermeneutik und einer knappen Extrahierung der Kernaussagen zu den Fragestellungen am ehesten entsprochen. Konkret bedeutet dies, dass einige Fragen aus Beck’s Leitfaden weggelassen wurden (Untersuchungsleitfragen; ob ein Schnappschuss vorliegt; Intention der Fotografierenden; Zweck und Adressat*innen), andere nur knapp Niederschlag fanden (körperliches Empfinden beim Nachstellungsversuch; Beschreiben der Aufnahmetechnik). Dagegen erfährt die Kontextbeschreibung, die intentionale Einbettung des Bildes in die Publikation verstärkte Beachtung, um Bildmerkmale zu den für das Forschungsinteresse zentralen Fragestellungen gezielt zu erfassen. Die Globalcharakteristik wurde direkt im Haupttext der Arbeit verankert und ist somit im Beobachtungsleitfaden überflüssig. Wo angebracht, und sofern in der Quellpublikation vorhanden, wurden Kontrastfotos in wesentlichen Merkmalen zum Vergleich der Darstellung beruflicher Identität herangezogen. Wo es der Rahmen erlaubte wurde, eine Vollerhebung aller Bilder der Publikation angestrebt, wobei speziell nach Zusatzhinweisen und Kontrastpunkten ergänzend zum umfassend analysierten Hauptbild gesucht wurde.
3.3 Quellenauswahl
Als Herkunftsquelle aussagekräftiger Fotografien kommen in erster Linie berufliche Fachbücher oder Fotos in Berufsbildern für die Berufsberatung ins Visier. Erstere hinterlassen bei der Lehrausbildung Eindrücke, die von den künftigen Fachkräften als idealtypisch wahrgenommen und damit unbewusst als Vorbild wirken, letztere dagegen beeinflussen die Entscheidung für oder gegen eine konkrete berufliche Laufbahnentscheidung auf Grundlage des entsprechenden Habitus der Interessent*innen. Diese Quellen gewinnen beiden Adressat*innen an Dynamik, wenn der Beruf plastisch greifbar wird und im Moment der persönlichen Identifikation berufliche Idealvorstellungen übertragen werden. Die Autor*innen sprechen künftige Fachleute an und zeigen idealisierte Wunschvorstellung von Arbeitgeber*innen von angehenden Berufsvertretern. Die Aussagekraft von im beruflichen Umfeld abgebildeten Personen, entfaltet als erster idealisierender Anhaltspunkt für angehende Fachleute umso größere identitätsstiftende Wirkung, insofern sie gerade in Lehrbüchern für die Berufsschule, je nach Berufsgruppe, eher selten zu finden sind – viele Fachbücher enthalten überhaupt keine Fotografien.
„Zeit und Ort sind die harten (externen) Daten der Klassifizierung“ (Pilarczyk und Mietzner 2005: 127), die als Grundlage jeglichem wissenschaftlichen Vorgehens gelten müssen (ebd.). Um einen vergleichbaren historischen und berufssoziologischen Hintergrund zu wahren, wurde als Ort wurde der deutschsprachige Raum gewählt. Als Zeitpunkte kamen jeweils eine Fotografie von vor etwa 100 Jahren in Betracht, dies entspricht einem frühen Zeitpunkt, nachdem Fotografie, Drucktechnik und Lehrbuchgestaltung entsprechende Fortschritte gemacht haben, sodass intentional berufliche Mythen über berufsbildende Dokumente übertragenen werden können. Eine weitere Quelle fällt in den Zeitraum zwischen Mitte der 1970er und Mitte der 1980er Jahre. Zu jeder Zeit befand sich die Industrialisierung bereits im fortgeschrittenen Stadium, der Qualifikationsbegriff stand hoch im Kurs und die Diversifizierung betraf viele Bereiche beruflicher Ausbildung. Die dritte Fotografie wurde dem heutigen Umfeld entnommen und bildet die gegenwärtige Situation ab, nachdem Digitalisierung, Kompetenzparadigma und Individualisierung Einzug in die Berufswelt gehalten haben.
3.4 Bild- und Berufswahl
Die Arbeit fokussiert die Berufsfelder der Krankenpflege und Elektromontage. Diese Berufsgruppen sind und waren (zu den Erscheinungszeitpunkten der untersuchten Quellen) einem breiten Publikum bekannt; es sind und waren auch Berufe, die nach erfolgter allgemeiner Schulausbildung von einem breiten Publikum angestrebt werden können und konnten. So weist der Krankenpflegebereich mit 71.300 neu begonnenen Ausbildungen im Jahre 2019 in Deutschland ein 39% Wachstum gegenüber 2009 auf (Statistisches Bundesamt 2020). Bei der Gesundheits- und Krankenpflege handelt es sich um ein hoch angesehenes Berufsfeld mit komplexen Tätigkeitsspektren, die ein hohes Identifikationspotential versprechen (vgl. Fischer 2013: 66). In den Sparten Energie-, Elektro- und Mechatronik wurden 2017 mehr als 36.200 Ausbildungsverträge abgeschlossen (vgl. Mailn et al. 2018: 21). Fachbücher und Berufsbilder beider Berufsgruppen ermöglichen durch das Vorhandensein von Bildmaterialen den gesicherten Feldzugang in den angepeilten Zeitabschnitten. Dennoch bilden beide Berufsgruppen einen gewünschten Kontrast. Pflegefachkräfte sind meist weiblich, unterstehen in der beruflichen Hierarchie den Anordnungen des Arztes und benötigen ein breites Spektrum sozialer Kompetenz. Elektrofachkräfte sind in aller Regel männlich, arbeiten oft als eigenständige Fachspezialisten u.a. im industriellen Bereich und benötigen technisch-mathematisches Verständnis. Es sind verschiedene Berufe, die zu einer grundverschiedenen beruflichen Identität führen. Die Betrachtung beider Berufe in der Analyse verspricht objektivere Ergebnisse, die zu einer allgemeingültigeren Antwort auf die Forschungsleitfragen führen.
Als für die Bildauswahl zentral gilt, dass „den Referenzbestand sowohl stilistisch als auch thematisch und motivisch repräsentieren“ (Pilarczyk und Mietzner 2005: 136). Dabei ist die Suche aufgrund der theoretischen Vorüberlegungen gelenkt, dennoch bleibt die Auswahl etwas intuitiv, denn letztlich fällt der Entscheid zugunsten einer bestimmten Fotografie aufgrund einer von ihr ausgehenden Faszination (vgl. ebd.). Für die Suche nach Hinweisen zur beruflichen Identität kommen aussagekräftige und zugleich für die Berufsgattung typische Bilder infrage, in denen genügend Potenzial zur konkreten Beantwortung der Forschungsfrage vermutet wurde (vgl. ebd.). Die Hauptanalyseobjekte wurden aufgrund ihrer dominierenden Stellung im Lehrbuch bzw. der Prägnanz der abgebildeten Berufsfachleute gewählt. Bildformat und -positionierung und gestalterische Alleinstellungsmerkmale waren wichtige Entscheidungskriterien. Im Laufe der Untersuchung zeigte sich, dass knappe ergänzende Beobachtungen zu anderen, in Maximalkontrast stehenden, Bildern aus der entsprechenden Publikation in die Betrachtung einfließen sollten (vgl. ebd.: 143). In Fällen, in denen optisch dominierende Fotografien schwer zu bestimmen waren, fiel die Auswertung ebenbürtiger Objekte der entsprechenden Publikation umfassender aus.
Untersuchungsleitend waren Aspekte des Wandels beruflicher Identität, vermittelter beruflicher Idealvorstellungen und von Berufsausbildung. Diese Überlegungen waren Voraussetzung, die Bildanalyse so offen wie möglich (fernab bereits definierter Schlüsselkriterien bzw. -reize) unter Berücksichtigung der erforderlichen Eingrenzung bzw. Fragestellung optimal auszuschöpfen (vgl. Beck 2003: 55).
Eine vergleichende Analyse der Bildgestaltung zu den verschiedenen Zeitpunkten und Professionen ermöglicht die Kategorienbildung, was dazu beiträgt die Ergebnisse zu vereinheitlichen. Nachdem das methodologische Vorgehen erläutert wurde, widmet sich der nächste Abschnitt einer Zusammenfassung der im Anhang ausführlicher dargestellten Beobachtungsergebnisse.
4 Beschreibung der relevanten Bildmerkmale
Die hier extrahierten untersuchungsrelevanten Bildmerkmale gründen auf den im Anhang ausführlich dargelegten Einzelbildanalysen, ergänzt durch vertiefende Informationen aus Bildern, die maximale Kontrasteigenschaften zur untersuchten Hauptfotografie besitzen, sowie aus dem Kontext des Lehrbuches. Zur ebenfalls im Anhang befindlichen zusammenfassenden Charakteristik der Einzelerhebungszeitpunkte folgt an dieser Stelle nun die mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden herausgearbeitete Globalcharakteristik der beiden untersuchten Berufsgruppen. Dabei werden mittels Kategorienbildung die beobachteten Merkmale im Wandel der Zeit in einen erhöhten Abstraktionsgrad zu soziologischen Theorien in Bezug gebracht.
4.1 Globalcharakteristik Krankenpflege
Gegenüberstellend betrachtet beinhalten die Publikationen der Jahre 1916, 1984 und 2014 einige Hinweise zur Entwicklung beruflicher Identität und erwarteter Idealvorstellungen an Beschäftigte der Pflegeberufe. Wurden in früheren Jahrhunderten alternde und kranke Personen vielfach von Angehörigen im familiären Mehrgenerationenhaushalt betreut, so änderte sich die Lage während des ersten Weltkrieges. Viele Männer waren an den Kriegsfronten und fehlten bei der Erfüllung von Familienpflichten. Verwundete galt es zu pflegen. Bezeichnend ist es, zu diesem Zeitpunkt auf eine reich bebilderte Publikation zu stoßen, welche die Rolle der chirurgischen Schwester jenes speziellen Umfeldes herausstellt. Es herrschte erhöhter, schnell gewachsener Bedarf in Krankeneinrichtungen und dieser sollte mit geeigneten Personen gedeckt werden, welche neu erlernte Vorgehensweisen auch im häuslichen Umfeld improvisieren konnten. Welche Merkmale lassen sich an den im Bild idealisiert dargestellten Krankenschwestern wahrnehmen? Augenfällig ist die weiße Kleidung als Symbol für Reinheit (vgl. Abb. 1). Der Blick der Akteurinnen zeugt vom persönlichen Interesse und dem Wunsch ärztliches Vorgehen zu unterstützen. Im Gesichtsausdruck der abgebildeten Krankenschwestern lassen sich auf allen anderen Bildern der Publikation, keinerlei Hinweise auf persönliche Meinungsäußerung oder Gefühlregung lesen. Zur Arbeit verwendete technische Apparate und Hilfsmittel sind als eher einfach zu bezeichnen. Im Operationssaal sind keine Apparaturen erkennbar; Hinweise auf künstliche Beleuchtung finden sich nicht. Alle Erwartungen konzentrieren sich auf die kompetente Assistenzleistung chirurgischer Schwestern, die sie Ärzten in ihrer führenden Rolle medizinischer Behandlung bieten. Eine Reihe von Fotografien der Publikation visualisieren körperlich anstrengende Arbeit. Als weitere Lesart kommt die Anleitung des Arztes bei der Ausbildung angehender chirurgischer Schwestern in Betracht. Auf allen Bildern sind chirurgische Schwestern weiblich, ärztliches Personal immer männlich (vgl. Abb. 1, A 2, A 3). Das Lehrbuch hat persönlichkeitsbildenden Charakter für eine zu jenem Zeitpunkt konjunkturerfahrende Berufsgruppe.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Janssen 1916, 192
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Kappelmüller 1984, 123 Copyright © ELSEVIER
Siebzig Jahre später sind in einem Lehrbuch für allgemeine Krankenpflege wesentlich weniger Fotografien enthalten. Auch diese Bilder bieten Anhaltspunkte zur beruflichen Identität von Pflegefachkräften. Nur sechs Bilder der durchgängig in Schwarz-Weiß gestalteten Publikation zeigen Krankenpflegerinnen bei ihrer Arbeit, die anderen 39 Fotografien bilden zum größten Teil Hilfsmittel für medizinische Behandlungen ab. Bezeichnenderweise sind auf allen Fotografien Krankenschwestern bei ihrer Tätigkeit deutlich sichtbar abgebildet, mitunter nehmen sie einen größeren Bildausschnitt ein, stets ist ihr Gesichtsausdruck gut erkennbar (vgl. Abb. 2). Hierin ist ein Unterschied zur Publikation aus dem Jahre 1916 erkennbar: Die Bedeutung der Bildbotschaften gewinnt - durch ihr größeres Format und die geringere Häufigkeit - in Relation zum Text an Gewicht. Ärztliches Personal ist nirgends mehr zu sehen. Während 1916 Krankenschwestern offenbar in ihren Beruf durch Ärzte eingeführt wurden, sind 1984 Krankenschwestern selbst Vermittlerinnen beruflicher Kenntnisse. Die Botschaft könnte folgendermaßen gelesen werden: Eine Krankenschwester ist erwartungsgemäß als Fachspezialistin mit entsprechenden Kenntnissen und Fertigkeiten vollständig handlungsfähig. Die abgebildeten technischen Utensilien sind komplexer geworden. Moderne Apparturen machen die Arbeit interessanter und abwechslungsreicher. Es gehört nunmehr zum Berufsbild nicht nur pflegerische Hilfsarbeiten auszuführen, sondern auch Apparaturen eigenständig zu nutzen und damit i. e. S. medizinisch zu arbeiten (vgl. Abb. 2). Pflegefachkräfte bilden in Erweiterung des Aufgabenspektrums ihren Nachwuchs eigenständig aus.
Der Gesichtsausdruck - im Bild vom Aufziehen einer Spritze - kommuniziert, dass bei der Berufsausübung Emotionsarbeit bewusst eingesetzt werden sollte (vgl. Abb. A 7). Es geht im Bild, und damit im vermittelten Identitätsverständnis, um das professionelle Schaffen einer dem Gesamtablauf förderlichen angenehmen Atmosphäre durch gezeigte Emotionen (vgl. Russell Hochschild 1979: 561). Die positive Ausstrahlung und das vergnügte Gesicht wirken da belebend und aufmunternd, wo Krankheiten behandelt werden und Ängste vor Spritzen vorherrschen. Tatsächlich vermitteln die beiden Fotografien wenig Inhaltsreiches zur eigentlich dargestellten Thematik; in der aufgeräumten Umgebung sind keine ablenkenden Utensilien zu sehen, sondern die Aufmerksamkeit ist auf die Persönlichkeitsmerkmale der agierenden Schwester konzentriert.
Den Kontrapunkt bildet die Zweibildserie vom Leintuchwechsel (vgl. Abb. A 8, A 9). Das, was wirklich als Herausforderung gelten kann, der heikle und ggf. anstrengende Aspekt des Transfers der bettlägerigen Person, wird von den Bildbetrachtenden weniger wahrgenommen, wohl aber die abstützend auf dem bzw. der Patient*in gehaltene Hand. Die sterile Umgebung erzeugt den Gedanken einer Erwartung an psychische Stabilität der Berufsanwärter*innen. Was über Jahrzehnte unverändert blieb, ist die über die weiße Kleidung kommunizierte Reinheit. Hinzu kommt zu diesem Zeitpunkt der adrett wirkende Stil. Der Schnitt ist nunmehr körperbetonter und lässt Freiheit an Armen und Beinen. Die Pantoletten lassen einen Anflug modischer Individualität verspüren (vgl. Abb. 2). Im Bild von der Nasenbrille schließlich kann sachliche Empathie und Mitgefühl gelesen werden.
Das Lernheft „Kompetente Pflege, Lernbereich 4, Pflege als Beruf – berufliches Selbstverständnis entwickeln“ von 2014 hat einen geringeren Seitenumfang als die zuvor analysierten Lehrbücher, unterscheidet sich durch größeres Format und mehr Fotografien, welche Personen bei der Ausübung von Krankenpflege abbilden. Der Charakter der Bilder ist durch den Einsatz von Farbfotografie mannigfaltiger. Bereits der Titel der Publikation „… berufliches Selbstverständnis entwickeln“ legt den Schluss nahe, dass die Fotografien für das Nahebringen des Berufsbildes gezielt ausgewählt bzw. gestaltet wurden. Männer, wie Frauen sind als für die Teilhabe am Beruf infrage kommend angesprochen. Die durch Blautöne dominierten Bilder von den Korridoren auf den Bettenstationen wirken monoton und suggerieren das Gefühl einer inneren apathischen Abgrenzung der Pflegefachkräfte (vgl. Abb. A13, A14). Dieser Effekt wird durch das „Vorbeilaufen“ der Personen an den Betrachtenden und ihren damit abgewandten Blicken verstärkt. Der kommunizierte Kleidungsstil ist deutlich lesbar. Wo es um Altenpflege (und Betreuung) geht, ist Kleidung leger und individuell gewählt (vgl. Abb. 4).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Berga 2014, 78 Copyright © Westermann Gruppe
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Berga 2014, 90 Copyright © Westermann Gruppe
Bei der Arbeit in Praxen und auf Stationen können hingegen neben der beruflichen Normkleidung keine individuell gewählten Elemente gefunden werden (vgl. Abb. A11, A13, A14). Bemerkenswert ist das neutral wirkende Foto auf Seite 22, bei dem ein weißer Kittel in Kombination mit individuell gewähltem Stil bei Bluse und Hose erscheint (vgl. Abb. A15). Fast kommen die Betrachtenden zu dem Schluss, dass die direkt in das Objektiv blickende Schwester in Wirklichkeit eine Ärztin sein könnte. Dieses Bild scheint durchaus den Gedanken an beide Fachrichtungen, Krankenpflege und Altenbetreuung, zu vereinen. Der fragende Blick an die Betrachtenden kann ausdrücken wollen, dass die Entscheidung für oder gegen eine der beiden Spezialisierungsrichtungen durchaus schwierig sein kann – gleichschwer zu beantworten, wie die Frage, ggf. für welche Aufstiegsfortbildung sich die Protagonistin entscheiden wird. Besonders ansprechend - weil reich strukturiert - erscheint die umfassend analysierte Fotografie von einer Schwester bei der Arztvisite (vgl. Abb. 3) Obwohl sie als „Mittlerin“ in der Interaktion zwischen dem Patienten und dem Arzt die Nebenrolle spielt, wirkt sie durch die Bildkonstruktion zentral und unverzichtbar. Ihr Blick zeugt von Interesse an der untersuchten Stelle und damit am Beschwerdepunkt des Patienten. Offenbar konzentriert sie sich auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Aufgabe. Die Beobachtungsresultate lassen sich, wie in der Diskussion dargestellt, den Kategorien berufliche Geschlechtsspezifik, berufliches Selbstverständnis (bzw. Identität), äußeres Erscheinungsbild und Buchgestaltung zuordnen.
Der Vergleich aller drei Zeitpunkte, vertreten durch die Beobachtungsergebnisse aus jeweils einer Publikation lassen einige berufliche (Identitäts-) Merkmale erkennen, die sich offenbar im Laufe der Zeit geändert haben. Der Kategorie äußeres Erscheinungsbild ist die Kleidung zuzuordnen. Vor etwas mehr als einhundert Jahren entsprach diese dem entsprechenden Berufsethos. Vor knapp vierzig Jahren war die Situation ähnlich, jedoch wurden die Schnitte der Berufskleidung eleganter, knapper und damit körperbetonter. Einzelne Komponenten (Pantoletten, bzw. das Tragen des Ringes) werden als bewusst individualistisch eingebrachte Stilelemente mit zusätzlicher Betonung des beruflichen Selbstbewusstseins wahrgenommen (vgl. Abb. A 5). Es lässt sich somit eine Ambivalenz im Kleidungsstil erkennen: Einerseits ist die berufliche Kleidung jeder Zeit körperbetonter und lässt Raum für die freie Wahl persönlicher Stilelemente, andererseits erinnert die korrekt getragene Haube an streng vorgegebene formale Kleidung vorangegangener Jahrzehnte (vgl. Abb. A 5, A 8, A 9). Das gegenwärtige Selbstverständnis der Berufsgruppe räumt die Anteilnahme an Informalisierung da ein, wo dies am ehesten angebracht erscheint (Altenbetreuung). In institutionellen Einrichtungen, die auf den Bildern als streng organisierte Anstalten kommuniziert werden, erscheint die blaue Kleidung wie eine Uniform, die sachliche persönliche Distanz und Professionalität visualisiert (vgl. Abb. A12, A13). Ein weiterer Unterschied lässt sich in der blauen Farbe des Kittels feststellen, während der des Arztes weiß ist (vgl. Abb. A11). Das ist ein Gegensatz zu 1916, als offenbar alle abgebildeten Personen in Weiß fotografiert wurden. Das berufliche Selbstverständnis lässt sich an den Gesichtsausdrücken konstatieren. Auf dem Bild von 1916 waren die Blicke der Schwestern stets sachlich interessiert und, da, wo abgebildet, auf das Tun des Arztes ausgerichtet (vgl. Abb. 1, A 3). Damit ergab sich eine Konstellation, in der die Krankenschwester ihr Tun stets auf die Anweisungen und Vorbildfunktion des Arztes ausrichtete. Bezeichnenderweise fehlen in der Publikation von 1984 gänzlich Abbildungen von ärztlichem Personal. Die Krankenschwester ist auf sich allein gestellt abgebildet, dennoch wird das Bild von körperlich schwerer Arbeit weicher gezeichnet. Der Umgang mit modernen Apparturen (wie der Sauerstoffflasche) offenbart sich nicht als körperliche Herausforderung (vgl. Abb. 2). Das Empfinden von Freude im Aufziehen einer Spritze deutet auf Emotion work hin, es kann aber auch Zufriedenheit mit der Berufung veranschaulichen (vgl. Abb. A 6, A 7). Selbst in kritischen Situationen (im Bild von der Nasenbrille) bewahrt die Schwester sachliche Kompetenz gepaart mit Empathie und menschlicher Wärme (vgl. Abb. A10). 2014 lassen sich neben Krankenschwestern auch männliche Berufsvertreter wahrnehmen (vgl. Abb. A13, A16). Neben nahezu apathisch der Tätigkeit zugewandten Gesichtern auf den Korridoren der Pflegestationen finden sich – besonders auch im Bereich der Betreuung – freudig strahlende Personen (vgl. Abb. A12, A16). Es lässt sich ein Wandel der kommunizierten Emotionen beobachten. Während im Jahre 1916 die Blicke der Krankenschwestern aufmerksam und konzentriert waren, so fanden sich 1984 neben neutralen Gesichtsausdrücken auch Hinweise auf Emotion work. Zum Erhebungszeitpunkt 2014 erreicht die Spanne der beobachteten Emotionen ein Maximum. Die wahrgenommenen Gefühlsregungen erscheinen nunmehr nicht als Emotion work sondern erscheinen als Ausdruck persönlicher Authentizität im abgebildeten Handlungskontext (vgl. Abb. A11, A12, A16). Die Ergebnisse lassen Rückschlüsse auf das für berufliche Identität zentrale Selbstverständnis zu. Während noch 1916 ein Handeln ohne ärztliche Vorbildfunktion bzw. Anweisung eher schwach kommuniziert wurde und stets der Arzt es war, der berufliche Fertigkeiten lehrte, so ist 1984 gänzlich das Gegenteil der Fall, denn im Lehrbuch steht die Krankenpflegerin der Leserschaft gegenüber, in Realität würde sie einer Gruppe von Auszubildenen gegenüberstehen, diese anleiten und Teilbereiche der Arbeit veranschaulichen (vgl. Abb. 2). Das Bild von der ärztlichen Visite im Jahre 2014 lässt sich nunmehr als eine Art Kooperation zwischen Arzt, Krankenschwester und Patient lesen (vgl. Abb. 3). Der Umgang mit technisch anspruchsvollen Gerätschaften gewann zwischen 1916 und 1984 an Bedeutung, jedoch traten in jüngster Zeit Persönlichkeitsmerkmale wie Empathie, Wärme und Stressresistenz in den Fokus der Kommunikation beruflicher Mythen. Zu allen drei Erhebungszeitpunkten war Reinheit – kommuniziert durch korrekte Berufskleidung oder durch Visualisierung von Hygiene dienender Arbeiten (Leintuchwechsel) – Kernbestandteil der Erwartungshaltung an auszubildende Fachkräfte. Während die vielen Bilder im Lehrbuch für chirurgische Schwestern ein abgeschlossenes Bild des Lehrausbildung suggerieren, so scheint für den Erhebungszeitpunkt 1984 die Bereitschaft sich technisches Know-how anzueignen nunmehr im Berufsbild verankert zu sein. Die Krankenpflegefachkraft wirkt als Ausbilderin der eigenen Profession. Es ist nicht ärztliches Personal – Angehörige einer höheren hierarchischen Stufe, die ausbilden, sondern die Pflegerin übernimmt aufgrund des eigenen Berufsfeldes Verantwortung für künftigen Nachwuchs. Damit steht sie nunmehr über einer einstigen reinen Assistenzrolle. Dies offenbart neben Hinweisen zur beruflichen Identität, auch solche zur Buchgestaltung. Die Publikation des Jahres 1916 kann als Lehrbuch gesehen werden, in dem sich Bilder (anstelle des ausbildenden Arztes) an die Leserschaft wenden. 1984 übermitteln abgebildete Pflegefachkräfte Sachverhalte. Im Jahre 2014 kommt es zu einem größerem Perspektivwandel: Nun ist es die Publikation, die, nicht zuletzt aufgrund ihrer Titelwahl, das Berufsbild der Pflegeberufe kommuniziert. Nicht alle Bilder zum Erhebungszeitpunkt 2014 versprechen abwechslungsreiche Arbeit, dennoch zeichnet die Publikation im Ganzen ein interessantes, abwechslungsreiches Bild des Berufsfeldes. Was für Lernende (gewollt?) unbeantwortet bleibt, ist die Frage nach den biografischen Entwicklungsmöglichkeiten - zuweilen lässt sich ein Anflug des diesbezüglichen Moratoriums Lernender verspüren (vgl. Abb. A15). Zu allen drei Erhebungszeitpunkten finden sich Anzeichen für die hingebungsvolle Einstellung zugunsten der Patienten (vgl. Abb. A 3, A10, A12). In ihnen liegt etwas Aufopferungsvoll-Heroisches, was bei den Betrachtenden Bewunderung für Selbstverleugnung im Interesse eines gesellschaftlich hoch wertgeschätzten Berufs erzeugt.
4.2 Globalcharakteristik Elektromontage
Für den Erhebungszeitpunkt 1903 liegt ein mit 17 x 11 cm relativ kleinformatiges Lehrbuch für die Bedürfnisse der Elektromontage in der Industrie vor. In einer Vollerhebung wurden alle Fotografien der Publikation, auf denen Personen abgebildet sind untersucht. Diese fünf Bilder, von denen vier die Protagonisten bei der Einführung damals neuer Elektrotechnik für die Produktion zeigen, heroisieren weniger das Berufsbild, sondern vielmehr die als überwältigend erscheinende Technik (vgl. Abb. 5). Der Effekt wird durch geschickte Perspektivwahl gesteigert, sodass der Mensch seine Bedeutung für die Fotografie lediglich als illustrativ belebendes Element bzw. zur Veranschaulichung realer Größenverhältnisse erfährt. Markant ist, dass ausschließlich Männer abgebildet sind. Die Fotografien sind sorgfältig inszeniert, dennoch posieren die Personen nicht als Hauptfiguren vor der Kamera - mit einer Ausnahme (vgl. Abb. A18) - erscheinen sie als eher zufällig ins Bild geratenes Beiwerk. Beim Westinghouse-Drehumformer blickt der gut gekleidete Fachmann, mit seinen Unterlagen in der Hand, bewusst in die Kamera (vgl. Abb. A20). Die Abbildung der fertig installierten Anlage verweist in eine saubere, lärmarme und gesicherte Arbeitsumgebung elektrifizierter Industrie. Eine ähnliche Botschaft vermittelt die Fotografie von der Hauptschalttafel in Mexiko (vgl. Abb. A22). Der Mann hinter den Kulissen in zweckdienlicher und akkurater Kleidung ist offenbar bei Überwachungsfunktionen in privilegierter Umgebung in Szene gesetzt (vgl. Abb. A21). Offenbar ist sein Alltag klar strukturiert. Damit wird auf die Zukunft für Elektromonteure angespielt; noch ist der Zugang zur neuen Energietechnologie längst nicht überall eingeführt. Die vorangehenden Bilder zeichnen ein Bild von Aufbruchstimmung. Drei der fünf Fotografien zeigen die Installation von Dynamomaschinen als Symbol der Quelle von Elektrizität. Monteure in grober Arbeitskleidung sind mit schweren Hämmern im Baustellenumfeld abgebildet. Der Stolz ihrer Berufung gründet sich im Bezug zur Größe der Anlage. Tatsächlich leisteten Elektromonteure in ihrer Schlüsselfunktion jeder Zeitphase Großes und legten den Grundstein für eine unaufhaltsame technologische Entwicklung. Fällt der Fokus auf das Individuum, so sind die Blicke nachdenklich (vgl. Abb. A17), nach unten geneigt (vgl. Abb. 5) und sachlich mit den Bildbetrachtenden interagierend (vgl. Abb. A20). Der Mensch im Dunklen (vgl. Abb. A21), als hinter schönen Kulissen agierend, (vgl. Abb. A21) ist bescheidener Diener zukunftsbestimmender Technik geworden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Pohl 1903, 16
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6: VSEI 1980, 7 Copyright © EIT.swiss
Das Berufsbild „Der Elektromonteur“ aus dem Jahre 1980 ist kein Lehrbuch, sondern bietet vielmehr interessierten Personen einen Überblick über die Berufsausbildung. Insofern kann die 24-seitige Broschüre vom Verband für Berufsberatung auch als Werbeheftchen für Schulabgänger*innen gelesen werden. Im Fokus stehen die verschiedenen Stationen der Ausbildung, sowie die jeweils nachzuweisenden Kenntnisse und Fertigkeiten der Auszubildenden. Was haben angehende Fachleute im Vorfeld beruflicher Ausbildung zu erwarten? Die Bilder der Publikation zeigen ausschließlich männliche Lernende. Während einzig das erste Foto einen Auszubildenden in einer Werkstatt abbildet (vgl. Abb. A24), sind alle anderen sieben Fotografien auf Baustellen aufgenommen worden. Nichts deutet darauf hin, dass versucht wurde das Arbeitsspektrum idealisiert oder romantisiert darzustellen. Im Gegenteil, erscheinen die Herausforderungen als gut im Foto eingefangen. Da stehen Männer auf einer Leiter und montieren über Kopf eine Lampe, wobei der Druck auf die Fußsohle deutlich erkennbar ist (vgl. Abb. A29). Das rückwärtige Stehen auf einer Leiter verlangt augenscheinlich Schwindelfreiheit und Körperkontrolle (vgl. Abb. A28). Nicht ungefährlich mutet das Verlegen der Plastikrohre auf dem bereits mit Drahtgeflecht versehenen Dach an (vgl. Abb. 6). Der Effekt wird durch die zerschlissene Kleidung und das Fehlen von Schutzkomponenten (wie Arbeitshandschuhen) der beiden Monteure zusätzlich verstärkt. Der Schaltkasten mit vielen Einzelkomponenten wird ohne ständige Zuhilfenahme des Planes selbstständig bestückt und verdrahtet (vgl. Abb. 7, A27), was den Betrachtenden ein Gefühl von der Menge des anzueignenden Wissens vermittelt. Die Fotografien wirken im schlichten Schwarz-Weiß-Druck sehr realitätsnah. Es sind Bilder, die besonders männliche Interessenten ansprechen, die in der Lage sind, dem Beruf trotz gewisser Härten und Risiken, die positiven Seiten – eine Vielfalt von Aufgaben sowie Freiheit, die sich aus der eigenständigen fachkundigen Arbeit an verschiedenen Orten ergibt - abzugewinnen. Die Broschüre bildet Installationen in Gebäuden ab, obwohl Elektromonteure nach wie vor in Industrie und Elektrizitätswerken gebraucht werden. Es sind keine Hinweise auf zukunftsweisende Technologien einer sich entwickelnden Digitalisierung erkennbar, auch ist auf keiner der acht Fotografien der Umgang mit Messinstrumenten abgebildet. Dennoch flößen die beiden Bilder der Monteure beim Einrichten der Schaltschränke fachfremden Personen Respekt angesichts der komplexer gewordenen Fortschrittsstufe ein (vgl. Abb. 7, A27). Die Mythen, welche aufgrund der Bildinhalte kommuniziert werden, bestehen in den seit Jahrzehnten unveränderten Tätigkeitsspektren von Elektromonteuren, bei denen sich in jüngerer Zeit der Schwerpunkt hin zur Hausinstallationen verlagert hat. Die Persönlichkeitsanforderungen sind an die körperliche, gefahrvolle und schmutzintensive Arbeit auf Baustellen gekoppelt und schließen durchaus den Aspekt der Freude am Abenteuer nicht aus.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 7: VSEI 1980, 21 Copyright © EIT.swiss
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 8: Schmolke 2018, Innenbuchdeckel vorn Copyright © VDE Verlag GmbH
Die Beobachtung, dass die Elektrobranche in jüngster Zeit in Lehrbüchern nur selten Fotos von Berufsvertreter*innen enthält, kann als Hinweis gesehen werden, dass die Identitätsbezüge aufgrund der immensen Differenzierung und Spezialisierung im Berufsfeld allgemein diffuser geworden sind. Ein Gegenpunkt bildet die Publikation des Erhebungszeitpunktes 2018. Obwohl die analysierte Fotografie den Charakter eines Werbefotos aufweist, hat das markante Bild einiges an Potential idealisierende Identitätsmerkmale zu transportieren (vgl. Abb. 8). Sicherheitsaspekte spielen offenbar erst in jüngerer Zeit eine immer wesentlichere Rolle. An die im Bild dargestellte Kleidung ist in diesem Sinne auch das Einhalten elektrotechnischer Normen und Bestimmungen gekoppelt. Die Botschaft: Das Beachten von Sicherheitsvorkehrungen ist Grundvoraussetzung um als Elektromonteur arbeiten zu können. Der Raum für beruflich orientierte Individualität ist nur noch begrenzt, angedeutet durch die jeweils beiden geöffneten oberen Knöpfe der Arbeitshemden. Die Bildkonstruktion lässt den Eindruck entstehen, dass die einstige Männerdomäne nunmehr von Frauen erobert wird. Jedoch ist es keine völlige Übernahme des Berufs, denn die Frau hält lediglich das Tablet. Frauen werden durch (aufgrund von Differenzierung und Spezialisierung) neuentstandene Aufgabenbereiche und Tätigkeitsfelder im organisatorischen bzw. überwachenden Bereich von Elektroinstallation angesprochen. In Verbindung damit lässt sich im Bild ein Generationskonflikt lesen. Jüngere Personen - im Bild eine Frau - verdrängen Männer, die jahrzehntelang Erfolg im Beruf hatten.
Konturen und Gesichtszüge der Frau betonen ihr Selbstbewusstsein - kennzeichnen es offenbar als Erfolgsrezept. Klassisches Arbeiten mit Papierunterlagen ist eine veraltet erscheinende Methode. Erfolg in der Elektrobranche ist gekoppelt an die Bereitschaft sich neue technische Möglichkeiten nutzbar zu machen und führend darin voranzugehen, die Grundlage für den Zugang aller zu Zukunftstechnologien zu schaffen.
Aufgrund des Werbecharakters der Fotografie mag die Analyse der Bildquellen einer weiteren Publikation in Hinblick auf Identitätsbefindlichkeiten größerer Objektivität dienlich sein. In der durchgängig mit schwarz-weißen Bildern versehenen „Einführung in die Elektroinstallation“ von Häberle aus dem Jahre 2016 finden sich lediglich 3 kleinformatige Fotografien ausschließlich männlicher Vertreter der Berufsgattung. Auf allen Bildern sind sie ihrer Tätigkeit zugewandt; die Illustrationen dienen der Visualisierung spezifischer Werkzeuge bzw. Hilfsmittel, weshalb die Personen nur wenig von ihrer Identität preiszugeben vermögen. Nichts deutet darauf hin, dass die Nähe zur unverputzten Wand, das Halten schwerer elektrischer bzw. pneumatischer sowie lärm- und staubintensiver Werkzeuge in irgendeiner Art der Heroisierung des Berufes dient. Das Tragen der schwer anmutenden Kabelrolle kann ähnlich verstanden werden und dient offenbar der Illustration (vgl. Abb. A34). Die Arbeitskleidung ist den Tätigkeiten angepasst grob gewählt. Der Helm symbolisiert Regelkonformität. Bezüglich der beruflichen Geschlechtsspezifizität können die gewählten Bildansichten dazu beitragen, dass Interessentinnen zu dem Schluss kommen mögen, dass es sich eher um einen Beruf für Männer handelt, die kräftig sowie gegen äußere Einflüsse resistent sind. Lediglich ein Bild gibt einen Ausschnitt vom Gesicht des Monteurs preis (vgl. Abb. A32). Der Blick ist entschlossen und auf die Arbeit fokussiert. Der Schnurrbart liest sich als zusätzliches Kennzeichen von Männlichkeit. Da die Blicke der Protagonisten abgewandt sind und Werkzeuge die zentrale Aussage der Fotografien bilden, scheint der Sinn der Bilder nicht darin bestehen, eine direkte Interaktion mit den Betrachtenden zu erzeugen. Die Hinweise auf berufliche Identität und Persönlichkeit verbleiben auf latenter Ebene. Die für die Krankenpflege gebildeten Beobachtungskategorien spiegeln sich auch für das Feld der Elektromontage.
Auch die Veröffentlichungszeitpunkte der Quellen für die Erhebung sind bei den Elektroberufen denen der Krankenpflege ähnlich. Die Wahl der Publikationen fiel auf die Erscheinungsjahre 1903, 1980 und 2018. Mit dem Einzug der Elektrotechnik in die Industrie wurde die Dampfmaschine abgelöst. Der ungefähre Zeitpunkt, den die zweite Etappe der industriellen Revolution mit der Einführung von Elektrizität und Massenfertigung in die Produktion markiert, kann auf 1870 datiert werden. Der Prozess der Umgestaltung zog die Entwicklung einer bis anhin nicht bekannten Berufsgruppe nach sich, die in weiterer Folge auch Telekommunikation und Digitalisierung in verschiedenen Ausprägungen einschließen und selbst Privathaushalte, kurz: alle Lebensbereiche, erobern würde. Eine Untersuchung des Idealbildes von Berufsvertretern, so war zu erwarten, die Etappen genannter Entwicklung abbilden. Die drei betrachteten Zeitpunkte zeigen Etappen der Durchdringung aller Lebensbereiche durch Elektrotechnik bis diese allgegenwärtig wurde. Elektromonteur*innen sind Protagonist*innen des technischen Entwicklungsstranges. War dieser Berufszweig 1903 noch auf die technische Ausstattung von Industrie – und hier mit starkem Fokus auf Energiebereitstellung – fokussiert, ist 1980 als nächster Erhebungszeitpunkt für den noch relativ jungen Beruf ein großer Zeitsprung. Wenngleich sich bis dahin wenig an den technischen Kenntnissen für die Elektromontage geändert haben mag, sind die Bauelemente kleiner geworden, die Montagearbeiten konzentrierten sich nunmehr auf die Ausstattung von Wohngebäuden. Die Fotografien aus den Jahren 2018 und 2016 gehen durch die Ausrichtung auf Gebäudeinstallation einen Schritt weiter. Während 2016 anscheinend eher illustrativ Elektromonteure neben den im Text beschriebenen Spezialwerkzeugen abgebildet sind, ist 2018 das Nachschlagen elektrotechnischer Normen mittels Tabletcomputer Thema des Fotos. Damit ist der Sprung zur Digitalisierung erkennbar, den auch Angehörige der Berufsgruppe zu meistern haben, wollen sie ihren Beruf weiterhin kompetent Schritt halten. Der Kontrast ist auch in Konstellation und Kleidung zu sehen. Die Abbildung zeigt eine junge, attraktiv aussehende Frau mit dem Tabletcomputer, hinter ihr ein erfahrener Berufsvertreter, der mit seinen Papierbögen abgedrängt erscheint. Dennoch vereint beide das moderne elektrotechnische Regelwerk, visualisiert durch den gemeinsamen Blick in die Software. Das Bild der früheren Erhebungszeitpunkte (vor 2018) ist miteinander vergleichbar: Männer in grober Kleidung sind bei körperlich anspruchsvoller Arbeit mit subjektiv erhöhtem Risiko abgelichtet. Die Arbeit ist augenscheinlich interessant, abwechslungs- aber auch gefahrreich, in der Bildfolge von 1980 geradezu abenteuerlich (vgl. Abb. A23 – A30). Es lässt sich auch ein Wandel der Beziehungen erkennen. Wird in der Publikation von 1903 eine deutliche Unterscheidung der Hierarchiestufe zwischen Monteuren und leitendem Personal visualisiert (vgl. Abb. A18), sind im Jahre 1980 bereits Meister und Lehrling eng beieinander abgebildet (vgl. Abb. 6). Der Meister übernimmt die Rolle des aktiv Vorarbeitenden – der Lehrling schaut genau auf seine Handgriffe. Die übrigen Bilder zeigen eigenständiges Herangehen an anspruchsvolle Tätigkeiten. Dieses Bild wandelte sich 2018, denn es wird kommuniziert, wie die Lernende aktiv die Software auf dem Tablet navigiert, wohingegen der Lehrmeister aufgrund ihrer Fertigkeiten zu Erkenntnissen gelangt (vgl. Abb. 8). Der Erfolg im Berufszweig wird nunmehr mit dem geschickten Umgang mit digitalen Möglichkeiten assoziiert. Durch die Bildgestaltung entsteht der Eindruck eines Generationenwechsels: was jahrzehntelang Bestand hatte wird nun verdrängt. Traditionelle handwerkliche Arbeitsweisen, schwere körperliche Tätigkeit, die oft von einer Person im Alleingang ausgeführt wurde, wird im Team bewältigt, wodurch Einsatzmöglichkeiten für Frauen entstehen, die anscheinend nach kürzerer Ausbildungszeit bereits organisatorische und überprüfende Aufgaben übernehmen. Damit ist bildlich die Diversifizierung der Elektroberufe ausgedrückt. Ein Wandel ist auch im Bildaufbau zu beobachten. Waren 1903 Maschinen und Anlagen zentral – Personen nahmen die Rolle illustrativen Beiwerks ein, so sind 1980 Personen in vielen Beispielen auf Augenhöhe mit der Technik abgebildet. Alle Fotografien kennzeichnet dasselbe Merkmal: Das konzentrierte Hinschauen der abgebildeten Personen auf den Aktionspunkt der Handlung, kann als interessierte Interaktion mit der Technik gelesen werden. Auch die Bilder der Jahre 2016 und 2018 zeigen dieses Muster. 2018 vermitteln die Gesichter zusätzlich eine helle, fast freudige Stimmung. Gekonnter Umgang mit Technik macht Freude, so die aktuelle Botschaft. Die Gesichter zum Erhebungszeitpunkt 1980 waren neutral (vgl. Abb. A24, A26), 1903 dagegen waren sie nach unten geneigt (vgl. Abb. 5), lagen im Schatten (vgl. Abb. A21) und wirkten vom Ausdruck eher düster (vgl. Abb. A17), wobei es schwerfällt, kleinere Details zu erkennen. Personen erscheinen der Technik untergeordnet, Schwermut, der von überwältigender Technik herrührt, so die Lesart. Einzig die Lehrschrift von 1903 zeigt die berufliche Perspektive von der Installation (vgl. Abb. A17, A19) hin zur überwachenden Funktion (vgl. Abb. A20, A21). Die Beobachtung mag im zum Erhebungszeitpunkt geringen Spezialisierungsgrad des Berufes gründen. Der völlige Gegenpol ist das Bild von 2018, bei dem davon ausgegangen werden kann, dass die junge Frau kaum Kontakt mit schweren Werkzeugen hatte, sondern im Rahmen einer Elektrotechnik-, bzw. Elektroingenieur-Ausbildung lediglich Einblicke in handwerkliche Voraussetzungen erhielt (vgl. Abb. 8). Es finden sich folglich in den Fotografien eine Reihe von Belegen für den Wandel des Berufszweiges sowie beruflicher Ausbildung.
5 Diskussion der Ergebnisse
5.1 Schlussfolgerungen zur Krankenpflege
Zunächst soll auf die Untersuchungsergebnisse zur Krankenpflege eingegangen werden. Der durch die Fotoanalysen abgebildete Zeitraum umfasst die junge Entwicklungsgeschichte eines heute weithin bekannten Berufes. War vom Altertum bis ins Mittelalter unter Pflege eine Form des Helfens zu verstehen, so kam es in der Neuzeit zur Vermittlung von Techniken bis hin zur Entwicklung einer eigenständigen Profession (vgl. Berga 2014: 31). Die kontinuierlich steigenden Zahlen an Krankenpflegenden erklären auch das frühe Vorliegen umfassender Lehrpublikationen. Im Jahre 1876 gab es 8 681 Krankenpflegerinnen im Deutschen Reich, 1906 waren es bereits 56 000 (vgl. Berga 2014: 21) und 1942 insgesamt 181 394 (vgl. Berga 2014: 26). Die Tendenz setzt sich bis zum heutigen Zeitpunkt fort: Allein im Jahre 2009 begannen in Deutschland 51 400 ihre Ausbildung im Pflegebereich - zehn Jahre später waren es bereits 71 300, was einer Zunahme von 39 % entspricht (vgl. Statistisches Bundesamt 2020). Der Vergleich der drei Erhebungszeitpunkte belegt den Entwicklungsprozess der Krankenpflege als Profession zum vollwertigen Heilberuf (vgl. Betz 1992: 196): 1916 waren Krankenschwestern weibliche assistierende Hilfskräfte und Lernende bei männlichen Ärzten zumeist in Einrichtungen institutioneller Pflege – im ersten Weltkrieg entstand für die Chirurgie besonderer Bedarf (wenngleich die Publikation auch Gemeindeschwestern und Privatpflegerinnen anspricht (vgl. Janssen 1916: 281)). 1984 waren Krankenschwestern nach wie vor zumeist weiblich, bildeten bereits in ihrer Profession aus (sie sprechen von den Bildern zur Leserschaft des Lehrbuches); der Orientierungsfokus lag weiterhin auf die Tätigkeit in Kranken- und Pflegeeinrichtungen mit Fokus auf medizinisch eigenständiges und anspruchsvolles Handeln. Waren die Fotografien zu den früheren Erhebungszeitpunkten noch ausschließlich auf medizinische (Hilfs-) Arbeiten ausgerichtet, so finden sich für das Jahr 2014 sehr aussagekräftige Fotografien zur Assistenz bei der Visite und zum Betreuungssektor, die Tätigkeiten abbilden, welche über reine Unterstützungs- bzw. Grundpflegefunktionen hinausgehen. Offenbar wurde der zunehmenden Schaffung neuer Spezialisierungsrichtungen bei der Abbildung des Berufsbildes (Altenpflege ab 1969) Rechnung getragen (vgl. Berga 2014: 29; Schröder: 552 ff.). Im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts ist die Etablierung der Pflege im tertiären Ausbildungsbereich (Diplomstudiengänge für Management und Pädagogik von Pflegepersonal sowie im Bereich der Pflegeforschung) zu beobachten, was ein Hinweis auf Professionalisierungsbestrebungen ist (vgl. Borsi und Schröck 1995: 11). 2014 „sprechen“ die abgebildeten Personen nicht mehr zu den Bildbetrachtenden, sondern werden als Glieder einer Peergroup wahrgenommen, an denen die identitätsprägende Orientierung stattfindet. Der Verlust von identitätsprägenden Vorbildern kann als Teil des als Krise durchlebten Zusammenhangs zwischen persönlicher biografischer Leistung und beruflicher Umwelt zufolge individueller wie gesellschaftlicher Wandlungsprozesse verstanden werden (vgl. Borsi und Schröck 1995: 101).
Teil dieser Wandlung ist das Aufweichen der Geschlechtergrenzen. Mit der Herausbildung des modernen, von Männern ausgeübten Arztberufes im 19. Jahrhundert, wurde die Rolle der Frau im Gesundheitswesen insbesondere im Bereich der Pflege marginalisiert (vgl. Streckeisen et al. 2013: 10 f.). Bereits der Titel der Publikation des Jahres 1916 „Lehrbuch der Chirurgischen Krankenpflege für Pflegerinnen und Operationsschwestern“ schließt die Möglichkeit aus, dass sich Männer für den Beruf interessieren könnten. Die Fotografien aller drei Erhebungszeitpunkte zeigen ein klar von Frauen dominiertes Berufsbild. Lediglich in der jüngsten der drei analysierten Publikationen finden sich zwei Bilder männlicher Berufsvertreter (vgl. Abb. A13, A16). Wenngleich der Männeranteil im Berufszweig „von 19 % im Jahr 2009 auf 25 % im Jahr 2019“ (Statistisches Bundesamt 2020) zunahm, sind Männer nach wie vor untervertreten (vgl. Berga 2014: 31). Während vier Fünftel der Ärzte Männer sind, werden sie bis heute in aller Regel von Frauen assistiert (vgl. Bühler 2005: 66). Wo männliche Vertreter der Berufsgattung abgebildet sind - in Verbindung mit dem Mann mit dem Rollstuhl und beim Transport eines Pflegebettes auf dem Korridor einer Station - entsteht die verstärkte Assoziation zu körperlich schwerer Arbeit. Zum Erhebungszeitpunkt 1916 leistete die Frau schwere körperliche Arbeit im Pflegebereich und assistierte die Arbeit einer aus Männern bestehenden Ärzteschaft. Die Bilder sind vor dem Hintergrund des ersten Weltkrieges zu lesen, als der Ruf nach chirurgischen Pflegekräften, wie auch der des Patriotismus, laut erscholl: „Ich hoffe, daß das Lehrbuch der chirurgischen Krankenpflege in seinem neuen Gewande sich des gleichen Wohlwollens seiner Leser erfreuen möge wie seine erste Auflage, zumal in der Zeit des großen Krieges, welcher so viele weibliche Kräfte in den schönsten Dienst für das Vaterland gestellt hat: die chirurgische Pflege unserer Verwundeten, denen die deutsche Frau in keiner besseren Weise ihren Dank erzeigen kann, als durch hingebende, aufopferungsvolle und gewissenhafte Pflege der fürs Vaterland erlittenen Wunden!“ (Janssen 1916: VI). Die Publikation ist als idealisierte Darstellung der Krankenschwester jener Zeit zu entschlüsseln. Für heutige Begriffe befremdend liest sich der Text einer Lehrschrift jener Epoche: „Was ist die dritte Pflicht von der Pflegerin? - Daß sie während der Pflege dem behandelnden Arzt in allem, was zu befehlen seines Amtes ist, gehorche. […] Die Vorschrieben des Arztes sind mit der größten Pünktlichkeit und Ordnung willig zu befolgen.“ (Feßler 1923: 3 f.).
Gesellschaftliche Wandlungsprozesse lassen sich deutlich im Kleidungsstil erkennen: 1916 war Kleidung formales Kennzeichen des Berufes und etwas Vereinigendes zwischen Arzt und Krankenschwester. Das Festhalten am beruflichen Identitätsmerkmal lassen die Häubchen und die weissen, strengen Kittel 1984 erkennen, dennoch verweisen die schwarzen Pantoletten und Nylonstrümpfe, sowie die körperbetonten Schnitte auf das Aufbrechen traditioneller Werthaltungen, hin zu mehr Individualität. Der Erhebungszeitpunkt 2014 ist im Bereich der Betreuung durch große persönliche Freiheit in der Wahl des Kleidungsstils gekennzeichnet (vgl. Abb. A12, A16). Selbst da wo Formalität erwartet wird, finden sich persönlich gewählte Kleidungselemente (vgl. Abb. A15). Die Bereiche der institutionellen Krankenpflege sind dagegen durch sehr formal erscheinende blaue Kleidung gekennzeichnet, die das Berufsbild von dem der Ärzteschaft abgrenzen (vgl. Abb. A13, A14). Damit ist sehr anschaulich die in Schüben erfolgte Informalisierung abgebildet. Nach den 1920ern, fand diese in der Expressiven Revolution der 1960er/1970er Jahre – die diesmal breitere Gesellschaftsschichten erfasste - statt, worauf eine erneute Reformalisierung stattfand (vgl. Wouters 2007: 9). Den Schritt in die Moderne drücken Bildelemente von 1984 erstaunlich genau ab (vgl. Abb. A 5). Die Pantoletten mit den Nylons können als In-Erscheinung-treten eines - von Arbeitgebern zunächst vehement bekämpften - zivileren Umgangshabitus und als Aufbrechen strenger Nachkriegsformen gelesen werden, wodurch Raum für informellere Interaktionsweisen geschaffen wurde (vgl. Alheit 1994: 22). Infolge von einsetzenden Individualisierungstendenzen verlor das Bildungssystem in den 1970-er Jahren an statusverleihender Kraft (vgl. Beck 1986: 244). Die freigesetzten Individuen unterlagen der „Entzauberung und hatten sich erneut zu reintegrieren (ebd.: 206). „Daß sich [infolge von Individualisierung M.H.] Menschen in und mit ihrer gesellschaftlichen Umwelt verändern“ (Gruber 2001: 48) wird aufgrund der vielfältigen – von formal sehr strengen bis hin zu völlig individualistischen - Kleidungsgepflogenheiten ein und derselben Berufsgattung im Lehrheft von 2014 besonders deutlich (vgl. Abb. A12, A16). Individualisierungstendenzen betreffen auch die Patientenseite: Der in jüngster Zeit stattfindende Wandel der Pflege hin zur Befriedigung einer Forderung nach der Erfüllung individueller Wünsche seitens der Patienten – die ein Plus zur notwendigen Grundversorgung darstellen - lässt sich anhand der Bebilderung deutlich wahrnehmen (vgl. Borsi und Schröck 1995: 9; vgl. Abb. A12, A16).
Lehrbuchgestaltung und Bildauswahl als Beleg für den Zusammenhang von Individualismus und gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse gesehen werden (vgl. Borsi und Schröck 1995: 9). Der Charakter der Bildinhalte - und damit die Darstellungsweise des Berufsbildes - wandelte sich von einer erklärenden, fast schon belehrenden, und sachlich darstellenden Form 1916 und 1984 hin zu einer farbigen, ansprechenden Form 2014. Die Bilder laden ein, sich mit der Profession zu beschäftigen, sich mit ihr zu identifizieren und haben nunmehr illustrierenden Charakter. Während ehemals schwere Arbeit thematisiert wurde, wurde 2014 (und ansatzweise bereits 1984) im Selbstverständnis von Pflegefachkräften Raum geschaffen für eigene Emotionen, bis hin zu strahlender Freude (vgl. Abb. A 2, A 3, A 7, A12, A16); Tätigkeitsbeispiele und Bildkontexte wurden weniger eng als 1916 und 1984, sowie abwechslungsreicher modelliert, wodurch die fortschreitende Differenzierung und Diversifizierung der Aufgabenbereiche erkennbar wird. Es sind neue Aufgaben- und Verantwortungsbereiche, die immer mehr fordern (vgl. Tiemann 2014: 175). Auch der Begriff der Reinheit unterlag dem Wandel: Wurde sie 1916 im einheitlichen Kleidungsstil von Arzt und Schwester in Szene gesetzt, so traten infolge von Informalisierung Möglichkeiten individueller Detailfreiheiten auf, bis schließlich 2014 die für die Bilder gewählte Kleidung sich je nach Einsatzort und Konstellation zwischen Blau, Weiß und individuell gewählt unterschied. Die Analyse ergab ein Bild der Spanne zwischen einst eng gesetzten Grenzen und Unterordnungsparadigmen zur Zeit des Kaiserreiches bis hin zur scheinbar maximiert gelebten Individualität einer postmodernen Demokratie. Nachdem die Beobachtungsresultate zur Krankenpflege interpretiert wurden, soll nun auf die Ergebnisse für die Elektromontage eingegangen werden.
5.2 Schlussfolgerungen zur Elektromontage
Die untersuchten Bilder lassen auch soziologische Rückschlüsse die Berufe der Elektrobranche - ein junges, seit 150 Jahren stetig wachsendes und sich vielfältig differenzierendes Berufsfeld - zu (vgl. Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie e. V. 1968: 5). Nach Entdeckung der Elektrodynamik 1866 war Elektrizität lange Zeit nur Thema eines kleines Fachpublikums (vgl. Schaal 2012: 36). 1882 wurde in Darmstadt ein erster deutscher Lehrstuhl für Elektrotechnik begründet (vgl. Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie e. V. 1968: 17). Nur siebzehn Jahre später konnte das Fach bereits an 14 deutschsprachigen Hochschulen studiert werden (vgl. Verband Deutscher Elektrotechniker 1991: 308). Um die Jahrhundertwende war nach Schaffung des Rüstzeuges stand die Grundlage für eine umfassendere Einführung und Entwicklung der Elektrotechnik zur Verfügung (vgl. Vieweg 1968: 24). Der Entwicklungsprozess der Branche behält seine Dynamik bis zum heutigen Tag. In den Jahren 1961 – 1981 stieg die Zahl der erwerbstätigen Elektriker in der BRD um 121 000 (vgl. Industriegewerkschaft Metall 1985: 28), im Jahre 1984 befanden sich in den industriellen Elektroberufen 50 000 Personen in Ausbildung; für 2017 wurden in Gesamtdeutschland 36 200 Verträge zu Ausbildungsberufen der Bereiche Energie, Mechatronik und Elektronik abgeschlossen (vgl. Mailn et al. 2018: 21). Trotz der rasanten Entwicklung sind Frauen mit 7,3 Prozent der sozialversicherten Beschäftigen 2017 stark unterrepräsentiert (vgl. ebd.: 23). Die analysierten Bildinhalte bestätigen diese Daten. Die Erhebungszeitpunkte 1903 und 1980 bilden ausschließlich männliche Angestellte bzw. Auszubildende ab. Erst beim jüngsten Erhebungszeitpunkt rückt eine weibliche Fachkraft in den Fokus. Dabei fällt die Einbettung in den Bildkontext auf. Während die Fotografien von 1903 belegen, wie Elektromonteure gewaltige Industrieanlagen aufbauten und bedienten, bilden die Fotografien 1980 detailliert ein breiteres Spektrum an Tätigkeiten im Hausinstallationsbereich ab. Im Vergleich zu 1903 erscheinen die Arbeiten weniger grob und weniger schwer, dennoch deutet eine Reihe von Bildern die Gefahren im Arbeitsumfeld an (vgl. Abb. A23, A24, A28, A29). Auch in der ergänzenden Publikation des Jahres 2016 haben die Fotografien diesen Charakter. Auffallend ist der Schnurbart, der Männlichkeit betont (vgl. Abb. A32). Das Bild von 2018 ist vor dem Hintergrund der Gebäudeinstallation zu lesen - die Nutzung des Tablets kann dabei als Hinweis auf Aufgabenbereiche gelesen werden, die Frauen präferierten – was das Bestreben zur Auflösung von Geschlechtergrenzen markiert.
Weitere soziologische Rückschlüsse lassen sich an Stilelementen der abgebildeten Personen machen. 1903 deuten einige Beobachtungen auf die soziale Stellung von Elektromonteuren hin. Die Darstellung als Arbeiterberuf wird besonders deutlich im Vergleich zu Direktionsmitgliedern, bzw. Eigentümern (vgl. Abb. A18). Während diese stolz und fein gekleidet im Zylinder zur Kamera aufschauten, so sahen jene nach unten (vgl. Abb. A19), befanden sich im Bauschutt (vgl. Abb. A17), in dunklen Umgebungen (vgl. Abb. A21) und waren mit schweren Werkzeugen ausgestattet (vgl. Abb. A19). Bereits zu jener Zeit wurde dargestellt, dass Elektroenergie in eine reinere Zukunft und zu einem angenehmeren Arbeitsumfeld führt (vgl. Abb. A20). Die Publikation von 1980 zeichnet ein Bild der Ausbildung auf Augenhöhe mit dem Meister (vgl. Abb. A23), die Frisuren entsprachen dem Trend zur Informalisierung (vgl. Abb. A23, A28). Zu diesem Zeitpunkt finden sich Abbildungen, die zeigen, dass Elektroinstallation eine Zukunftstechnologie ist und durchaus keine körperlich anspruchsvolle Tätigkeit sein muss (vgl. Abb. A27, A30). Das Bild von 2018 zeichnet ein ambivalentes Bild. Während die junge Frau geschminkt wirkt und durch die Nutzung des Tablets der Gedanke an die Arbeit auf der Baustelle kaum aufkommt, so zeigt das karierte Hemd, dass sie mit dem danebenstehenden Mann vereint dennoch an, dass sie praktische Erfahrungen haben mag (vgl. Abb. A35). Das ersichtliche Identitätsmerkmal: Sie kann offensichtlich anpacken und scheint sich in praktischen Baustelleninstallationen auszukennen. Die analysierten Bilder lassen den Wandel des Berufs vom einstigen rein industriellen Einsatzfeld hin zur Haus- und Gebäudeinstallation, der Elektrifizierung aller Lebensbereiche, erkennen. Handelte es sich in den Anfangsjahren um vielfach relativ grobe Arbeiten, die z.B. beim Aufbau von Generatoren zu bewältigen waren, so waren die Tätigkeiten 1980 ungleich vielfältiger, das anzueignende Wissen und Können ungleich höher. Mit der alltäglichen Verwendung von Software wuchsen Kompetenzanforderungen und Differenzierung des Berufszweiges (vgl. Siemens 1968: 5). Im Bild von 2018 ist die Dynamik eines modernen Berufes eingefangen, der von Fachkräften verlangt, sich stetig fortzubilden (vgl. Kaufmann 2010: 5). Die Nutzung des Tabletcomputers zeigt die Vielfalt der Tätigkeiten im Spektrum moderner Elektromontage (vgl. Abb. A35). Wer jüngst eine elektrotechnische Ausbildung durchlaufen hat, ist aktuell auf dem Laufenden der Entwicklung - wer dagegen jahrelang im Beruf Erfolg hatte, muss an neuen Technologien interessiert bleiben, will er nicht ins Abseits geraten. Die Entwicklung der Elektrobranche kann exemplarisch für den Strukturwandel der Arbeitswelt gelten. Die Bedeutung von (informationsverarbeitenden) Dienstleistungen nimmt kontinuierlich zu, während die Informationsflut stetig wächst (vgl. Grabowski 2007: 32). Anstelle entwerteter handlungsverbindlicher Regeln ist zunehmend Flexibilität und lebenslanger Qualifikationserwerb gefordert (vgl. Geißler 1991: 72). Der Beruf ist Beispiel für den Übergang der Industriegesellschaft zur tertiären Dienstleistungsgesellschaft (vgl. Mayer 2000: 80). Bei der bereits oben angesprochenen Kleidung fällt die Verwendung von Sicherheitselementen zu den jüngeren Erhebungszeitpunkten auf. Während 1903 praktische Arbeitskleidung verwendet wurde, ist 1984 ein Bauhelm zu sehen (vgl. Abb. A28). Dies ist jedoch nur auf einer Fotografie der Fall. Auf einigen Bildern könnte aus heutiger Sicht, gerade weil es ein beispielhaftes Berufsbild ist, ein Mehr an abgebildeten Sicherheitskomponenten erwartet werden (vgl. Abb. A23, A24). Der allgemeine Kleidungsstil der Fachpersonen ist ähnlich dem des Erhebungszeitpunktes 1903. Erst 2018 sind die Sicherheitskomponenten durch die farbige Gestaltung auffallend, im Verhältnis zur abgebildeten Tätigkeit überproportional dargestellt. Bereits 2016 lässt sich ein etwas stärkeres Sicherheitsbewusstsein als 1980 erkennen. Dies korreliert mit strenger werdenden Sicherheits- und Arbeitsschutznormen. Nach wie vor sind körperliche Beeinträchtigungen Hauptursache für beruflich bedingte Erkrankungen in Deutschland (vgl. Spiegel und Popp 2019: 132). Gerade weil der Schutz vor Staub, Lärm und herabfallenden Gegenständen immer kleiner werdende Gruppen von Berufstätigen betreffen (vgl. ebd.), sind die Sicherheitskomponenten so augenfällig und charakterisieren das Berufsfeld der Elektromontage bzw. -installation als Berufsfeld mit erhöhtem Gefahrenpotential. Das Fehlen erwarteter Ausrüstungsbestandteile, wie Arbeitshandschuhe (vgl. Abb. A23), Schutzbrille (vgl. Abb. A24) und Staubmaske (vgl. Abb. A32), auch das Auftreten für die Berufsausübung eher unpraktischer Ausdruckselemente persönlichen Stils, wie längere Frisuren (vgl. Abb. A23, A28) und lässig geöffnete Ärmel (vgl. Abb. A23, A28, A29), kann vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Informalisierungstendenzen mit Bezug auf Arbeitsmoral und Leistungsbereitschaft jener Zeit (vgl. Vollmer 1986: 287 f.) verstanden werden. Leistungsethik war das Schlagwort: Durch beflügelnde Unternehmenskultur wurde Mitarbeiterqualität zum matchentscheidenden Faktor (vgl. ebd.: 291). Anders formuliert zählte 1980 weniger das Beachten von Sicherheitsformalitäten, sondern die unkomplizierte Aufgabenerfüllung durch zufriedene Mitarbeiter. Arbeitsmoral beim Sprung in die Freizeitgesellschaft kannte neue Tugenden: Experimentierfreude, Verhaltenssouveränität und Lernbereitschaft (vgl. ebd.: 294) sind die in den Bildern erkennbare Faktoren (vgl. Abb. A24, A26).
Aber auch Qualifikation und Kompetenz sind Aspekte arbeitssoziologischer Entwicklung, die sich in der Gestaltung der Fotografien widerspiegeln. Im Jahre 1903 ist die Arbeit von Elektromonteuren im Bild auf enge selbständige Tätigkeitsbereiche vom Aufbau großer Anlagen, bei der körperlich schwere Arbeit im Mittelpunkt stand, bzw. überschaubare Überwachungstätigkeiten begrenzt. 1980 zeichnen die Fotografien ein relativ komplexes Bild vielfältiger manueller Tätigkeiten, die umfassende Kenntnisse und Fertigkeiten erfordern. 2018 rücken Fähigkeiten zum vernetzten Denken, zur Konformität mit Richtlinien und Vorschriften, sowie Kenntnisse im Recherchieren, wie im Umgang mit digitalen Medien und kommunikative Kompetenzen, optisch ins Auge der Bildbetrachter. Die Bildreihe über den Verlauf der Jahrzehnte präsentiert sich wie eine Entwicklung von der völligen Beherrschung eines Fachgebietes (1903), über eine gerade noch fassbare Menge der sich entwickelnden Vielfalt (1980) bis hin zur unüberschaubaren Aufsplittung des Berufes in spezialisierte Teilbereiche (2018). Der auf den Bildern abgebildete Entwicklungsstrang erfasst die fortschreitende Differenzierung aufgrund des technologischen Wandels (bei dem fachliches Wissen zwar noch eine gewisse Bedeutung hat, jedoch zunehmend auf den Erwerb von Schlüsselqualifikationen gesetzt wird) (vgl. Tiemann 2014: 13).
Der Charakter der Bebilderung der Lehrpublikationen unterscheidet sich stark zu den unterschiedlichen Erhebungszeitpunkten. Hatten 1903 die Fotografien illustrative Bedeutung, auf denen Personen eher als Maßstab für Größenvergleiche abgebildet wurden, so rückte 1980 der Mensch, als Individuum, in den Mittelpunkt. Zur Visualisierung rein sachlicher Aufgabenerfüllung (Aufbau oder Überwachung von Anlagen), konnte sich die Leserschaft nun auch mit den Gesichtsausdrücken der Protagonisten auseinandersetzen. Im Berufsbild Elektromontage lassen sich einige Hinweise auf den Transport beruflicher Mythen erkennen. Detailliert wurden Tätigkeiten, damit verbundene Gefahren und berufliche Besonderheiten festgehalten. Der Blick in die Gesichter der Akteure lässt den Typus der Berufsvertretenden erkennen. Wenngleich Lehrpublikationen der Elektroinstallation wenige oder keine Fotografien von Berufsvertreter*innen beinhalten, so vermitteln die Fotos auf den Innenumschlägen der Publikation von 2018 erneut ein stark idealisierendes Bild. Dies kann angesichts der oben beschriebenen Unterrepräsentation weiblicher Berufsvertreterinnen im krassen Kontrast zur dominanten Darstellung der Frau eher als Symbolik bzw. bewusst eingebauter Lehrfaktor verstanden werden.
5.3 Abstraktive Gegenüberstellung beider Berufe
Die Gegenüberstellung der Analyseergebnisse beider Berufszweige bestätigt die Aufweichung von Geschlechtergrenzen. Der einst reine Frauenberuf der Pflege wird gegenwärtig auch von Männern besetzt; in ehemaligen Männerdomänen (z.B. den Elektroberufen) sind heute Frauen anzutreffen. Allerdings bleiben althergebrachte Muster weitgehend bestehen (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2021: 13). Nach wie vor konzentriert sich Frauenerwerbstätigkeit auf Berufe mit „Affinität zu reproduktionsbezogenen Tätigkeiten: pflegen, dienen, helfen, erziehen oder heilen“ (Alheit 1994: 75). Jedoch lässt sich in den vorliegenden Bildanalysen keine Bestätigung für ein Stilisieren „typisch weiblicher Eigenschaften wie Fürsorglichkeit, Mütterlichkeit, Geduld oder Aufopferung im Dienste anderer“ (Bühler 2005: 66) konstatieren. Eher ließ sich Aufmerksamkeit und Interesse in Bezug auf gewissenhafte Erfüllung der Tätigkeit feststellen. Sowohl in den Statistiken, wie auch in den Bildern entsprechen die Verhältnisse einander. Als Ausnahme kann die Fotografie von 2018 gelten, denn hier ist die junge Frau der aktivere Teil und scheint die zukünftige Rolle für Frauen mit Blick auf die Digitalisierung in der Elektrobranche anzudeuten.
In beiden Berufssparten ließen sich Veränderungen im äußeren Erscheinungsbild (besonders deutliche in der Phase des 2. Erhebungszeitpunktes – was im Informalisierungsprozess begründet sein könnte) feststellen: Waren es bei der Elektromontage eher Frisuren, welche die gesellschaftlichen Veränderungen belegen (vgl. Alheit 1994: 18; vgl. Abb. A23, A28, A29), so sind die Indikatoren im Bereich der Pflege Kleidungselemente (vgl. Wouters 2007: 185; vgl. Abb. A 5).
Beide Berufsgruppen, so konnte in Hinblick auf berufliches Selbstverständnis beobachtet werden, haben sich als eigenständige Profession entwickelt; in beiden Fällen war zu beobachten, dass der Beruf zum Zeitpunkt 1984 aus eigenen Reihen ausgebildet wurde (vgl. Abb. 2, 6), zum letzten Zeitpunkt wurden Weiterentwicklungsmöglichkeiten angedeutet (vgl. Abb. A15, 8). Mit Bezug auf den letzten Erhebungszeitpunkt lässt die Darstellung der Krankenpflege Vielfalt als „kaum fassbares Gehäuse für die persönliche Entfaltung und Selbstverwirklichung“ (Bühler 2005: 52) erkennen. Das verwunderte Schauen des erfahrenen Elektrofachmanns (vgl. Abb. A35) und an das nachdenkliche „In-die-Zukunft-Blicken“ der Krankenschwester (vgl. Abb. 15), lassen Veränderungen beruflicher Identitätsbezüge im Strome der Zeit erahnen.
Jeweils zum letzten Erhebungszeitpunkt waren Hinweise auf Differenzierung erkennbar – im Elektrobereich durch die Innovation digitaler Informationsressourcen (vgl. Abb. 8) und der Pflege durch die Splittung in Alten- und Kranken- bzw. Gesundheitspflege (vgl. Fischer 2013: 24; vgl. Abb. A11, A12, A15). Damit einhergehend hat sich die Komplexität beruflicher Inhalte erhöht (vgl. Tiemann 2014: 161). Für beide Berufsfelder lässt sich auch eine Abkehr von körperlich schwerer Arbeit beobachten, wohingegen die Bedeutung von Wissen und Kreativität zu Zeiten der Informatisierung an Bedeutung zunimmt (vgl. Groth et al. 2020: 16; vgl. Abb. A15, A31). Besonders die Bildinhalte des jüngsten Erhebungszeitpunktes appellieren an die individuelle Bereitschaft sich flexibel fortzubilden und Kompetenzen zu erwerben, anstatt darauf zu vertrauen, die Erwerbsbiografie mit einst erworbene Qualifikationsabschlüssen erfolgreich gestalten zu können (vgl. Arnold 1999: 17). Die Gewissheit stetigen Um- und Hinzulernens erscheint als einzig sinnvolle Maßnahme in Anbetracht beruflicher Unübersichtlichkeit und Unsicherheit (vgl. Gruber 2001: 139). Die mit der Modernisierung einhergehende Flexibilisierung ist Ursache von Freisetzungsprozessen (vgl. ebd.: 92).
Das „Zurückschrauben des Berufsbezuges“ (Beck 1986: 243) konnte nur für die Elektromontage (und im Gegensatz zur Publikation von 2016 nur 2018) bestätigt werden. Damit konnte Computerisierung als Triebfeder von Differenzierung (vgl. Tiemann 2014: 182) in der Elektromontage konstatiert werden. Die auf Spezialisierung hindeutende Fotografie (vgl. Abb. A35) stellt eine Abkehr von der Homogenität der Tätigkeiten innerhalb einer Berufsgruppe dar, wodurch die Abhängigkeit der Individuen voneinander wächst (vgl. ebd.: 16). Während das Identifikationspotential der Krankenpflege als hoch geblieben kommuniziert wird (vgl. Fischer 2013: 66), kann sie besonders zum jüngsten Erhebungszeitpunkt der Elektromontage als „etwas Dynamisches, Veränderliches“ (ebd.: 106) gelesen werden.
Die Lehrbuchgestaltung unterscheidet sich stark zwischen beiden Berufsgruppen. Die Krankenpflege, als Beruf mit starken menschlichen Bezügen, bildet häufiger Personen ab. Herausstechend ist der jüngste Erhebungszeitpunkt, bei dem die gesamte Sparte von Spezialisierungsrichtungen dargestellt ist. Einst eng definierter Aufgabenbereiche und überschaubares Fachwissen quantifizierten sich im Laufe der Jahrzehnte und führten zu beruflicher Differenzierung (vgl. Gruber 2001: 38). Bei der Berufsgruppe der Elektromontage werden vielfach Werkzeuge schematische Darstellungen, Baupläne und Maschinen abgebildet, Menschen - wo überhaupt vorhanden - haben eher veranschaulichenden Charakter. Durch die Abbildungen in Lehrpublikationen jüngsten Datums beider Berufsgruppen wird offensichtlich die (begrenzte) Aufweichung von Geschlechtergrenzen kommuniziert. Auf welche Weise? Die Frau ruft vom Tabletcomputer Informationen ab und steht optisch vor dem älteren Kollegen bzw. womöglich Vorgesetzten, durch diese Bildkonstruktion bestimmt sie das Geschehen in der klassischen Männerdomäne der Elektroberufe (vgl. Abb. A31). Die Lehrschrift zum beruflichen Selbstverständnis von Pflegefachkräften verwendet äquivalent das Bild des strahlenden Altenpflegers der dem Patienten (und damit dem Publikum) zugewandt darstellt wird, während das Gesicht des Patienten nicht einsehbar ist (vgl. Abb. A16). Auch hier, in der bis heute typischen Frauendomäne, wird eine Fotografie in der Publikation (sogar zweimal) verwendet, um eine Wende in Bezug auf berufsspezifische Geschlechtsabgrenzungsvorstellungen zu vermitteln.
Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Kategorienbildung und stellt besonders markante Beobachtungsresultate heraus.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Markante Beobachtungsresultate
6 Reflexion der Gütekriterien
Für das Gelingen qualitativer Forschung ist die Berücksichtigung ihrer inhärenten Eigenlogik hinsichtlich der Planung des Projekts unabdingbar (vgl. Fuhs 2007: 14). Folglich können Validität, Reliabilität und Objektivität als Gütekriterien nicht direkt aus dem Bereich quantitativer Forschung übertragen werden (vgl. Fuhs 2007: 17; Steinke 1999: 204). Vielmehr soll an dieser Stelle das Vorgehen anhand der von Steinke vorgeschlagenen Gütekriterien qualitativer Forschung diskutiert werden. Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit als Hauptaspekt und Grundlage der Überprüfbarkeit weiterer Kriterien (vgl. Steinke 1999: 209) wurde mittels umfassender Dokumentation des Forschungsprozesses umgesetzt (vgl. ebd.: 208). Transparenz wurde durch detaillierte Offenlegung von Methode, Daten und Vorverständnis geschaffen. Einschränkend sei erwähnt, dass die Analyse durch den Autor allein erfolgte, wohingegen eine Interpretation in Gruppen zusätzliche Erkenntnisse zutage gefördert hätte bzw. es möglich gewesen wäre eventuell entdeckte Lücken zu schließen (vgl. ebd.: 214; Pilarczyk und Mietzner 2005: 149 f.). Hierbei ist die Auswahl der Quellen zentral. Dies betrifft einerseits die Wahl der entsprechenden Lehrpublikation, andererseits aber auch die Frage welche konkrete Fotografie als hervorstechend und damit untersuchungsrelevant eingestuft werden kann. Wie bereits oben gezeigt, bleibt dieser Aspekt zu einem gewissen Grad intuitiv. Zur Gewähr der Indikation des Forschungsprozesses wurde besonderes Augenmerk auf Methoden- und Quellenwahl gelegt. Methodische Entscheidungen während des Forschungsprozesses verhalfen die Güte der Ergebnisse zu verbessern (vgl. Steinke 1999: 215). Im Laufe der Analyse fiel auf, dass die Hinzufügung von Beobachtungsergebnissen aus den Kontexten Lehrbuch und ausgewählter Kontrastbilder zu einem Mehr an Objektivität führen würde, allerdings gewann dabei die Frage nach den Auswahlkriterien der Zusatzbilder an Gewicht (vgl. Beck 2003: 69). Die Methode Becks erwies sich als angemessenes Werkzeug zur Beantwortung der Forschungsfragen, wodurch der Forschungsprozess intersubjektiv überprüfbar wird. Die Methode wurde dem Forschungsinteresse entsprechend angepasst, wodurch ein Erheben nicht relevanter Inhalte und ein gewisses Maß an Redundanz reduziert werden konnte. Die Nähe der Theoriebildung zu empirischen Daten (vgl. Steinke 1999: 221) wurde durch ein fundierte Einbettung in den theoretischen Unterbau zu erreichen gesucht. Auch hier sei einschränkend erwähnt, dass der Rahmen der Arbeit eine begrenzte Auswahl erforderte. Die unterschiedlichen Abstraktionsebenen der Analyse (Einzelbildbeobachtungen, Globalcharakteristiken, Vergleiche über den Zeitverlauf sowie zwischen den Berufsgruppen) führten zu einer systematischen Zusammenführung der Beobachtungsergebnisse mit den einschlägigen Theorien. Zum Erreichen von Limitation wurden Formulierungen nicht unabhängig von Zeit und Kontext gültiger Theorien gemacht, auch wurde versucht Verallgemeinerungen zu finden und Grenzen der gemachten Beobachtungsresultate aufzuzeigen (vgl. Steinke 1999: 227). Diese Grenzen bestehen vor allem im Rahmen der Arbeit und im Feldzugang, wodurch die Möglichkeit der Analyse weiterer Erhebungszeitpunkte (vorteilhaft wäre eine weitere Quelle für den Zeitraum zwischen 1935 und 1955 gewesen) und der Abbildung weiterer Berufsgruppen (z.B. eines akademischen Berufsbildes) nicht ausgeschöpft werden konnte. Für die Sicherung reflektierter Subjektivität dürfen Untersuchungsobjekt und -subjekt nicht voneinander getrennt werden (vgl. ebd.: 231). Einerseits wurde diesem Aspekt dadurch Rechnung getragen, dass versucht wurde die Analysedetails wo immer möglich umgangssprachlich zu formulieren. Damit konnte der Moment des subjektiven Bildeindrucks zu den einzelnen Leitfadenfragen auf den Betrachtenden realistisch eingefangen werden, wenngleich sich dabei der Nachteil zur Mehrung von Redundanz verschob. Auch hatte der Autor durch die handwerkliche Grundausbildung und seine gegenwärtige Tätigkeit im medizinischen Netzwerk umfassende Vorkenntnisse zur Gegenwart der spezifisch untersuchten Berufsfelder. Gleichzeitig wurde aufgrund der Betrachtung historischer Fotografien eine gewisse persönliche Distanz und Interesse gewahrt. Kohärenz, d.h. die Herstellung konsistenter Theorien wurde mit stringenter Einfügung in den Forschungskontext und strikte Weiterverfolgung beobachteter Anhaltspunkte zu erreichen gesucht (vgl. ebd.: 241). Wo sich Widersprüche ergaben, so z.B. bei unterschiedlichen Lesarten, wurden diese jeweils präsentiert, die wahrscheinlichste Variante begründet und als solche kenntlich gemacht. Die Relevanz der Fragestellung ist vor dem Hintergrund der dargestellten sozialen Veränderungen sowie der bislang nur selten genutzten Fotoanalyse unumstritten (vgl. Steinke 1999: 245 ff.). Es konnte hinreichend belegt werden, dass eine Reihe von Aspekten beruflicher Identität durch Bildinhalte transportiert werden. Die Verallgemeinerung der Erkenntnisse stößt jedoch beim Feldzugang an ihre Grenzen. Durch die Fotoanalyse lassen sich sehr wertvolle Zusatzinformationen über die Entwicklung von Berufen und der Gestaltung beruflicher Lehrmittel gewinnen. Als letztes Gütekriterium soll ein Blick auf Offenheit geworfen werden. Ziel war es, im Verlauf der Untersuchung nicht bereits bekanntes Wissen als Ausgangspunkt zu nehmen, sondern den Untersuchungsgegenstand sprechen zu lassen (vgl. ebd.: 35). Dies führte zwar zu einer größeren Menge gesammelter Daten, hatte dafür aber den Vorteil die Gefahr zu mindern, subjektive Vorüberlegungen in die Fotografien hineinzudeuten. Auch hier mag einschränkend gesagt werden, dass die forschungsleitende Fragestellung im Rahmen der Analyse unvermeidbar ist und damit der beobachtende Blick zuungunsten von Offenheit einer gewissen Lenkung unterworfen ist.
7 Bildungswissenschaftliche Implikation
Die Untersuchungsergebnisse belegen die berufssoziologischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte. Wie steht es um berufliche und persönliche Identität? Lange Zeit fand die Verbindung von beruflicher Identität und Engagement zu wenig Beachtung (vgl. Rauner 2019: 206). Ihre Herausbildung beruht auf gemeinsam verbrachter Zeit (vgl. Luckmann und Dreher 2007: 191). Gemeint ist Zeit, die Auszubildende im Lehrbetrieb mit Berufsausbilder*innen oder mit Lehrbüchern (und dem Betrachten der Fotografien) verbringen. In diesen Feldern ist es möglich berufsspezifisch Prägnantes, so in Szene zu setzen, dass Identität gestiftet werden kann. Aus Sicht vorliegender Arbeit ist den Fotografien bei der Lehrbuchgestaltung ein höherer Wert beizumessen. Die Tatsache, dass ein Großteil berufsbildender Literatur keine Abbildungen von Berufsvertreter*innen beinhaltet, kann als verpasste Chance für den Transport berufsspezifischer identitätsbildender Aspekte gesehen werden. Fotos beeinflussen das Wissen und liefern „Modelle für die eigene Person“ (Pilarczyk und Mietzner 2005: 26).
Dass sich Berufe und damit Elemente beruflicher Identität wandeln, liess sich durch die Untersuchung bestätigen. Damit gewinnt die Frage nach Möglichkeiten der Stärkung beruflichen Selbstbewusstseins an Bedeutung. Der Weg von der jahrzehntelang zentralen Vermittlung praxisnahen Faktenwissens und -könnens zum Konzept der Schlüsselqualifikation mit einer breiter gefassten Entwicklung individueller Fertigkeiten (vgl. Arnold 1999: 17), schwächte die Prägnanz einiger Berufsbilder. Diese Tendenz verstärkend betont der in jüngster Zeit populär gewordene Kompetenzbegriff (vgl. Vonken 2012: 9) „generalisierte, kontextunabhängige und nur begrenzt erlernbare Dispositionen» (Artelt 2009: 221; vgl. Abb. A35). Damit wird berufliche und persönliche Identitätsfindung erschwert. Es müssen neben der Vermittlung spezifischer beruflicher Qualifikationen weitere Ankerpunkte für die Identitätsbildung geschaffen werden. Diese können durchaus in einer im Lehrplan der Berufe verankerten, mit entsprechenden Fotografien versehenen Retrospektive des spezifischen Berufsbildes bestehen. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Schaffung von Lehrpublikationen zur Stärkung des beruflichen Selbstverständnisses für den beruflichen Unterricht. Als diesbezüglich mustergültiges Beispiel erwies sich die untersuchte Broschüre „Pflege als Beruf - berufliches Selbstverständnis entwickeln.“ (Berga 2014). Der Aufbau solcher Lehrmittel sollte die Einbettung des jeweiligen Einzelberufes in den Branchenzweig, seine Abgrenzung von Spezialisierungsrichtungen; Fort- und Weiterbildungsweg sowie die internationale Situation des Berufsbildes einschließen.
8 Schluss
Im Fazit trugen die festgestellten Beobachtungen dazu bei, die Entwicklung beider Professionen - der Krankenpflege und der Elektromontage - sowie parallel verlaufender soziologischer Veränderungen besser zu verstehen. Zu den Kategorien berufliche Geschlechtsspezifik, berufliches Selbstverständnis (bzw. Identität), äußeres Erscheinungsbild und Buchgestaltung verdichtet, ließen sich Belege für fortschreitende Informalisierung, Individualisierung und berufliche Differenzierung extrahieren. Bestätigung fand auch die wachsende Bedeutung beruflicher Kompetenz. Damit einhergehend fanden sich speziell für den Bereich der Elektromontage Hinweise auf eine Verwässerung beruflicher Identität; Flexibilität und die stetige Bereitschaft sich weiterzubilden, sind aktuell zentrale Erwartungen für die Elektrobranche. Die Pflegeberufe betonen die Fähigkeit zur Emotionsarbeit und zur Bereitschaft einerseits teils monotone, andererseits ggf. geistig anspruchsvolle Tätigkeit auszuführen. In beiden Feldern zeigte sich eine Aufweichung der Geschlechtergrenzen und die gestalterische Abkehr von der visuellen Kommunikation schwerer körperlicher Arbeit.
Im methodologischen Fazit hat sich Beck´s Frageleitfaden als nützliches Werkzeug für die Erhebung erwiesen. Er ist übersichtlich und erschließt optimal die relevanten Sinngehalte, dennoch konnte er flexibel angepasst werden, um das Material so offen wie möglich zu untersuchen (vgl. Beck 2003: 55). Mit den Fragen konnten die Bildmerkmale in ausreichenden Umfang erfasst und Rückschlüsse auf die Forschungsfragen gezogen werden. Einschränkend ließ sich jedoch feststellen, dass in einer Reihe von Fachbüchern kaum oder gar keine Abbildungen von Berufsvertreter*innen zu finden sind. Die während des Analyseprozesses durch verstärktes Hinzuziehen des Kontextes angepasste Vorgehensweise hat belegt, dass es durchaus fruchtbar sein kann, auch Fachbücher ohne Fotografien als Dokumente auf idealisierende Bemerkungen, bzw. Voraussetzungen und Erwartungen an die künftigen Fachkräfte, hin zu untersuchen. Eine Analyse anderer Berufsgattungen könnte dazu beitragen, die gemachten Beobachtungen zur Entwicklung und Wandel beruflicher Identität klarer zu fassen und deutlichere Aussagen bezüglich einer Verallgemeinerung der Ergebnisse zu machen.
Im Ausblick bieten Fotografien zu Entwicklung und Wandel beruflicher Tätigkeit aus andersartigen Quellen, bspw. der Presse oder Lexika, ein weiteres Feld, das mehr Aufmerksamkeit verdient. Auch diese Bilder können (und konnten) identitätsstiftend sein und bei Jugendlichen den Wunsch erwecken eine Berufsausbildung im entsprechenden Bereich zu beginnen. Zudem wären für Erhebungszeitpunkte nach 1960 Befragungen in Interviews eine Möglichkeit den Erkenntnisstand der Entwicklung und Entstehung beruflicher Identität in den einzelnen Berufen vertieft zu analysieren. Auch wenn der Forschungsfokus auf dem Identitätsbezug lag, erwiesen sich die untersuchten Quellen als inhaltsreich für die Untersuchung der Berufssoziologie und die Entwicklung der Lehrbuchgestaltung.
Die Resultate der Arbeit tragen dazu bei, eine Forschungslücke zu verringern und vertiefteres Verständnis zur Entwicklung beruflicher Identität zu eröffnen. Die Untersuchung von Spuren latenter Sinnstrukturen von Bildern in Lehrbüchern (vgl. Kleemann et al. 2009: 116), verhilft dabei, zu einem genaueren Verständnis der objektiven Realität im Verborgenen wirkender Deutungsmuster (vgl. ebd.: 113) zu gelangen. Aus bildungswissenschaftlicher Sicht konnte das Verständnis der immensen Bedeutung von Fotografie bei der Gestaltung von Lehrmedien anhand der verwendeten Praxisbeispiele veranschaulicht werden.
Literaturverzeichnis
Alheit, Peter (1994): Zivile Kultur. Verlust und Wiederaneignung der Moderne. Frankfurt/Main: Campus-Verl.
Arens, Markus; Ganguin, Sonja; Treumann, Klaus Peter (2007): Arbeitskraftunternehmer als E-Learner in der beruflichen Bildung. Ein Vergleich zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. In: Jürgen Mansel und Heike Kahlert (Hg.): Arbeit und Identität im Jugendalter. Die Auswirkungen der gesellschaftlichen Strukturkrise auf Sozialisation. Weinheim, München: Juventa Verlag (Jugendforschung), S. 201–217.
Arnold, Rolf (1999): Schlüsselqualifikationen aus berufpädagogischer Sicht. In: Rolf Arnold und Hans-Joachim Müller (Hg.): Kompetenzentwicklung durch Schlüsselqualifizierung. Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren (Grundlagen der Berufs- und Erwachsenenbildung, 19), S. 17–26.
Artelt, Cordula (2009): Über den Nutzen von Kompetenztaxonomien für die Auswahl und Definition von zentralen Kompetenzen im höheren Erwachsenenalter. In: Jürgen Kocka und Ursula M. Staudinger (Hg.): Altern in Deutschland. Halle (Saale), Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH (Nova acta Leopoldina, n.F., Bd. 99-106, Nr. 363-371), S. 221–232.
Ballstaedt, Steffen-Peter (1996): Bildverstehen, Bildverständlichkeit - Ein Forschungsüberblick unter Anwendungsperspektive. In: Hans P. Krings (Hg.): Wissenschaftliche Grundlagen der technischen Kommunikation. Tübingen: Narr (Forum für Fachsprachen-Forschung, 32), S. 191–234.
Ballstaedt, Steffen-Peter (1997): Wissensvermittlung. Die Gestaltung von Lernmaterial. Weinheim: Beltz Psychologie-Verl.-Union.
Ballstaedt, Steffen-Peter; Will, Hermann (1994): Lerntexte und Teilnehmerunterlagen. 2., neu ausgestattete Aufl. Weinheim: Beltz (Beltz Weiterbildung, hrsg. von Hermann Will; Bd. 2).
Baumann, Hubert (1956): Neuere Strukturwandlungen im Handwerk und ihre Ursachen. Inaugural-Dissertation. Hamburg: Photodruck Photo Copie GmbH.
Beck, Christian (2003): Fotos wie Texte lesen: Anleitung zur sozialwissenschaftlichen Fotoanalyse. In: Yvonne Ehrenspeck und Burkhard Schäffer (Hg.): Film- und Fotoanalyse in der Erziehungswissenschaft. Ein Handbuch. Wiesbaden, s.l.: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 55-72.
Beck, Ulrich (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. 1. Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Edition Suhrkamp, 1365 = Neue Folge Band 365).
Berga, Joachim (2014): Pflege als Beruf - berufliches Selbstverständnis entwickeln. Unter Mitarbeit von Ursula Kocs und Thomas Kratz. 1. Aufl. Köln: Bildungsverlag EINS (Kompetente Pflege).
Betz, Georg (1992): Krankenpflege im Wandel. Konsequenzen für die berufliche Bildung. In: prognos (Hg.): Auf dem Weg aus der Pflegekrise? Neue Ideen und Lösungsansätze in der Krankenpflege. Berlin: Ed. Sigma, S. 193–208.
Boehm, Gottfried (1978): Zu einer Hermeneutik des Bildes. In: Hans-Georg Gadamer und Gottfried Boehm (Hg.): Seminar: Die Hermeneutik und die Wissenschaften. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp-Taschenbuch-Verl. (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 238), S. 444–472.
Borsi, Gabriele M.; Schröck, Ruth (1995): Pflegemanagement im Wandel. Perspektiven und Kontroversen; mit 11 Tabellen. Berlin: Springer.
Botkin, James W.; Elmandjra, Mahdi; Maliţa, Mircea; Peccei, Aurelio; Bischoff, Ursula (1981): Das menschliche Dilemma. Zukunft und Lernen. 4. Aufl. Wien: Molden.
Bühler, Caroline (2005): Vom Verblassen beruflicher Identität. Fallanalysen zu Selbstbildern und Arbeitsethiken junger Erwerbstätiger. Zugl.: Bern, Univ., Diss, 2004 u.d.T.: Bühler, Caroline: Berufliche Identität im Wandel. Zürich: Seismo (Schriften zur sozialen Frage, 2). Online verfügbar unter http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=2661141&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm, (aufgerufen am 05.10.2021).
Bühler, Caroline (2007): Zwischen Flexibilität und Resignation. Berufliche Identität junger Erwachsener. In: Jürgen Mansel und Heike Kahlert (Hg.): Arbeit und Identität im Jugendalter. Die Auswirkungen der gesellschaftlichen Strukturkrise auf Sozialisation. Weinheim, München: Juventa Verlag (Jugendforschung), S. 33–47.
Bundesagentur für Arbeit (2021): Die Arbeitsmarktsituation von Frauen und Männern 2020. Unter Mitarbeit von Kirsten Singer. Hg. v. Bundesagentur für Arbeit. Nürnberg. Online verfügbar unter https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Frauen-und-Maenner/generische-Publikationen/Frauen-Maenner-Arbeitsmarkt.pdf?__blob=publicationFile, (aufgerufen am 03.09.2021).
Drewniak, Ute (1992): Lernen mit Bildern in Texten. Untersuchung zur Optimierung des Lernerfolgs bei Benutzung computerpräsentierter Texte und Bilder. Zugl.: Giessen, Univ., Diss., 1992. Münster: Waxmann (Internationale Hochschulschriften).
Ertl, Hubert (2005): Das Kompetenzkonzept: Zugänge zur Diskussion in der deutschen Berufs- und Wirtschaftspädagogik. In: Hubert Ertl und Peter F. E. Sloane (Hg.): Kompetenzerwerb und Kompetenzbegriff in der Berufsbildung in internationaler Perspektive. Paderborn: Eusl-Verl.-Ges (Wirtschaftspädagogisches Forum, 30), S. 22–45.
Ertl, Hubert; Sloane, Peter F. E. (2005): Einführende und zusammenführende Bemerkungen: Der Kompetenzbegriff in internationaler Perspektive. In: Hubert Ertl und Peter F. E. Sloane (Hg.): Kompetenzerwerb und Kompetenzbegriff in der Berufsbildung in internationaler Perspektive. Paderborn: Eusl-Verl.-Ges (Wirtschaftspädagogisches Forum, 30), S. 4–20.
Feldmann, Nathalie; Gartze, Ophelia; Löw, Katharina; Rische, Catharina; Schaffanczik (2020): Gesammelte Werke: Arbeitskultur in volkskundlichen Sammlungen revisited. In: Stefan Groth, Sarah May und Johannes Müske (Hg.): Vernetzt, entgrenzt, prekär? Kulturwissenschaftliche Perspektiven auf Arbeit im Wandel. Frankfurt, New York: Campus Verlag (Arbeit und Alltag), S. 153–170.
Fellmann, Ferdinand (1991): Symbolischer Pragmatismus. Hermeneutik nach Dilthey. Orig.-Ausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl. (Rowohlts Enzyklopädie, 508).
Feßler, Julius (Hg.) (1923): Erster Unterricht in der Krankenpflege. (für Haus und Beruf). 7. Aufl. München: Verlag der Aerztlichen Rundschau Otto Gmelin.
Fischer, Renate (2013): Berufliche Identität als Dimension beruflicher Kompetenz. Entwicklungsverlauf und Einflussfaktoren in der Gesundheits- und Krankenpflege. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag (Berufsbildung, Arbeit und Innovation - Dissertationen und Habilitationen, v.26). Online verfügbar unter http://gbv.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=1605119, (aufgerufen am 15.11.2021).
Fuchs, Eckhardt; Niehaus, Inga; Stoletzki, Almut (2014): Das Schulbuch in der Forschung. Analysen und Empfehlungen für die Bildungspraxis. Göttingen: V&R unipress (Eckert. Expertise / Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung, Band 4).
Fuhs, Burkhard (2003): Fotografie als Dokument qualitativer Forschung. In: Yvonne Ehrenspeck und Burkhard Schäffer (Hg.): Film- und Fotoanalyse in der Erziehungswissenschaft. Ein Handbuch. Wiesbaden, s.l.: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 37–54.
Fuhs, Burkhard (2007): Qualitative Methoden in der Erziehungswissenschaft. Darmstadt: Wiss. Buchges (Grundwissen Erziehungswissenschaft). Online verfügbar unter http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=2944993&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm, (aufgerufen am 21.08.2021).
Geißler, Karlheinz A. (1991): Das Duale System der industriellen Berufsausbildung hat keine Zukunft. In: Leviathan 19 (1), S. 68–77. Online verfügbar unter https://www.jstor.org/stable/pdf/23984236.pdf?refreqid=excelsior%3A758dd3e5505a9ae69b0365751cbb9398, (aufgerufen am 09.07.2021).
Grabowski, Ute (2007): Berufliche Bildung und Persönlichkeitsentwicklung. Forschungsstand und Forschungsaktivitäten der Berufspsychologie. Zugl.: Flensburg, Univ., Diss., 2004. 1. Aufl. Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl. (Sozialwissenschaft). Online verfügbar unter http://swbplus.bsz-bw.de/bsz267604327cov.htm, (aufgerufen am 21.06.2021).
Grote, Gudela; Raeder, Sabine (Hg.) (2004): Berufliche Identität unter den Bedingungen zunehmender Arbeitsflexibilisierung. Bern: NFP (Synthesis / Nationales Forschungsprogramm Bildung und Beschäftigung NFP Nr. 43, 14).
Groth, Stefan; May, Sarah; Müske, Johannes (Hg.) (2020): Vernetzt, entgrenzt, prekär? Kulturwissenschaftliche Perspektiven auf Arbeit im Wandel. Frankfurt, New York: Campus Verlag (Arbeit und Alltag).
Gruber, Elke (2001): Beruf und Bildung - (k)ein Widerspruch. Bildung und Weiterbildung in Modernisierungsprozessen. Innsbruck: Studien-Verl. (Bildung und gesellschaftliche Entwicklung, Bd. 4).
Häberle, Heinz O. (2016): Einführung in die Elektroinstallation. 8., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. München, Heidelberg: Hüthig (de Fachbuch).
Hentig, Hartmut von (2009): Bildung. Ein Essay. 8. Aufl. Weinheim: Beltz (Beltz-Taschenbuch Essay, 158).
Industriegewerkschaft Metall (1985): Qualifizierte Ausbildung für alle. Neuordnung der industriellen Metall- und Elektroberufe. Unter Mitarbeit von Hans Preiss. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Union-Druckerei.
Janssen, Peter (1916): Lehrbuch der Chirurgischen Krankenpflege für Pflegerinnen und Operationsschwestern. Leipzig: F.C.W. Vogel.
Kappelmüller, Irmgard; Dorfmeister, Alfred (1984): Allgemeine Krankenpflege. Mit 97 Abbildungen. 2., erw. Aufl. München: Urban & Schwarzenberg (U-und-S-Fachbuch).
Kaufmann, Anja (2010): Wandel der Berufe im Gesundheitswesen. Auswirkungen der Bildungsreformen auf über 50 Gesundheits- und Sozialberufe. 1. Aufl. Zürich: Careum.
Kleemann, Frank; Krähnke, Uwe; Matuschek, Ingo (2009): Interpretative Sozialforschung. Eine praxisorientierte Einführung. 1. Aufl. Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss (Lehrbuch).
Kluge, Friedrich (1995): Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 23., erw. Aufl. Berlin: de Gruyter.
Kurtz, Thomas (2010): Der Kompetenzbegriff in der Soziologie. In: Thomas Kurtz und Michaela Pfadenhauer (Hg.): Soziologie der Kompetenz. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss (Wissen, Kommunikation und Gesellschaft, Schriften zur Wissenssoziologie), S. 7–28.
Lempert, Wolfgang (2002): Berufliche Sozialisation oder Was Berufe aus Menschen machen. Eine Einführung. 2., überarb. Aufl. Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren (Grundlagen der Berufs- und Erwachsenenbildung, 16). Online verfügbar unter http://www.socialnet.de/rezensionen/isbn.php?isbn=978-3-89676-550-5, (aufgerufen am 23.06.2021).
Luckmann, Thomas; Dreher, Jochen (Hg.) (2007): Lebenswelt, Identität und Gesellschaft. Schriften zur Wissens- und Protosoziologie. Konstanz: UVK-Verl.-Ges (Erfahrung - Wissen - Imagination, 13). Online verfügbar unter http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=2900841&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm, (aufgerufen am 10.11.2021).
Mailn, Lydia; Risius, Paula; Jansen, Anika; Schirner, Sebastian; Werner, Dirk (2018): Fachkräftecheck Metall- und Elektroberufe. KOFA-STUDIE 3/2018. Hg. v. Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V. Institut der deutschen Wirtschaft. Köln. Online verfügbar unter https://www.kofa.de/fileadmin/Dateiliste/Publikationen/Studien/Fachkraeftecheck_Metall-_und_Elektroberufe_3_2018.pdf, (aufgerufen am 22.10.2021).
Mansel, Jürgen; Kahlert, Heike (2007): Arbeit und Identität im Jugendalter vor dem Hintergrund der Strukturkrise. Ein Überblick zum Stand der Forschung. In: Jürgen Mansel und Heike Kahlert (Hg.): Arbeit und Identität im Jugendalter. Die Auswirkungen der gesellschaftlichen Strukturkrise auf Sozialisation. Weinheim, München: Juventa Verlag (Jugendforschung), S. 7–32.
Mayer, Christian (2000): Berufsbildungstheorie unter dem Eindruck soziotechnologischen Wandels. Zugl.: Würzburg, Univ., Diss., 1999. Hamburg: Kovač (Schriftenreihe EUB, Erziehung - Unterricht - Bildung, 82).
Muckenhaupt, Manfred (1986): Text und Bild. Grundfragen der Beschreibung von Text-Bild-Kommunikation aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Zugl.: Tübingen, Univ., Habil.-Schr., 1983. Tübingen: Narr (Tübinger Beiträge zur Linguistik, 271).
Müller, Marion G. (2015): Grundlagen der visuellen Kommunikation. 2., völlig überarb. Aufl. Konstanz: UVK Verl.-Ges (UTB Medien- und Kommunikationswissenschaft, 2414). Online verfügbar unter http://www.utb-studi-e-book.de/9783838524146, (aufgerufen am 04.11.2021).
Oevermann, Ulrich; Allert, Tilman; Konau, Elisabeth; Krambeck, Jürgen (1979): Die Methodologie einer »objektiven Hermeneutik« und ihre allgemeine forschungslogische Bedeutung in den Sozialwissenschaften. In: Hans-Georg Soeffner (Hg.): Interpretative Verfahren in den Sozial- und Textwissenschaften. Stuttgart: Metzler, S. 352–433.
Ohlbrecht, Heike (2007): Die Bewältigung des kritischen Lebensereignisses chronische Krankheit im Jugendalter und die Auswirkungen auf die Identiätsarbeit - am Beispiel der Berufsfindung. In: Jürgen Mansel und Heike Kahlert (Hg.): Arbeit und Identität im Jugendalter. Die Auswirkungen der gesellschaftlichen Strukturkrise auf Sozialisation. Weinheim, München: Juventa Verlag (Jugendforschung), S. 133–147.
Pätzold, Günter; Reinisch, Holger; Wahle, Manfred (2015): Ideen- und Sozialgeschichte der beruflichen Bildung. Entwicklungslinien der Berufsbildung von der Ständegesellschaft bis zur Gegenwart. 2., überarb. und erg. Aufl. Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren (Studientexte Basiscurriculum Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Bd. 10).
Pilarczyk, Ulrike; Mietzner, Ulrike (2005): Das reflektierte Bild. Die seriell-ikonografische Fotoanalyse in den Erziehungs- und Sozialwissenschaften. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. Online verfügbar unter http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=20769, (aufgerufen am 16.11.2021).
Pöggeler, Franz (1992a): Versuch einer Typologie pädagogisch relevanter Bildformen. In: Franz Pöggeler (Hg.): Bild und Bildung. Beiträge zur Grundlegung einer pädagogischen Ikonologie und Ikonographie. Frankfurt am Main: Lang (Studien zur Pädagogik, Andragogik und Gerontagogik, 11), S. 11–52.
Pöggeler, Franz (1992b): Zur Bildlichkeit der Bildung. In: Franz Pöggeler (Hg.): Bild und Bildung. Beiträge zur Grundlegung einer pädagogischen Ikonologie und Ikonographie. Frankfurt am Main: Lang (Studien zur Pädagogik, Andragogik und Gerontagogik, 11), S. 331–338.
Pohl, H. (1903): Die Montage elektrischer Licht- und Kraftanlagen. Ein Taschenbuch für Elektromonteure, Installateure und Besitzer elektrischer Anlagen. Hannover: Verlag von Gebrüder Jänecke.
Rauner, Felix (2019): Ausbildungsberufe. Berufliche Identität und Arbeitsethik : eine Herausforderung für die Berufsentwicklung und die Berufsausbildung. Berlin: LIT (Pädagogik).
Reetz, Lothar (1999): Schlüsselqualifikationen aus bildungstheoretischer Sicht - in der berufs- und wirtschaftspädagogischen Diskussion. In: Rolf Arnold und Hans-Joachim Müller (Hg.): Kompetenzentwicklung durch Schlüsselqualifizierung. Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren (Grundlagen der Berufs- und Erwachsenenbildung, 19), S. 35–52.
Ricouer, Paul (1978): Der Text als Modell: hermeneutisches Verstehen. In: Hans-Georg Gadamer und Gottfried Boehm (Hg.): Seminar: Die Hermeneutik und die Wissenschaften. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp-Taschenbuch-Verl. (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 238), S. 83–117.
Russell Hochschild, Arlie (1979): Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure. In: American Journal of Sociology 85 (3), S. 551–5715. Online verfügbar unter https://www.jstor.org/stable/pdf/2778583.pdf?casa_token=Df1X1CIvdqEAAAAA:xkt2VR41yY48WssAAM4ofU2cly1efbT_kRBavSh0xXTifj8xMIGllZHBivNdi472ysdj-qt3v8kwV-vwZE1DO8ezZPFGph-t9E3-r1RWOfarQ--ik_AV, (aufgerufen am 26.10.2021).
Schaal, Dirk (2012): Bild und Ikonographie der Elektrizität. Über den Wahrnehmungs- und Bedeutungswandel einer Energieform seit dem instustriellen Zeitalter - Überlegungen für eine Ikonographie der Wirtschaft. In: Hendrik Ehrhardt (Hg.): Energie in der modernen Gesellschaft. Zeithistorische Perspektiven. Online-Ausg. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 33–56.
Schallberger, Urs; Häfeli, Kurt; Kraft, Ueli (1983): Die Rolle der Berufsausbildung für die Persönlichkeitsentwicklung: Hinweise aus einer Querschnittsuntersuchung. Projektgruppe A&P. Hg. v. Psychologisches Institut der Universität Zürich. Zürich.
Schallberger, Urs; Kraft, Ueli; Häfeli, Kurt (1988): Schlussbetrachtungen. In: Kurt Häfeli (Hg.): Berufsausbildung und Persönlichkeitsentwicklung. Eine Längsschnittstudie. Bern: Huber (Schriften zur Arbeitspsychologie, 44), S. 203–217.
Schlösser, Barbara (2012): Die Gestaltung moderner Lehrbücher. Eine Untersuchung am Beispiel betriebswirtschaftlicher Studienliteratur. Zugl.: Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 2011 u.d.T.: Schlösser, Barbara: Wie sollten Lehrbücher gestaltet sein, um den Motiven und Bedürfnissen Studierender gerecht zu werden? 1. Aufl. Baden-Baden: Nomos. Online verfügbar unter http://www.nomos-shop.de/_assets/downloads/9783832972844_lese01.pdf, (aufgerufen am 09.10.2021).
Schmolke, Herbert (2018): Elektroinstallation in Wohngebäuden. Handbuch für die Installationspraxis. 9., neu bearbeitete Auflage. Berlin, Offenbach: VDE VERLAG GmbH (VDE-Schriftenreihe Normen verständlich, 45).
Schoeck, Helmut (Hg.) (1972): Soziologisches Wörterbuch. Orig.-Ausg., 6. Aufl. Freiburg im Breisgau: Herder (Herderbücherei, 312).
Schröder, Marco: Nachwuchskräfte im Gesundheitssektor. Online verfügbar unter http://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/monatshefte/2018/August/08-2018-548.pdf, (aufgerufen am 19.07.2021).
Siemens, Peter v. (1968): Zum Geleit. In: Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie e. V. (Hg.): Elektrotechnik im Wandel der Zeit. 50 Jahre ZVEI. Unter Mitarbeit von Peter v. Siemens, Richard Vieweg, Trute, Hellmut, Walter Huppert, Bodo Böttcher et al. Mindelheim: W. Sachon, S. 5.
Spiegel, Monika; Popp, Reinhold (2019): Zukunft - Beruf - Gesundheit. In: Reinhold Popp (Hg.): Die Arbeitswelt im Wandel! Der Mensch im Mittelpunkt? Perspektiven für Deutschland und Österreich. Münster, New York: Waxmann (Psychotherapiewissenschaft in Forschung, Profession und Kultur, Band 24), S. 121–136.
Statistisches Bundesamt (2020): Gestiegenes Interesse an Pflegeberufen. Pressemitteilung Nr. N 070 vom 28. Oktober 2020. Online verfügbar unter https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/10/PD20_N070_212.html, zuletzt aktualisiert am 28.10.2020, (aufgerufen am 20.09.2021).
Steinke, Ines (1999): Kriterien qualitativer Forschung. Ansätze zur Bewertung qualitativ-empirischer Sozialforschung. Zugl.: Berlin, Techn. Univ., Diss., 1998 u.d.T.: Steinke, Ines: Kriterien für die Bewertung qualitativer Forschung. Weinheim, München: Juventa-Verl. (Juventa-Paperback).
Stöhr, Karsten; Sarstedt, Marko (2007): Erfolgsfaktoren von Fachbüchern. Unter Mitarbeit von Karsten Stöhr und Marko Sarstedt. München: peniope (Buchhandel der Zukunft, Bd. 8).
Stolz, Peter; Camenzind, Paul (1992): Innovationen, Beschäftigung und Arbeitswelt. Chancen und Risiken aus ökonomischer Sicht. Chur: Rüegger (WWZ-Beiträge, 10).
Streckeisen, Ursula; Estermann, Josef; Page, Julie (2013): Alte und neue Gesundheitsberufe: Eine Einführung. In: Josef Estermann, Julie Page und Ursula Streckeisen (Hg.): Alte und neue Gesundheitsberufe. Soziologische und gesundheitswissenschaftliche Beiträge zum Kongress "Gesundheitsberufe im Wandel", Winterthur 2012. 1. Aufl. Wien, Beckenried: LIT-Verl.; Orlux-Verl. (Studien zur Gesundheitsforschung, 4), S. 7–19.
Stubenrecht, Werner Scholze (1999): Brockhaus-Enzyklopädie. 19., völlig neu bearb. Aufl., Mannheim: Brockhaus.
Tiemann, Michael (2014): Homogenität von Berufen. Arbeit und Beruf im Wandel - Ein Blick auf die gesellschaftliche Differenzierung. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag (Berichte Zur Beruflichen Bildung). Online verfügbar unter http://gbv.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=1875910, (aufgerufen am 01.10.2021).
Verband Deutscher Elektrotechniker (1991): Die Entwicklung der Starkstromtechnik in Deutschland. Berlin: vde-Verl. (Geschichte der Elektrotechnik, 9).
Verband Schweizerischer Elektroinstallationsfirmen (VSEI) (1980): Der Elektromonteur. Zürich: Schweiz. Verband für Berufsberatung.
Vieweg, Richard (1968): Gedanken und Taten aus der Entwicklung der Elektrotechnik. Ein Bericht. In: Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie e. V. (Hg.): Elektrotechnik im Wandel der Zeit. 50 Jahre ZVEI. Unter Mitarbeit von Peter v. Siemens, Richard Vieweg, Trute, Hellmut, Walter Huppert, Bodo Böttcher et al. Mindelheim: W. Sachon, S. 7–42.
Vollmer, Randolph (1986): Die Entmythologisierung der Berufsarbeit. Über d. sozialen Wandel von Arbeit, Familie u. Freizeit. Zugl.: Frankfurt, Univ., Diss. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag (Beiträge zur sozialwissenschaftlichen Forschung, 82).
Vonken, Matthias (2012): Handlung und Kompetenz. Theoretische Perspektiven für die Erwachsenen- und Berufspädagogik. 1. Aufl. s.l.: VS Verlag für Sozialwissenschaften (GWV). Online verfügbar unter http://gbv.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=4099207, (aufgerufen am 27.08.2021).
Will, Hermann; Weidenmann, Bernd (Hg.) (1994): Mit den Augen lernen. 2., neu ausgestattete Aufl. Weinheim: Beltz (Beltz Weiterbildung).
Winkeler, Rolf (1992): Zum Bild des Lehrers in der Kunst des 19. Jahrhunderts. In: Franz Pöggeler (Hg.): Bild und Bildung. Beiträge zur Grundlegung einer pädagogischen Ikonologie und Ikonographie. Frankfurt am Main: Lang (Studien zur Pädagogik, Andragogik und Gerontagogik, 11), S. 213–246.
Wouters, Cas (2007): Informalization. Manners and emotions since 1890. Los Angeles, Calif: SAGE Publications (Theory, culture & society). Online verfügbar unter http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10256820, (aufgerufen am 07.08.2021).
Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie e. V. (Hg.) (1968): Elektrotechnik im Wandel der Zeit. 50 Jahre ZVEI. Unter Mitarbeit von Peter v. Siemens, Richard Vieweg, Trute, Hellmut, Walter Huppert, Bodo Böttcher et al. Mindelheim: W. Sachon.
Bildnachweis
Die folgenden Verlage haben in freundlicher Weise Genehmigung für die Verwendung der Abbildungen erteilt:
BMS Bildungsmedien Service GmbH, Georg-Westermann-Allee 66, DE-38104 Braunschweig: Abb. 3, 4, A11, A12, A13, A14, A15, A16.
VDE Verlag GmbH, Buchlektorat, Kaiserleistraße 8 A, DE-63067 Offenbach am Main: Abb. 8, A31, A35.
Hüthig GmbH, Im Weiher 10, DE-69121 Heidelberg: Abb. A32, A33, A34.
EIT.swiss, Limmatstrasse 63, CH-8005 Zürich: Abb. 6, 7, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30.
ELSEVIER EMEALA Health, Bernhard-Wicki-Str. 5, DE-80636 München (Urban und Schwarzenberg / U-&-S-Fachbuch): Abb. 2, A 5, A 6, A 7, A 8, A 9, A10.
Den Verlagen gilt ein herzlicher Dank für die Unterstützung.
Anhang
Anhangsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis Anhang
Anhang 1: Leitfaden
Anhang 2: Auswertung
Bildanalyse 1: Operationsschwester mit Infusionsapparat
Bildanalyse 2: Krankenpflegerin mit Plexiglasmaske 1984
Bildanalyse 3: Krankenpflegerin bei der Arztvisite
Bildanalyse 4: Montage elektrischer Licht- und Kraftanlagen 1903
Bildanalyse 5: Berufsbild Elektromonteur
Bildanalyse 6: Elektroinstallation in Wohngebäuden
Abbildungsverzeichnis Anhang
Abb. A 1: Infusionsapparat in Gebrauch
Abb. A 2: Anreichen einer Patientin
Abb. A 3: Zweibildserie künstliche Atmung a + b
Abb. A 4: Operationssaal in Benutzung
Abb. A 5: Krankenpflegerin mit Plexiglasmaske
Abb. A 6: Ansägen einer Ampulle
Abb. A 7: Aufziehen aus der Ampulle
Abb. A 8: Leintuchwechsel a
Abb. A 9: Leintuchwechsel b
Abb. A10: Verwendung der Nasenbrille
Abb. A11: Krankenpflegerin als Mitarbeiterin bei der Arztvisite
Abb. A12: Altenpflegerin bei der Arbeit
Abb. A13: Alltag auf der Pflegestation
Abb. A14: Korridor einer Bettenstation
Abb. A15: Krankenschwester
Abb. A16: Altenpflege als Beruf
Abb. A17: Größerer Drehstromgenerator
Abb. A18: Dynamomaschine im Aufbau
Abb. A19: Aufschrauben der Pole auf das Magnetgestell
Abb. A20: Westinghouse-Drehumformer in einer Unterstation
Abb. A21: Hauptschalttafel der Zentrale in Mexiko (Rückseite)
Abb. A22: Hauptschalttafel der Zentrale in Mexiko (Vorderseite)
Abb. A23: Montage der Kabelrohre im Rohbau
Abb. A24: Arbeit an der Ständerbohrmaschine
Abb. A25: Einziehen der Kabel in Kabelrohre
Abb. A26: Installation einer Telefonanlage
Abb. A27: Verkabelung eines Schaltkastens
Abb. A28: Anbringen eines Kabelkanales
Abb. A29: Installation von Deckenleuchten
Abb. A30: Einrichten eines Schaltkastens
Abb. A31: NormenBibliothek (vorderer Innenbuchdeckel)
Abb. A32: Mauerschlitzfräse mit automatischem Vorschub
Abb. A33: Pneumatisch angetriebener Stegleitungsnagler
Abb. A34: Kabelverlegung mit Montagehilfsrohr
Abb. A35: Normenauskunft (hinterer Innenbuchdeckel)
Anhang 1: Leitfaden
Beck’s Leitfaden will nicht als Regelwerk verstanden sein, sondern als Komplex interpretationsleitender Fragen, durch die das Spektrum ggf. relevanter Aspekte möglichst weit gehalten werden sollte (vgl. Beck, 2003, 62). „"Regel" bedeutet hier also nicht Verfahrensvorschrift, sondern bezeichnet eine Aufmerksamkeitsrichtung, die, wenn man sie systematisch verfolgt, helfen soll, für die thematisch relevanten Sinngehalte des Fotos so sensibel wie möglich zu werden.“ (ebd.).
Es folgt eine Auflistung und Begründung der Regeln, die in größtmöglichem Umfang wörtlich übernommen, und, wo nötig, auf die Besonderheiten der vorliegenden Arbeit angepasst wurde. Für die Analyse der Fotos wurden einige Fragen, die nicht für die Beantwortung der Forschungsfragen zielführend waren gekürzt bzw. völlig ausgelassen oder an anderer Stelle für alle Bilder als zentral geltend betrachtet.
Interpretationsleitfragen nach Christian Beck aus „Fotos wie Texte lesen. Anleitung zur sozialwissenschaftlichen Fotoanalyse“ in „Film- und Fotoanalyse in der Erziehungswissenschaft“, Ehrenspeck, Schäfer, Leske + Budrich, Opladen 2003, S. 62-65:
„Was ist das genaue Thema der Interpretation? (Fokussierung)“ (ebd.)
Da „Fotos in der Regel wohl mehr sinnhafte Inhalte aufweisen, als es die jeweilige Fragestellung der Untersuchung intendiert“ (ebd.), muss der Bildanalyse der Leitgedanke der Untersuchung (die Forschungsfrage) präsent sein. Das hilft dabei durch Bildeindrücke „nicht vom Thema abzuweichen“ (ebd.), auch „dient diese Frage interpretationsbegleitend immer wieder einer Vergewisserung und Konzentrierung der Aufmerksamkeit“ (ebd.).
Für das vorliegende Projekt bedeutet dies konkret nach Hinweisen zu beruflicher Identität zu suchen. Finden sich Anhaltspunkte - unter Berücksichtigung des historischen Zeitkontextes - dafür, dass berufliche Idealvorstellungen oder Erwartungshaltungen visuell transportiert, vermittelt oder erzeugt werden? Welche Bildmerkmale könnten die Identitätsfindung der Lernenden beeinflussen? Der Aspekt verliert im Rahmen vorliegender Analyse keineswegs seine Bedeutung, zur Vermeidung von Redundanz wird jedoch darauf verzichtet, diese Frage zu jedem Bild explizit zu beantworten. Vielmehr werden die folgenden Fragen stets unter dem Gesichtspunkt des Themas der Interpretation betrachtet. Im Rahmen der Fallanalyse jedes Bildes wird der Frage Rechenschaft getragen.
„Was sind die ersten Eindrücke der Interpretierenden? (bildhaftes Erleben)
a) vom Kontext (Ort, Zeit, Wetter, ...),
b) subjektive Assoziationen?“ (ebd.)
„Da ein Foto all das, was auf ihm abgebildet ist, sozusagen gleichzeitig präsentiert, besteht keine zwingende Interpretationsreihenfolge“ (ebd.). Allerdings interessiert hierbei die Frage, was zuerst auffällt (was von den Betrachtenden als erstes wahrgenommen wird), weil dieser Effekt die hierbei vermittelte Botschaft verstärkt (vgl. ebd.). Wie verändert sich dabei die Gewichtung des Sinngehalts des Fotos bei der intersubjektiven Wahrnehmung durch die Interpretierenden? (vgl. ebd.).
„Was empfinden die InterpretInnen, wenn sie die Personen auf dem Bild nachstellen? (Körperlichkeit)“ (Beck, 2003, 62)
Die Frage beleuchtet eine „Erfahrungsdimension“ (ebd.), durch die bildlich vermittelte Körpersprache nicht nur durch Anschauen erfasst, sondern durch den Körper der Betrachtenden gespürt, empfunden und entschlüsselt wird (vgl. ebd.).
Folgende Fragen werden gestellt: „Stimmen die InterpretInnen in der Gruppe mit ihren jeweiligen Empfindungen und Deutungen überein? Schlägt sich auch hier eine gemeinsam geteilte Sozialisation nieder? Empfinden Frauen und Männer verschieden - auf Grund von vielleicht unterschiedlichen weiblichen und männlichen Körperidealen und akzeptierten Weisen der Selbstdarstellung? (Dies ist ein besonders interessanter Punkt, der überhaupt erst bei der Methode Fotointerpretation hervortritt.)“ (ebd.).
Dieser Gesichtspunkt soll in vorliegender Untersuchung nur knapp betrachtet werden, da davon ausgegangen werden kann, dass die Antwortergebnisse kaum zu tieferen relevanten Erkenntnissen bezüglich der Forschungsleitfragen führen werden.
„Ist das Bild gestellt, ist es ein Schnappschuß? (Bildgattung)“ (ebd.)
„Bei gestellten Aufnahmen [- wie in allen im Projekt verwendeten Quellen im Vorfeld der Untersuchung angenommen -] sind bei der Interpretation mögliche Strategien der Selbstdarstellung der abgebildeten Personen heranzuziehen. Darüber hinaus gehören solche Fotos häufig einer bestimmten Bildgattung an, wie z.B. Hochzeits- oder Kommunionfoto, Urlaubs- oder Freundschaftsbild u.a. Die Interpretierenden verfügen im allgemeinen über ein sozio-kulturell geteiltes Wissen darüber, wie man sich bei solchen Anlassen bei einem Foto angemessen präsentieren kann, und deshalb sind die Interpretierenden auch fähig, die (Selbst-)Darstellung anderer angemessen zu deuten. Entspricht die Kleidung, die Pose, die Geste etc. dem Genre? Wo gibt es Abweichungen - und was konnten sie bedeuten?“ (Beck, 2003, 62 f.). Die gestellte Frage verhilft das Foto gedankenexperimentell zu wandeln. Was würde sich am Sinngehalt ändern, wenn prägnante Elemente fehlen würden – oder abgewandelt präsentiert würden? Beim Übergang des direkten, ostentativen Momentes der Aufnahme zur Eröffnung nichtsituativer, überdauernder Bezüge, stellt sich die Frage danach, zu welcher der beiden Kategorien sich das Foto eher zuordnen lässt (vgl. Beck, 2003, 58).
Auf diesen Punkt im Frageleitfaden von Beck kann im Rahmen des Forschungsprojektes verzichtet werden, da die in Lehrbüchern und Berufsbildern verwendeten Bilder vielfach gestellt sind. Die explizite und konsequente Anwendung dieser Analysefrage (wie auch im Fall der Frage nach der Intention der Fotograf*innen) führt zu Redundanz und Schwächung der Aussagekraft der Analyseergebnisse.
„Was ist auf dem Bild zu sehen? (Versprachlichung) Welche Bedeutung drückt es aus? (Sinngehalt)“ (Beck, 2003, 63)
„Zum Zweck der Interpretation und für die gemeinsame Arbeit in der Gruppe müssen Bildelemente und -gehalte versprachlicht werden“ (ebd.). Die Interpretation des Fotos über die Sprache erfasst in diesem Schritt die Bildinhalte zusammenfassend, wodurch der Anschluss der Fotointerpretation an die Hermeneutik legitimiert wird (ebd.). Diese praxisbezogene Regel macht die schrittweise Eingrenzung, Transformation und Deutung bewusst, sodass zielgerichtet und systematisch operiert werden kann. (vgl. ebd.).
„Gibt es etwas, das die Interpretierenden auf dem Bild erwartet hätten, was aber fehlt? (Interpretation des Nicht-Vorhandenen)“ (ebd.)
„Jedes Foto besitzt potentiell in gewisser Weise einen "Schatten", der sich jedoch erst der deutenden Wahrnehmung zeigt.“ (ebd.). Es könnte sein, dass auf dem untersuchten Bild (das voraussichtlich typische Berufsvertreter bei ihrer Arbeit darstellt), erwartete Insignien – Werkzeuge, Berufskleidung etc. – fehlen (vgl. ebd.). „Auf jeden Fall ist auch das ein wichtiges Ergebnis: Welche Gründe konnte es für ein solches Fehlen geben? Welcher spezifische Sinngehalt drückt sich hierin aus?“ (ebd.).
„Wie ist das Bild aufgebaut? Was ist zentral? (optische Gewichtung)“ (ebd.).
„Die Fotografie hat im Lauf ihrer Entwicklung - ausgehend von spezifischen Wahrnehmungswirkungen - eine Reihe von Positionierungsregeln entwickelt bzw. aus der Malerei übernommen (Bilddrittelung, goldener Schnitt, Perspektive, Überlappungen, Lichtwirkung u.a.). Läßt sich nun an Hand eines konkreten Fotos vermuten, daß mit solchen Stil- und Betonungsmitteln gearbeitet wurde? (Dies setzt einen Fotografen bzw. eine Fotografin voraus, die entsprechend in gewissem Grad geschult sind.) Falls ja: Welche Wirkung wurde wohl angestrebt, welche Bedeutung läßt sich dem entnehmen?“ (ebd.).
„Wie sehen die abgebildeten Personen aus (Gestik, Mimik, Haltung, Kleidung)? Wie ist ihr Verhältnis zueinander?“ (Beck, 2003, 63).
„a) Wie mochten sich die Personen möglicherweise darstellen (subjektiv-intentional)?
b) Wie stellen sie sich faktisch für die InterpretInnen dar (objektiv-latent)?
c) In welchem Verhältnis stehen diese beiden Sinnebenen zueinander?
Dies sind die Kernfragen einer qualitativen Fotoanalyse, die sich an die Methodologie der objektiven Hermeneutik anschließt. Diese Fragen gelten nicht nur für abgebildete Personen, sondern auch für eine dargestellte sachliche Realität. Es gilt hier sehr klar zu trennen zwischen dem, was man über die faktischen Sinngehalte, die im Foto zum Ausdruck kommen, sagen kann (die leichtere Frage), und dem, was man auf Grund bestimmter Anhaltspunkte als die Intention der abgebildeten Personen - oder der von ihnen geschaffenen Objektivationen - vermuten kann (die schwierigere Frage, auf die es vielleicht nur eine sehr unsichere Antwort gibt). Stimmt nun die Deutung, welche die InterpretInnen der Selbstdarstellung beimessen, mit den objektiv-latenten Sinngehalten überein, oder gibt es erkennbare Abweichungen?“ (Beck, 2003, 63 f.). So könnte beispielsweise in einer Interaktion ein intendiertes Lob eine faktische Herabsetzung einer anderen Person gleichkommen (vgl. ebd.)
„Welche (sozio-kulturellen und historischen) Kontextinformationen können die Interpretierenden nutzen? (Erweiterung möglicher Lesarten)“ (Beck, 2003, 64).
„Kenntnisse über den Kontext eines Fotos (situationsspezifische oder solche allgemeiner Art) sollten nicht dazu genutzt werden, - vielleicht vorschnell - mögliche Lesarten auszuschließen. Andernfalls würde die Gefahr eines subsumtionslogischen Vorgehens bestehen. Kontextinformationen sollten aber herangezogen werden, wenn sich durch sie neue Lesarten generieren lassen. Auch wäre es denkbar, sich gezielt weitere Kontextinformationen zu beschaffen (sich mit der jeweiligen Lebenswelt vertraut zu machen); doch sollte das zunächst nicht im Vordergrund stehen, um die Möglichkeiten, welche die Fotografie selbst bietet, auszuloten.“ (ebd.).
Kontext, angewandt auf mein Forschungsprojekt, schließt die Einbettung des Bildes im Lehrbuch und im Absatz ein. Wie dominant wirkt dieses Bild, warum wurde es für die Analyse gewählt und wie viele ähnlich gestaltete Fotografien gibt es in der vorliegenden Publikation?
„Was ist die Intention des Fotografen/der Fotografin? Drückt sich darin die persönliche Beziehung zum Objekt aus?“ (ebd.).
„Mit dieser Frage soll dem Umstand Rechnung getragen werden, daß ein Foto immer auch einen ,,Autor"/eine ,,Autorin" hat. Fotograf bzw. Fotografin sind im Bild quasi unsichtbar anwesend. Folgen sie bestimmten Klischees im Bildaufbau, in der Perspektive usw.? Was drückt sich darin aus? (Genauer gefragt, ließen sich auch hier die beiden o.g. Sinnebenen unterscheiden und zueinander in Beziehung setzen.)“ (ebd.). Der Blick auf den Anlass, den Fotografierende mit dem Objekt teilen, definiert die Beziehung beider zueinander - dieser Bezug ist direkt und ostentativ (vgl. Beck, 2003, 58).
Für vorliegendes Projekt kann dieses Detail voraussichtlich als einheitlich betrachtet werden. Da es sich um Fotos für eine spezifische didaktische Zielsetzung im Rahmen eines Lehrbuches oder mit informativem Charakter in einem Berufsbild handelt, ist vermutlich davon auszugehen, dass professionelle Fotograf*innen oder eine Agentur für die Fotografien beauftragt wurde. Daher ist es eher zielführend, diese Frage auszulassen.
„Was ist der Zweck, wer sind die AdressatInnen des Bildes? (Interaktion)“ (Beck, 2003, 64).
„Klang mit der Einbeziehung des Fotografen/der Fotografin schon der Interaktionsaspekt an, so wird er komplettiert durch die Frage nach dem Zweck und den Adressatlnnen des Bildes. So erfordert z.B. ein Paßfoto eine andere Art der Inszenierung und Darstellung als ein Erinnerungsfoto oder ein persönlich gehaltenes Portrait. Sie grenzen sozusagen den Spielraum des fotografisch und darstellerisch Möglichen ein. Sind Zweck und Adressatlnnen unbekannt, kann versucht werden, plausible Kontexte gedankenexperimentell zu (re-)konstruieren.“ (ebd.). Konkret geht es darum, den Sinngehalt - als Zweck der Fotografie - zu erfahren: was und wie sich die abgebildeten Personen darstellen wollen und wozu das Bild dient (vgl. Beck, 2003, 57 f).
Dieser Fragestellung kommt im Rahmen der Untersuchung kaum Bedeutung zu. Zwar unterscheiden sich die Quellen – abhängig von der Zuordnung zu Lehrbüchern oder Berufsbildern, welche vor der Entscheidung für Information genutzt werden, auch variieren Einfluss, Wirkung und transportierte Botschaft der Fotografien. Jedoch wurden solche Quellen im Forschungsdesign gewählt, in denen die Leserschaft (Adressat*innen) stets künftige Fachkräfte bzw. Interessent*innen für die entsprechenden Berufe sind. Somit kann die Frage im Rahmen der Analyse entfallen.
„ Lassen sich die gewonnenen Interpretationen zu einer Globalcharakteristik zusammenfassen? (Fallstruktur)“ (ebd.).
Zur Beantwortung dieser Frage sind, sofern im Forschungsvorhaben vorgesehen, mehrere Fotos erforderlich, um sie miteinander verbunden als Ganzes zu analysieren. „Zentral geht es hierbei um die Relation von subjektiv-intentionaler und objektiv-latenter Sinnstruktur. Treten sie zueinander in ein charakteristisches Verhältnis, das sich in Anlehnung an OEVERMANNS Textinterpretationen als Struktur des Falles kennzeichnen läßt?“ (ebd.). Bei der Interpretation kommt es darauf an, beide Sinnebenen – die subjektiv-intentionale und die objektiv-latente herauszuarbeiten und das zugrundeliegende Verhältnis zueinander zu beschreiben. Die Frage wäre hierbei, wie sich die Personen und ihre Umgebung darstellen wollen, und wie sie sich als Resultat der fotografischen Fixierung faktisch darstellen – wobei dieselbe Fragestellung für die Fotografierenden gilt (vgl. Beck, 2003, 57 f.). Beim Erstellen der Globalcharakteristik wird in vorliegender Untersuchung die Bestimmung in zweifacher Hinsicht vorgenommen: einmal der Gesamteindruck jeder einzelnen Fotografie, andererseits die Einschätzung der charakteristischen Merkmale aller untersuchten Bilder unter der Berücksichtigung der Forschungsleitfragen.
Im Rahmen vorliegender Analyse wird auf die Globalcharakteristik in den Fallanalysen im Anhang im Haupttext Bezug genommen, dort wo die Erkenntnisse zu den Forschungsfragestellungen zusammenfließen.
„Falls es mehrere konkurrierende Interpretationen (zum Gesamtbild oder zu einem Detail) gibt: Welche erscheint am wahrscheinlichsten? Warum?“ (Beck, 2003, 64).
„Wenn der genannte Fall eintritt, lassen sich in der Regel Kalküle darüber anstellen, welche der möglichen Lesarten in höherem oder geringerem Maße plausibel erscheinen - auch wenn die Plausibilitätskriterien nicht unbedingt auf einer einzigen Dimension zu liegen brauchen. Möglicherweise sind zunächst mehrere Lesarten parallel aufrechtzuerhalten, die erst im Lauf der weiteren Interpretation sukzessiv ausgeschlossen werden können.“ (ebd.). Die objektive Hermeneutik erfordert Sparsamkeit: zunächst gilt es nach einfachen, äußeren Bedingungen in Kontext zu suchen, wodurch sich der Sinn des Vorliegenden ergibt (vgl. ebd.).
Diese Frage ist zentral, da es um die Mehrdeutigkeit eines Bildes geht, ggf. auch darum, festzustellen, ob u.U. der Transport beruflicher Mythen, abweichend vom Bildkontext, die Kernaussage der Fotografie bilden könnte.
„Mit welcher Technik wurde das Bild aufgenommen (Weitwinkel, Tele, Perspektive, Ausschnitt, Licht)?“ (ebd.).
„Um Distanzen, markante Körperpartien, Dynamiken u.a. angemessen einschätzen zu können, ist es wichtig, sich auch die technische Seite der jeweiligen Aufnahme bewußt zu machen und sie evtl. als Stilmittel zu begreifen. So kann z.B. durch ein Weitwinkel Dynamik gewollt gesteigert werden. Für die Interpretation ist es wichtig, sich solcher Wirkungen bewußt zu werden, um nicht einem naiven Fehlschluß vom strikten Abbildcharakter des Dargestellten anheimzufallen.“ (ebd.).
Technische Details sind insofern relevant, da durch geschickte Bildinszenierung der Blick der Betrachtenden bewusst auf Details zum Transport beruflicher Mythen gerichtet werden kann. Allerdings sind neue Erkenntnisse bezüglich forschungsleitender Fragestellungen kaum zu erwarten, wenn beschrieben wird, welche Objektive, aus welcher Entfernung, verwendet wurden.
„Um nichts zu übersehen, sollte man abschließend durchaus systematisch-schematisch analysieren: von oben nach unten, von links nach rechts!“ (Beck, 2003, 65).
„Diese Aufforderung zum Schluß soll nur die Aufmerksamkeit noch einmal gezielt auf jene Bildelemente richten, die möglicherweise übersehen wurden, die für das Thema der Interpretation aber von Bedeutung sein konnten. Damit soll insbesondere dem Umstand Rechnung getragen werden, daß bei einem Foto, das seine Information gleichzeitig präsentiert, nicht sequenzanalytisch vorgegangen werden kann wie bei einem transkribierten Interaktionsablauf. Es gibt bei einem Foto wohl in der Regel keine von der Sache her zwingend begründbare Interpretationsreihenfolge.“ (ebd.). Mit der abschließenden Aufforderung zum nochmaligen Hinsehen soll dem Problem entgegengewirkt werden, nur das vorrangig zu sehen, was den Interpretierenden aus ihrer Erfahrung bekannt ist (vgl. Beck, 2003, 67). Damit wird die bildliche Wahrnehmung geschärft, Interpretierende gewinnen an Bewusstsein und Kompetenz, was zur Qualität der Analyseergebnisse beiträgt (vgl. ebd.).
Für das Projekt der Bildanalyse in Lehrbüchern und Berufsbildern ist es hilfreich ein Bild des Maximalkontrastes (oder bei wenigen Bildern eine Serie) aus der Publikation, sofern überhaupt vorhanden, zu analysieren. Dies ermöglicht es, die Auswahl des analysierten Bildes nachvollziehbarer zu begründen. Zum anderen kann ein Kontrastbild andere oder gar keine beruflichen Mythen ausdrücken. Da es sich dabei nicht um eine weitere Bildauswahl zur hermeneutischen Analyse handelt, sondern die Ergänzungen vielmehr helfen sollen den Kontext besser auszuleuchten, sollen Beschreibung und Interpretation knapp gehalten werden.
Anhang 2: Auswertung
Bildanalyse 1: Operationsschwester mit Infusionsapparat 1916
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A 1: Janssen 1916, 192
Quelle: Lehrbuch der chirurgischen Krankenpflege für Pflegerinnen und Operationsschwestern, Laan, Neubearbeitung Janssen, Peter, Verlag von F.C.W. Vogel, Leipzig 1916, S.192; (Lehrbuch 287 Seiten; 300 Abbildungen. davon bilden 36 Fotografien Pflegefachkräfte und deren Gesichter ab)
Untersucht wurden sechs Bilder mit Operationsschwestern, die eine repräsentative Auswahl aus der Publikation bilden. Das umfassend analysierte Bild ist aufgrund seiner Bildkonstruktion, die den Blick mehr als die anderen auf die Schwester bündelt, innerhalb des Lehrbuches prominent. Sowohl Helligkeitskontraste, Bildgröße, -inhalte und -strukturen machen die Fotografie zu einem Blickfang. Auf vielen Buchseiten sind zwei Fotografien untergebracht. Das Bild vom Infusionsapparat dagegen ist einzeln rechts auf einer sonst bildlosen Doppelseite präsentiert. Das theoretical sampling der ergänzend analysierten Bilder besteht aus Beispielen maximalen Kontrastes.
1. Was sind die ersten Eindrücke der Interpretierenden: a) vom Kontext; b) subjektive Assoziationen?
a) Ort: der Hintergrund ist neutral, sodass der Ort auch ein Fotostudio sein könnte; Zeit: nicht definierbar; Wetter: es ist eine Innenfotografie, die Ausleuchtung lässt vermuten, dass links ein helles Fenster ist; Licht weißgefärbt; die Beleuchtung ist sehr ausgeglichen und effektvoll. Eine zweite (vermutlich künstliche) Lichtquelle scheint sich oben leicht links versetzt zu befinden.
b) Subjektiv fällt der Blick zuerst auf die Operationsschwester mit dem Infusionsapparat, danach über dessen Schlauch auf den Arzt, der über die Kanüle die Verbindung zur Patientin schafft. Damit verschiebt sich der in der Bildunterschrift postulierte Sinngehalt vom Infusionsapparat hin zugunsten der Krankenpflegerin. Der Arzt kommt aufgrund seines - aus der Sicht der Betrachtenden - abgewandten Blick, die Patientin durch den genau durch ihr Gesicht laufenden Schlauch, erst viel später in den Fokus.
2. Was empfinden Interpretierende, wenn sie die Personen auf dem Bild nachstellen (Körperlichkeit)?
Der Nachstellungsversuch ergibt für die Position aller drei Modelle ein sehr natürliches Körpergefühl. Die Flasche wird in einer praktikablen und für das dargestellte Verfahren notwendigen Höhe gehalten. Die Krankenschwester scheint ihren rechten Arm aufgestützt zu haben, wobei den Betrachtenden dabei eine speziell zu diesem Zweck positionierte Stütze in den Sinn kommt, da in frühen Jahren der Fotografie aufgrund längerer Belichtungszeiten stehende Modelle oft stützend anzulehnen hatten. Diese Vermutung begründet sich auf dem schwer erklärbaren dreieckigen Schatten unterhalb der Finger der abgestützten Hand zwischen Bettlaken und Kittel der Pflegerin.
3. Was ist auf dem Bild zu sehen (Versprachlichung)? Welche Bedeutung drückt es aus (Sinngehalt)?
Versprachlichung: Die Szene bildet gemäß Bildunterschrift einen Infusionsapparat im Gebrauch sowie dessen Funktionsprinzip ab. Eine rechts das Bild rahmende, ca. 30-jährige chirurgische Krankenschwester hält den Apparat hoch. Deutlich zu erkennen ist der zur Kanüle führende Schlauch. Diese wird offenbar (aufgrund der an der Einstichstelle zurückgedrückten Haut) gerade im Moment der Aufnahme am Oberarm der Patientin eingeführt. Der ca. 30-40-jährige Arzt rechts im Bild ist auf die Positionierung des Einstichs konzentriert. Das Alter der Patientin beträgt ca. 40 Jahre. Sie liegt auf einer höher gestellten Liege. Ihre Augen sind geschlossen, wobei durchaus vorstellbar ist, dass sie bewusstlos liegt.
Sinngehalt: Wird von der Bildunterschrift ausgegangen ist der Zweck der Fotografie klar: Hier soll die Funktionsweise eines Infusionsapparates abgebildet werden. Dieser ist tatsächlich im Vordergrund des Bildes und gut zu erkennen. Der Zweck des Bildes wäre jedoch auch leicht, ggf. noch anschaulicher, mit einer Zeichnung erreicht. Betrachtet man das Bild genauer, so fällt die Position der chirurgischen Schwester auf: Sie steht als Einzige aufrecht, leicht nach hinten gelehnt. Sie ist auf einer Höhe mit dem Arzt im Vordergrund, jedoch ist sie optisch dominanter: mehr dazu im Abschnitt zur optischen Gewichtung. Präsenz und starke Aktion der Schwester macht sie zur Hauptprotagonistin des Bildes. Damit besitzt das Foto genügend Potential Sinngehalte beruflicher Identitätsvorstellungen zu transportieren. Es ist eine Szene, welche die Aufmerksamkeit der Betrachtenden fesselt. Das gut ausgeleuchtete Gesicht der Pflegerin ist gut einsehbar. Beobachtende sehen in ihren neutralen Gesichtszügen keine Anspannung, sondern eher Aufmerksamkeit. Der Blick ist auf den Schlauch konzentriert, was dabei hilft den Kolben entsprechend richtig zu halten. Die abgebildete Schwester hat offenbar keine Berührungsängste mit (damals) moderner Technik. Die Schwester übernimmt keine aktive Rolle, sondern steht dem Arzt assistierend und schweigsam vertrauend zur Seite. Ihr Kittel ist praktisch, zweckentsprechend, dem Beruf angemessen und drückt keinerlei Individualismus aus.
4. Gibt es etwas, das die Interpretierenden auf dem Bild erwartet hätten, was aber fehlt (Interpretation des Nicht-Vorhandenen)?
Oftmals (auch damals) werden in Operationssälen Gesichtsmasken getragen. Dies ist auf dem Bild weder bei dem Arzt noch bei der Krankenschwester der Fall (der Vollbart des Arztes sticht geradewegs als ungewohnt ins Auge). Auch hat die Krankenschwester keine sonst übliche Kopfbedeckung. Obwohl diese Utensilien fehlen, zieht dies den betrachtenden Blick auf die Personen und deren Gesichter.
5. Wie ist das Bild aufgebaut? Was ist zentral (optische Gewichtung)?
Gehen die Interpretierenden von der Bildunterschrift aus, dann ist der Infusionsapparat zentral. Dabei handelt es sich um ein Glasgefäß von schätzungsweise 2-2,5 Liter Rauminhalt. Dieses nimmt mit dem Schlauch vordergründig eine große Bildfläche ein. Vollumfänglich abgebildet, ist der spiegelnde, strahlend reine Glaskolben am oberen Rand leicht rechts versetzt der Bildmitte deutlich zu sehen. Über den Schlauch blicken die Betrachtenden zur Nadel.
Das Buch enthält sehr viele Abbildungen, ein Großteil mit darauf dargestelltem chirurgischem Handwerkszeug. Andere mit Krankheitsbildern. Dieses Foto dagegen hat aufgrund der seltenen Anordnung als einzelnes Bild einer Doppelseite eine herausgehobene Stellung. Nur acht Bilder zeigen die Konstellation Arzt – Patient – Krankenschwester. Das zu untersuchende Bild hat einen markanten Aufbau: Arzt und Krankenschwester rahmen die Patientin. Da die Patientin liegt, während die beiden vor ihr stehen, tritt sie in den Hintergrund. Der Effekt wird dadurch verstärkt, dass der Infusionsschlauch genau das Auge der Patientin kreuzt. Da es sich um ein gestelltes Bild zu handeln scheint, ist dieser Effekt mit großer Wahrscheinlichkeit gewollt. Auffallend sticht das erhellte Gesicht der Pflegerin von dem in tiefen Schatten liegendem Gesicht des Arztes in nahezu maximal möglichen Kontrast hervor. Damit ist die Konstellation Arzt – Krankenschwester berührt: Als eigentlicher Hauptakteur des medizinischen Handelns der Inszenierung ist der Arzt optisch im Hintergrund. Dieser Effekt wird durch die Ausschnittwahl verstärkt. Während das rechte Drittel des Bildes vollumfänglich von der Krankenschwester ab ihrer Oberschenkelregion aufwärts eingenommen wird, ist der Körper des Arztes rechts nur unvollständig ab seiner Arm-/Schulterregion einsehbar. Zur Beantwortung der Frage, warum der Blick der Betrachtenden stets zur Krankenpflegerin wandert und dort verweilt, kommen auch die Strukturen ihrer Kleidung in Betracht. Der schräge Gürtel des Kittels ist markant. Hinter ihm sammeln sich recht gleichmäßig verteilte Falten, die aufgrund der Lichtwirkung auffallend kontrastreich erscheinen. Der Stil lässt sich aufgrund seines weiten Schnittes als zweckmäßig, korrekt und nicht körperbetont - fast schon entpersönlichend (vgl. Abb. A 4) – bezeichnen und wurde der branchenüblichen Berufskleidung der Zeitepoche entsprechend gewählt. Der Kittel spielt eine wesentliche Rolle für berufliche Mythen, worauf zusätzlich unter Frage 7 eingegangen werden soll. Ähnliches gilt für das hell erleuchtete Gesicht. Dieses ist im Gegensatz zu dem des Arztes und der Patientin gut einsehbar und lässt vieles auf den Charakter schließen.
6. Wie sehen die abgebildeten Personen aus (Gestik, Mimik, Haltung, Kleidung)? Wie ist ihr Verhältnis zueinander?
a) Wie möchten sich die Personen möglicherweise darstellen (subjektiv- intentional)?
Alle drei abgebildeten Personen machen einen sehr authentischen Eindruck. Offensichtlich wissen sie, dass sie Fotomodelle sind, jedoch sind sie auch in ihrem beruflichen Umfeld. Es besteht kein Zweifel, dass es sich bei den Personen um einen echten Arzt und eine echte Krankenschwester bzw. Auszubildende handelt. Ob auch die Patientin echt ist und tatsächlich die Szene einer real stattfindenden Infusion aufgenommen wird, oder nur angedeutet ist, lässt sich nicht beurteilen, ist jedoch vor dem Hintergrund der zentralen Fragestellungen vernachlässigbar. Alle Fotomodelle tragen die typische Kleidung und besitzen die natürlichen Körperhaltungen. Einzig die Krankenschwester ist ein wenig in Richtung Bett geneigt, was zur Frage verleitet worauf sie sich aufstützt. Dies kann ggf. ein oberer Rahmen an der Krankenliege sein, oder aber eine für die Fotografie eigens angebrachte Stütze. Diese Neigung wirkt sich vorteilhaft für die Inszenierung aus, denn damit werden die Lichteffekte zur Abbildung des Oberkörpers der Krankenschwester (willentlich oder zufällig?) verbessert. Dessen ungeachtet mag das Gewicht des Apparates zum Zurückneigen des Oberkörpers beitragen.
b) Wie stellen sie sich faktisch für die Interpretierenden dar (objektiv-latent)?
Der Arzt ist völlig auf die Einstichstelle fixiert. Die Patientin liegt. Ihre Haltung ist natürlich. Es ist nicht auszuschließen, dass sie tatsächlich bewusstlos ist. Die Krankenschwester macht einen neutralen und aufmerksamen Eindruck.
In welchem Verhältnis stehen diese beiden Sinnebenen zueinander?
Subjektiv-intentionale und objektiv-latente Sinnebene scheinen eine gute Passung aufzuweisen. Den Interpretierenden fallen keine Dissonanzen beim Betrachten der Figuren ins Auge.
7. Welche (sozio-kulturellen und historischen) Kontextinformationen können die Interpretierenden nutzen (Erweiterung möglicher Lesarten)?
Aufgrund des relativ großen Aufwandes beim Anfertigen von Fotografien Anfang des 20. Jahrhunderts ist auszuschließen, dass es sich um einen Schnappschuss handelt.
Auf der linken Seite einer Doppelseite im reinen Text positioniert, nimmt die Abbildung in einem Buch, in dem so manche Seite drei oder mehr Bilder aufweist, in Verbindung mit seiner Bildkonstruktion, eine prominente Stellung ein.
Das Buch ist ein Lehrbuch zur Ausbildung chirurgischer Krankenpflegerinnen. Die Bildauswahl der Publikation ist auf das Vermitteln von Sachverständnis ausgerichtet: es findet sich beides in ausgewogenem Verhältnis – sowohl Fotografien von Pflegefachkräften bei der Tätigkeit, besonders um spezielle Fertigkeiten oder Haltungen zu demonstrieren, als auch medizinisches Gerät. Somit repräsentiert das Bild beides: Es bietet Einblicke in den behandelten Lehrpunkt - Aussehen und Verwendung von Infusionsapparaten sowie in Rolle und Charakterbild chirurgischer Schwestern. Bildinhalt und -konstruktion entsprechen sowohl dem Kontext, als auch der Bildunterschrift. Der oder die Fotografierende möchte zweifellos den sachlichen Auftrag erfüllen, den Infusionsapparat anschaulich und praxisentsprechend in Szene zu setzen. Nichts deutet auf eine über diesen Auftrag hinausgehende persönliche Beziehung zum Objekt hin. Allerdings ist es vorstellbar, dass der/die Fotografin nicht nur dieses Bild, sondern auch andere Fotografien dieses Handbuches und ggf. anderer Publikationen zu medizinischen Themen angefertigt hat, und damit bereits einen geschärften Blick für berufliche Besonderheiten des Umfeldes als auch für die einzelnen Berufspositionen hat, was dazu Anlass geben mag, dass auch berufliche Identitäten wirklichkeitsnah-idealisierend dargestellt wurden.
Der Infusionsapparat ist der Gegenstand, an dem sich die im operativen Bereich besonders von Schwestern streng geforderte Reinheit anschaulich demonstrieren lässt. Trotz der eingeschränkten Darstellungsmöglichkeiten aufgrund der Schwarz-Weiß-Technik und der recht groben Körnung erscheint der Glaskolben sehr klar und rein abgebildet. Das hohe Halten desselben bekommt neben seiner eigentlichen funktionalen Bedeutung damit auch eine zusätzliche symbolische. Unter den wenigen Aussagen des Buches zur Person der chirurgischen Schwester findet sich folgende: „Wenn auch die Operation in einem modernen, gut geleiteten Krankenhause eine viel sicherere Aussicht für einen aseptischen Wundverlauf bildet als der stets mehr oder weniger improvisierte Eingriff in einer Privatwohnung, so unterliegt es doch keinem Zweifel, daß eine chirurgische Schwester, die sich ihrer verantwortungsvollen Aufgabe ganz bewußt ist, durch verständnisvolle Herrichtung im Notfalle jeden Wohnraum für einen aseptischen Eingriff herrichten kann, sobald sie nach dem Grundsatze handelt, der ihr ganzes Wirken jederzeit beeinflussen soll: Alles das als chirurgisch unsauber zu betrachten, was sie nicht selbst sterilisiert hat oder was nicht unter ihren Augen gesäubert worden ist. “ (S. 283). Auf dem Schwarz-Weiß-Bild ist der Glaskolben strahlend vor grauem Hintergrund in Szene gesetzt. Erstaunlich klar erkennbar, die reine Flüssigkeit. Es erweckt fast den Anschein, dass die Demonstration dieser Reinheit der Grund gewesen ist, weshalb der Kolben etwa zur Hälfte gefüllt wurde. Damit erhält die Fotografie nahezu den Charakter eines Werbefotos. Nach damaligen fotografischen Möglichkeiten wurden alle Register gezogen, um die Reinheit der Schwester und ihrer Umgebung, ja selbst ihres Charakters – durch das klare, helle Angesicht repräsentiert – abzubilden. Beim Gedanken an Reinheit kommt auch die Kleidung ins Visier der Beobachtung. Das Foto ist eine Komposition in Weiß. Alle drei Personen sind in reines Weiß gekleidet, auch das Bettlaken ist logischerweise weiß. Damit wird Sterilität, Reinheit und Vertrauen in die Medizin symbolisiert, Dinge, die sich im Bild äußern, jedoch weit vor dem Zeitpunkt der Aufnahme mit der Herrichtung, als vorbereitende Arbeit beginnen. Sorgfalt ist somit Grundlage für Sauberkeit. Vor diesem Hintergrund konstituiert sich der Beruf der Schwester. Ein kleines Detail fällt dabei auf. Obwohl das Gesicht des Arztes im tiefen Schatten liegt und er nur zu einem kleineren Teil am Rande abgebildet ist, so erstrahlt doch sein Kittel umso weißer – ein kleiner Hinweis auf seine überragende Stellung in beruflicher Hierarchie, Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz.
8. Falls es mehrere konkurrierende Interpretationen (zum Gesamtbild oder zu einem Detail) gibt: Welche erscheint am wahrscheinlichsten? Warum?
Das Bild macht einen primär einheitlichen Eindruck. Zweck des Bildes ist es den Infusionsapparat und seine Anwendung abzubilden. Die Bildunterschrift und Positionierung im Lehrbuch machen Ziel und Zweck der Fotografie eindeutig und stimmt auf dem ersten Blick mit der Gestaltung überein. Der vertrauliche Charakter der Szene, auf der offensichtlich das Einführen der Kanüle in den Arm abgebildet ist, bestätigt diese Annahme. Es handelt sich um eine idealtypische Darstellung, die den Charakter eines Bildes besitzt, das zu Unterrichtzwecken besprochen werden könnte. Es ist offenbar speziell so konstruiert, dass es Aufmerksamkeit erfährt und die Lernenden eingeladen werden, sich etwas länger mit der Betrachtung des Bildes zu beschäftigen.
In der beruflichen Praxis wurde gewiss die Kanüle auch damals bereits von Pflegefachkräften gesetzt, doch das Lehrbuch enthält dafür kein Belegfoto. Das was die Fotografie abbildet, ist die assistierende, nichtmedizinische und körperlich anstrengende Hilfsarbeit der Krankenschwester. Sie steht dem Arzt bei und „ersetzt“ den Ständer, an dem die Infusionsappart aufgehangen werden könnte. Somit herrscht ein bemerkenswerter Kontrast zwischen Berufsbild und beruflicher Praxis. Die Fotografie bildet anschaulich die berufliche Hierarchie ab. Der Arzt macht einen souverän-gelassenen Eindruck, während der Blick der chirurgischen Schwester routiniert-aufmerksam ist. Das Bild selbst rückt die - optisch durch Lichtkontraste und Ausschnittwahl hervorgehobene -Krankenschwester ins Visier. Während der Blick des Arztes abgewandt im Schatten liegt und der der Patientin vom Schlauch gekreuzt wird, lädt einzig das Gesicht der chirurgischen Schwester zum Interpretieren ein. Damit wird sie in den Augen der Betrachtenden, trotz ihrer auf der abgebildeten Szene eher passiveren Person, zur Hauptfigur. Die Betrachtenden werden sich mit der Akteurin identifizieren, und ihr Vorbild in Verbindung mit dem Gebrauch des Infusionsapparates nachahmen wollen. Das schließt nicht nur das Halten des Apparates ein, sondern auch die Kleidung und das durch den Gesichtsausdruck angedeutete Interesse. Dies deutet klar die Verbindung zur beruflichen Identität an: eine chirurgische Schwester ist bereit zu aufopferungsvoller körperlicher Arbeit (angedeutet durch den vermutlich nicht leichten Glaskolben), sie beachtet zuverlässig ärztliche Anweisungen, ist reinlich und konzentriert. Eine vertiefte Deutung aufgrund der Positionierung der Fotografie im Gesamtdokument und die sich von den anderen Abbildungen unterscheidende Darstellung der Krankenschwester lenken die Aufmerksamkeit auf ihre Persönlichkeit. Die Fotografie stellt auch sie im Vordergrund dar und lädt die Leserschaft dazu ein, sich mit ihrer Identität näher zu befassen. Tatsächlich werden durch das Bild berufliche Mythen transportiert.
9. Mit welcher Technik wurde das Bild aufgenommen (Weitwinkel, Tele, Perspektive, Ausschnitt, Licht)?
Es ist davon auszugehen, dass das Foto mit einem Normalobjektiv aus ca. 2,5 -3 m Entfernung bei seitlich von links kommendem Licht aufgenommen wurde. Höchstwahrscheinlich ist es natürliches Licht aus zwei hellen Fenstern (wie dies die Spiegelungen im Glaskolben vermuten lassen). Die Bildschärfe ist im gesamten Aktionsraum ausreichend, sodass alle Objekte ähnlich gut erkennbar sind. Die Körnung ist relativ grob, was den damaligen Möglichkeiten von Drucktechnik und Fotografie entsprach. Der Hintergrund eine graue Wand ist vollständig neutral, sodass sich der betrachtende Blick förmlich einer Bühne optischer Inszenierung gegenübersieht. Die Perspektive liegt auf Hohe des Kopfes des Arztes und der Schulter der Krankenschwester und trifft in ihrer Mitte den unteren Teil des Infusionsapparates. Bildbetrachtende stehen quasi als Beobachtende einer Schulungsszene mit im Raum. Der das Auge der Patientin kreuzende Schlauch (unterhalb der Bildmitte) lässt keinen Zweifel daran, dass nicht die Patientin hier abgebildet werden soll. Der Bildausschnitt lässt außerhalb der Personengruppe keine weiteren Interpretationen des Umfeldes zu. Die scharfen Lichtkontraste zwischen Arzt und Krankenschwester und ihre prominente Positionierung fangen den Blick der Bildbetrachtenden. Ihr gütiger Gesichtsausdruck lädt zum Verweilen ein, wodurch die Voraussetzung geschaffen ist, berufliche Mythen zu transportieren.
10. Um nichts zu übersehen, sollte man abschließend durchaus systematisch analysieren: von oben nach unten, von links nach rechts!
Abschließend fallen zwei Details auf, die Fragen offenlassen. Die Blickrichtung der Krankenschwester erscheint. Auf den unteren Bogen des Schlauches gerichtet zu sein, nicht aber auf den Arzt oder die Stelle der Aktion (den Arm der Patientin). Warum dies so ist, bleibt ungeklärt. Eine auch ungeklärte Frage betrifft die Frisur der Krankenschwester. Bei genauerem Betrachten mag die Frisur nicht einfach hochgesteckt sein, sondern es könnte auch ein Tuch die Frisur umgeben oder die Haare unter einem Haarnetz zusammengetragen worden sein. Aufgrund der Auflösung und Lichtwirkung bei der Schwarz-Weiß-Fotografie ist dies nicht näher bestimmbar.
11. Bild eines maximalen Kontrastes in der Publikation:
Es ist im Rahmen dieser Arbeit unmöglich alle 36 Bilder auf denen Pflegefachkräfte abgebildet sind zu analysieren. Dennoch finden sich Kontrastbilder. Alle in der Publikation vorkommenden Fotos haben erklärenden Charakter und dienen keineswegs nur der Illustration. Eine Anzahl von Fotografien veranschaulicht den Krankentransport. Stellvertretend kann eine Fotografie gelten, die das Heben einer Person aus einem Bett visualisiert.
Bereits der Untertitel „a) Die Schwester als Krankenträgerin“, in dem die Fotografie verwendet wird, in einem Lehrbuch für chirurgische Schwestern, zeigt die große Bandbreite des Aufgabenspektrums an. Das Bild zeigt drei Personen, die eine liegende Patientin aus dem Bett (z.B. auf eine fahrbare Liege transferieren). Im Text wird dazu gesagt, dass meist zwei Schwestern nötig sind, wenn der/die Kranke selbst nicht unterstützend mitwirken kann. „Es wird diesen Schwestern sehr angenehm sein, wenn eine dritte Schwester die „Liebenswürdigkeit“ haben wird, den Patienten „anzureichen“. Wenn die beiden Schwestern ihre vier Arme auf den richtigen Platz unter dem Patienten gelegt haben, so ist das Aufheben eines schweren und wenig oder überhaupt nicht mitwirkenden Patienten aus der stark vornübergebückten Haltung heraus nicht leicht.“ Damit ist klar körperlich anstrengende Arbeit in Text und Bild kommuniziert. Deshalb, so der Rat, sollte eine dritte Schwester die Position auf der gegenüberliegenden Seite des Bettes einnehmen und den Körper des Kranken durch „Anreichen“ entlasten. Das Bild trägt einen etwas ironischen Beigeschmack, wenn die im Text erwähnte dritte Schwester in Wirklichkeit durch den Arzt des zu Beginn besprochenen Bildes ersetzt wird. Damit wird, zumindest auf dem Bild der Arzt zum Gehilfen der beiden Schwestern, was in der Konsequenz bedeutet, dass sie seiner unterstützenden Hilfe bedürfen. In dieser Lesart könnte damit ausgedrückt werden, dass es auf einer Krankenstation, trotz strenger Hierarchien, Hand in Hand zusammenarbeitend um das Wohl des Kranken gehen sollte.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A 2: Janssen 1916, 231
Fast sieht das Foto genau entgegengesetzt aus: Die beiden Schwestern, an Körpergröße dem Manne unterlegen, stehen auf der den Betrachtenden abgewandten Seite, das heißt sie werden durch die größere Entfernung vom Objektiv verstärkt verkleinert abgebildet – so scheinen sie rein optisch dem Mann die Patientin „anzureichen“. Dies ist reines Gedankenspiel, doch auch der Blick der Patientin ist eher der Kamera und damit der Seite des Mannes zugewandt. Der Kontext erlaubt jedoch nur eine einzige Lesart – wenn es sich beim „Anreichen“ um eine „Liebenswürdigkeit“ (die Wortwahl und die Anführungszeichen sind prägnant) handelt, dann mag es so manches Mal nicht einem Mangel an Personal, sondern der Willigkeit zuzuschreiben gewesen sein, wenn zwei Schwestern allein den Transfer zu bewältigen hatten. Tatsächlich verraten sowohl Text, als auch Bild, welche enormen Kräfte auf die Wirbelsäulen zweier Schwestern im Moment des Hubes wirken mögen. Beachtenswert ist zudem, dass die Körperhaltung des Arztes deutlich entspannter ist, als die der Schwestern. Die transportierte Botschaft kann hier lauten: Eine chirurgische Schwester hebt nicht allein Infusionsapparate, sondern muss auch körperlich in der Lage sein, Kranke, die durchaus 80 oder mehr Kilo wiegen können, mit einer Gehilfin aus ungünstigen Positionen heraus zu heben. Das Bild vermittelt etwas Heroisches. Die Krankenschwester wird zu einer Person, die auch schwierige Situationen souverän meistern kann und dabei stets Teamplayer bleibt. In der Bildsituation schult der Arzt die beiden Schwestern in die Technik des Anhabens einer bettlägerigen Person; im Kontext Lehrbuch wird ersichtlich, dass die dritte helfende Person eine weiter Krankenschwester sein würde.
Das Lehrbuch enthält auch Zweibildserien. Stellvertretend soll auf die beiden Bilder auf S. 185 verwiesen sein.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A 3: Janssen 1916, 185
Hierbei handelt es sich um einen „Narkotiseur“ – also um einen Narkosearzt, wie es in der Bildunterschrift zu Fig. 182. beschrieben ist - und eine chirurgische Schwester bei der Anwendung der künstlichen Atmung. Das Markante an den Bildern ist die Stellung des Modelles gegenüber den Betrachtenden. Ihr Gesicht kann gut gelesen werden und gibt einige Informationen preis. Im Bild „Fig. 182“ schaut die Schwester auf die genaue Handhaltung des Arztes und ahmt diese nach. Es kann dabei der Eindruck entstehen, dass die Schwester das erste Mal die Prozedur durchführt und sich anleiten lässt und sorgfältig darauf achtet, die Abläufe kopieren und zu verinnerlichen. In Fig. 183 ist ihr Kopf zwar Richtung Schulter der Patientin ausgerichtet, ihr Blick jedoch dem Gesicht der Patientin gewidmet in diesem Falle könnte sie das Gesicht und die Atmung beobachten. Es könnte jedoch auch sein, dass sie den eng angelegten Oberarm im Blick hat, um die Bewegungsabläufe genauso, wie vom Arzt vorgemacht ausführt. Damit kann angedeutet sein, dass die Krankenschwester genau die Abläufe von Behandlungen verinnerlicht haben sollte, jedoch gilt ihr Hauptinteresse den zu behandelnden Kranken – dem Resultat jeglicher Tätigkeit. Ihr Gesicht im Bild 182 erscheint aufgeweckt und interessiert, in Fig. 183 ist es hingegen fragend und nachdenklich. Der Arzt bildet den Ruhepol: Er ist auf beiden Fotos völlig auf den Oberarm der Patientin fixiert und auf die korrekte Behandlung bedacht. Er vertraut der angewandten Methodik, auch scheint er der unterstützenden Krankenschwester zu vertrauen. Für ihn ist sie Teil eines eingespielten Teams, auf welches gerade auch in brenzligen Situationen blind Verlass ist. Es könnte in einer zweiten Lesart sein, dass die Schwester nicht Helferin, sondern Auszubildende ist. In diesem Fall findet eine Ausbildung durch ärztliches Personal statt und nicht durch Schwestern. Die Chirurgie ist offenbar ein für Krankenpflegefachkräfte anspruchsvolles Einsatzgebiet, in denen ihr Beruf dem des Arztes besonders nahekommt. Es verwundert die Betrachtenden kaum, dass die Schwester die Bewegungen und Handgriffe des Arztes auf den Fotos perfekt spiegelt. Erneut kann das Bild als Einführung des Arztes in die Technik der künstlichen Atmung betrachtet werden. Schlussendlich würden zwei Schwestern die Tätigkeit ausführen. Das genaue Beobachten und Nachahmen ist, in diesem Falle, die Aufgabe, welche die Schwester bei der Verinnerlichung des Berufsbildes wahrnimmt.
Die Suche nach einem Foto eines maximalen Kontrastes im Buch führt zu Fig. 152.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A 4: Janssen 1916, 162
Das Bild zeigt einen „Operationssaal in Benutzung“. Die Konstellation ist insofern interessant, als es sich bei dem Saal nicht um einen gewöhnlichen Operationssaal eines Krankenhauses handelt, sondern wie die Besucherränge zu verstehen geben, um den Saal einer Lehranstalt. Das Bild zeigt ein Operationsteam bei der Arbeit. Das Foto kann als Lehrveranstaltung für angehende chirurgische Pflegefachkräfte gelesen werden, was Rückschlüsse zu den anderen Bildern erlaubt, die dann auch als Lehrsituationen zu verstehen sind. Im Hintergrund sitzen 6 Personen, vermutlich Lernende und betrachten das Geschehen. Das Bild gibt Einblick in das für Operationen optimale Arbeitsumfeld jener Zeit (im Buch wird auch auf Operationen in Wohnungen verwiesen). Im Gegensatz zu heute üblichen OP-Lampen scheint der Saal ausschließlich durch die deckenhohen Fenster im Hintergrund (und vermutlich auf der rechten nicht einsehbaren Bildseite) beleuchtet zu sein. Die behandelte Person und der Aktionspunkt sind den Betrachtenden abgewandt. Außer einem Kübel im Vordergrund und einem Tisch links im Bild sind keine weiteren Utensilien erkennbar. Sämtliche abgebildete Personen sind in Operationsanzüge gekleidet. Aufgrund der Gesichtsmasken wirken die Personen entpersönlicht. Dies kann einen Hinweis auf Berufsmythen bilden. Patient*innen sollten zu Recht davon ausgehen können, dass alle Behandlungen in gleichbleibender Qualität ausgeführt werden, dabei sollten die operierenden und assistierenden Personen keine Rolle spielen. Das Team ist als Gesamtes zu sehen, die einzelne Person wird durch die einheitliche Schutzkleidung anonymisiert wahrgenommen; einzig der Saal erstrahlt durch die verbreitete Atmosphäre als einzigartiger Dreh- und Angelpunkt. Die Betrachtenden (künftige Operationsschwestern) sehen den Saal als ihren Aktionsraum – hier gehören sie hin, finden hier ihr Handwerkszeug, ihre Berufung. Die durch die einheitliche Kleidung transportierte Botschaft ist Austauschbarkeit. Keine der Schwestern solle unersetzbar sein; weil es um die fristgerechte Bewältigung verantwortungsvoller Arbeit geht muss jede Schwester die Abläufe verinnerlicht haben, sodass auf sie Verlass sein kann. Die Anzahl der im Hintergrund sitzenden Lernenden unterstützt den Gedanken. Diese schauen interessiert auf das Geschehen. Die beiden rechts Sitzenden sind vorgebeugt, als wollen sie dadurch näher dem Aktionspunkt näher sein, sie scheinen räumlich mehr zum Team aufrücken zu wollen. Der Bildtitel „Operationssaal in Benutzung“ tangiert die abgebildeten Personen nur: „in Benutzung“ – ein unpersönlicherer Begriff ist schwerlich zu finden. Der Operationssaal ist offenbar nicht ein Ort für Individualismus und Selbstverwirklichung.
Globalcharakteristik und Zusammenschau der untersuchungsrelevanten Beobachtungen
Für die Fotoanalyse des reichbebilderten „Lehrbuch[s] der chirurgischen Krankenpflege für Pflegerinnen und Operationsschwestern“ in der Neubearbeitung von Peter Janssen aus dem Jahre 1916 musste eine gezielte Auswahl erfolgen. Aus dem Buch mit 36 Fotografien, auf denen Pflegefachkräfte dargestellt sind, wurden neben einem vertieft analysierten Bild, vier weitere in Bezug auf die Forschungsfragen hin untersucht. Bezeichnend für die Publikation ist, dass Pflegefachkräfte – wie der Titel des Buches bereits ausdrückt – stets weiblich dargestellt sind. Dies entsprach den Gegebenheiten der Situation in einer Zeit, in der Männer oft in der Landwirtschaft, zunehmend auch in der Industrie beschäftigt waren. In den Kriegsjahren waren Männer oft an der Front, viele von ihnen wurden verwundet, daher fiel dem Lehrbuch für den chirurgischen Bereich jener Zeit eine besondere Rolle zu. Interessanterweise sind die abgebildeten Patienten, soweit erkennbar, vielfach Frauen. Auch wenn die Fotografien – den damaligen Gegebenheiten entsprechend – in Schwarz-Weiß gefertigt wurden, zeichnen sie keinesfalls ein düsteres Bild der Tätigkeit. Kaum finden sich auf den Bildern Schattenbereiche. Es sind die Kontraste, die sich durch das reine Weiß der Kleidung und des Bettzeugs in Verbindung mit der hellen natürlichen Beleuchtung ergeben und so positive Emotionen beim Betrachten hervorrufen. Die sorgfältig angefertigten Fotos haben erklärenden Charakter und rücken die Profession chirurgischer Krankenpflegefachkräfte ins Zentrum der Aufmerksamkeit, auch, wenn auf den Bildern ein Arzt abgebildet ist. Die transportierten beruflichen Mythen sind in dieser Publikation eher leicht zu erkennen. Stets steht die chirurgische Schwester dem Arzt assistierend bei. Sie beobachtet konzentriert das Vorgehen des Arztes, macht den Eindruck gewissenhaft den Arzt zu assistieren, bzw. in einer zweiten Lesart aufmerksam bei der Ausbildung zu sein. Die Betrachtenden kommen zu dem Schluss, dass Krankenschwestern konzentriert sein müssen, um zuverlässig assistieren zu können, bzw. sich Arbeitsschritte verinnerlichen zu können. Das Bild vom Operationssaal verrät, dass selbst von Lernenden der Profession Aufmerksamkeit erwartet werden kann (wenngleich das gespannte Vorbeugen auf den Rängen kaum zu einem Mehrgewinn an Einsicht beizutragen vermag). Das Bild scheint durch die gleichartigen Operationsanzüge ausdrücken zu wollen, dass die Persönlichkeit des oder der Einzelnen sich im gemeinsamen Zweck, der Ausübung des Berufs, auflöst. Nicht einmal der operierende Arzt ist klar erkennbar. Einzig der oder die Patient*in unterscheidet sich aufgrund seiner bzw. ihrer Lage. Wie die Bilder vermitteln, ist das Berufsbild nicht nur durch seine Nähe zur ärztlichen Profession gekennzeichnet, sondern auch von der Bereitschaft hart zu arbeiten und sich zugleich bestimmte Techniken zu verinnerlichen (der Haltung eines Patienten bei der Beatmung). Das Hochhalten des Infusionsapparates über längere Zeit erscheint anstrengend; der Kraftaufwand beim Transferieren einer liegenden Person ohne Hilfsmittel dagegen ist für die Bildbetrachtenden nur schwer vorstellbar. Klar wird, dass das ein großer Teil der Tätigkeit von chirurgischen Schwestern jener Zeit in schwerer Arbeit bestand, dies war an ihre Identität geknüpft. Die in den Bildern festgehaltenen konzentrierten Blicke verweisen auf Geistesgegenwärtigkeit und Interesse, was als Hinweis gelten kann, dass sie sich bereitwillig der Herausforderung körperlich anspruchsvoller Arbeit stellte. Die Zwei-Bild-Folge in der künstlichen Atmung abgebildet wird, rückt eine weitere Facette beruflicher Identität ins Zentrum der Aufmerksamkeit: Eine Krankenschwester kann durch ihre Aufmerksamkeit und Zuverlässigkeit dazu beitragen, Leben zu erhalten. Ob dies immer gelingt, lässt das Bild offen. Neben den Krankenschwestern sind auch Patient*innen abgebildet. Die damit kommunizierte Botschaft berührt das Verhältnis der Schwester mit, bzw. die Konfrontation mit allgegenwärtiger Hilfsbedürftigkeit, Leid und Schmerz. Keines der Bilder zeigt die Schwestern mit strahlendem Gesicht. In ihrem Antlitz lässt sich vielmehr neutrale Aufmerksamkeit bemerken. Diese Ambivalenz, die offenbar geforderte Tatkraft - so scheinen es die Fotos ausdrücken zu wollen - muss mit menschlichem Interesse und Einfühlungsvermögen, aber auch mit Unterordnung gegenüber dem ärztlichen Personal gepaart sein, will die chirurgische Schwester ihre persönliche Identität der Berufung entsprechend ausleben.
Bildanalyse 2: Krankenpflegerin mit Plexiglasmaske 1984
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A 5: Kappelmüller 1984, 123 Copyright © ELSEVIER
Quelle: Kappelmüller, Irmgard, Allgemeine Krankenpflege, Urban & Schwarzenberg, München – Wien - Baltimore 1984; S. 123; ISBN 3-541-08452-9 (Lehrbuch 260 Seiten; 45 Fotos (ohne Zeichnungen); davon bilden 6 Pflegefachkräfte bei der Arbeit ab)
Im Rahmen der nachfolgenden Analyse werden alle Fotografien, die Pflegefachkräfte abbilden analysiert. Der Schwerpunkt fällt auf das Bild von S. 123, da dieses als einziges eine ganze Seitengröße einnimmt und damit prominent ins Auge sticht.
1. Was sind die ersten Eindrücke der Interpretierenden: a) vom Kontext; b) subjektive Assoziationen?
a) Ort: Innenraum, nicht näher definierbar; Zeit: nicht definierbar; Wetter: nicht definierbar - Lichtrichtung, Streuung und Intensität deuten auf reines Kunstlicht hin.
b) Subjektiv entsteht beim Betrachten eine Spannung zwischen zwei Polen: einerseits ist da die Krankenpflegerin, die auf die Arbeit konzentriert ist. Jedoch verweilt der Blick nicht bei ihrer Person, sondern wandert automatisch zur Sauerstoffflasche - speziell zur Stelle, an der die Pflegerin die Flasche berührt. Die zu vermittelnde Botschaft im Kontext des Lehrbuchabschnitts ist zwar die Sauerstoffflasche, jedoch entsteht durch die Bildkonstellation eine Interaktion mit der Person der Krankenschwester. Die Betrachtenden fühlen sich an ihrer Stelle, der Effekt ist vermutlich gewollt, denn im Lehrbuch steht die Krankenpflegerin der Leserschaft gegenüber, in Realität würde sie einer Gruppe von Auszubildenen gegenüberstehen, diese anleiten und Teilbereiche der Arbeit veranschaulichen. Insofern liegt ein Kontrast zu 1916 vor, denn zu diesem Zeitpunkt war es ein Arzt, der die Krankenschwester anleitete.
2. Was empfinden Interpretierende, wenn sie die Personen auf dem Bild nachstellen (Körperlichkeit)?
Das körperliche Nachstellen der Pose ist problemlos. Die Stellung ist natürlich, es stellt sich die Frage, wie schwer und empfindlich eine solche Sauerstoffmaske sein mag – mit anderen Worten: Warum wurde die Halteposition der Maske verhältnismäßig hoch gewählt? Für die Arbeit mit der Maske ist die Höhe unpraktisch und unnötig, jedoch für eine optische Präsentation, z.B. bei einer Arbeitsanleitung, sie geschickt gewählt. Die Fotografie dient als veranschaulichende Illustration im Lehrbuch. In der Praxis sieht die Körperhaltung authentisch aus, speziell für eine Person, die anderen die Gerätschaften erklärt. Die Krankenpflegefachkraft wirkt als Ausbildnerin der eigenen Profession. Es ist nicht ärztliches Personal – Angehörige einer höheren hierarchischen Stufe, die ausbilden, sondern die Pflegerin übernimmt aufgrund des eigenen Berufsfeldes Verantwortung für künftigen Nachwuchs. Damit steht sie nunmehr über einer einstigen reinen Assistenzrolle.
3. Was ist auf dem Bild zu sehen (Versprachlichung)? Welche Bedeutung drückt es aus (Sinngehalt)?
Versprachlichung: Eine Krankenschwester steht hinter einer Sauerstoffflasche und scheint den Schlauch in der Nähe der Flasche mit der rechten Hand zu prüfen, während sie die Sauerstoffmaske in ihrer linken Hand auf Brusthöhe hält. Das Manometer als komplexeste technische Einheit ist zentral im Bild. Der Schlauch rahmt die Krankenschwester förmlich in elegantem Schwung. Die Krankenschwester ist schlicht, entsprechend ihrem Beruf gekleidet und trägt ein, zur damaligen Zeit übliches, weißes Häubchen. Der Hintergrund ist sehr schlicht gewählt, nur fällt auf, dass die Szene genau vor einer Tür abgebildet wird. Wie alle Bilder des Buches ist auch diese Fotografie in schwarz-weiß. Bemerkenswert ist der mittelgraue Hintergrund, der eigentlich eine weiße Wand abbildet. Einzig der Kittel der Krankenschwester hellt das düstere Bild ein wenig auf. Dieser Effekt zieht die Aufmerksamkeit des Blickes auf sie und hier besonders auf ihre helle Schulterregion, wodurch eine optische Brücke zwischen ihrem zur Apparatur blickenden Gesicht und dem oberen Teil der Sauerstoffflasche geschlagen wird.
Sinngehalt: Der Sinngehalt liegt einerseits in der Darstellung der Sauerstoffflasche. Im Rahmen des Lehrbuches stellt das Bild zudem die Herausforderungen des Krankenpflegepersonals mit den technischen Gegebenheiten dar. Der Umgang mit der entsprechenden Apparatur liegt in der Verantwortung des Pflegepersonals. Das Bild veranschaulicht durch den ernsten, konzentrierten Blick, dass diese Verantwortung eine gute Ausbildung erfordert, andererseits wird durch die Haltung und den leicht geschwungenen Schlauch zur Maske hin, eine Leichtigkeit suggeriert. Die Handhabung muss dem Pflegepersonal in Fleisch und Blut übergegangen sein und nicht nur sicher, sondern auch mit Leichtigkeit beherrscht werden. Dieses Anliegen ist so zentral, dass alles andere im grauen Hintergrund verschwindet. Das Bild stellt die Mensch-Technik-Interaktion als Bestandteil pflegerischen Könnens dar. Der Kleidungsstil ist als durchaus weiblich-modern zu bezeichnen. Es ist ein eleganter, deutlich taillierter Kittel mit kurzen Ärmeln der genau auf Kniehöhe abschließt. Den Betrachtenden entgehen nicht die schwarzen durchscheinenden Nylonstrümpfe und die Plateau-Pantoletten. Durch diese Elemente persönlichen Stils wird zusätzlich Betonung auf berufliches Selbstbewusstsein gelegt. Es lässt sich somit eine Ambivalenz im Kleidungsstil erkennen: Einerseits ist die berufliche Kleidung jeder Zeit körperbetonter und lässt Raum für die freie Wahl persönlicher Stilelemente, andererseits erinnert die korrekt getragene Haube an streng vorgegebene formale Kleidung vorangegangener Jahrzehnte. Im Bereich der Krankenpflege jener Zeit sind offenbar konservative Kleidungsnormen maßgebend.
4. Gibt es etwas, das die Interpretierenden auf dem Bild erwartet hätten, was aber fehlt (Interpretation des Nicht-Vorhandenen)?
Die Betrachtenden sehen keine Verbindung zu einem Patienten - es ist nicht einmal klar, an welchem Ort die Aufnahme gemacht wurde. Allerdings deutet die Berufskleidung auf einen Ort des praktischen Einsatzes der Sauerstoffapparatur hin. Dadurch soll womöglich angedeutet werden, dass es verschiedene Einsatzorte gibt, die weder für den Zweck des Fotos, noch für dessen Verständnis relevant sind. Im Gegenteil - eine Pflegefachperson steht in Verbindung mit der Apparatur – sei es auf einer Intensivstation, in einem Operationssaal oder im Rahmen häuslicher Pflege. Ein Identitätsmerkmal für Pflegefachkräfte kann somit in Ortsunabhängigkeit gelesen werden. Technik dient dem bedürftigen Menschen. Da wo der Patient ist, muss eine Apparatur vom Krankenpersonal eingesetzt werden können.
5. Wie ist das Bild aufgebaut? Was ist zentral (optische Gewichtung)?
Der Bildaufbau erscheint gekonnt gewählt: Krankenschwester, Tür und Apparatur bilden eine Einheit. Ablenkende Elemente existieren nicht. Diese drei Bildelemente sind genau in der Mitte platziert und reichen in einer Linie mittig vom oberen bis zum unteren Rand der Fotografie. Ihr Kopf ist zwar leicht nach unten, jedoch der Kamera frontal entgegengerichtet. Das diffuse Streulicht kommt von vorn und von oben und scheint künstlichen Ursprungs zu sein. Die Perspektive ist frontal, auf Brusthöhe der Krankenschwester positioniert. Es scheint ein gestelltes Foto zu sein, das seine Botschaft, den Text illustrierend, an die Leser*innen richtet. Der graue Hintergrund - die eigentlich weiße, doch auf dem Bild mittelgrau wiedergegebene Wand, vermittelt einen düsteren, technischen Eindruck, der jedoch als angebracht in der Interaktion der dargestellten Person mit der technischen Apparatur wahrgenommen wird. Die optische Gewichtung liegt klar auf dem genau bildmittig positionierten Manometer, letzte Zweifel daran beseitigt der auf diesen Punkt gerichtete Blick der Krankenschwester. Auf Metaebene dominieren das Bild die Sauerstoffflasche und die Krankenschwester.
6. Wie sehen die abgebildeten Personen aus (Gestik, Mimik, Haltung, Kleidung)? Wie ist ihr Verhältnis zueinander?
a) Wie möchten sich die Personen möglicherweise darstellen (subjektiv- intentional)?
Die Krankenschwester scheint gewissenhaft die Rolle eines Fotomodells zu übernehmen. In keiner Weise präsentiert sie sich selbst, sondern ist völlig auf die Flasche konzentriert.
b) Wie stellen sie sich faktisch für die Interpretierenden dar (objektiv-latent)?
Nichts deutet darauf hin, dass sich die abgebildete Person nicht mit ihrer Rolle als Bildmodell zu Vorführung der Flasche identifizieren könnte.
c) In welchem Verhältnis stehen diese beiden Sinnebenen zueinander?
Zwischen subjektiver-intentionaler und objektiv-latenter Sinnebene besteht keine spürbare Dissonanz. Bei der Publikation, in der die Bildquelle zentralen Charakter aufweist, handelt es sich um ein Lehrbuch für angehende Fachkräfte. Der abgebildete Gegenstand wird entsprechend sachlich in Relation zur bedienenden Pflegefachkraft gesetzt, wobei der Umgang mit der Apparatur Wissen und sicheren Umgang voraussetzt, was umso besser zu verinnerlichen ist, da eine Gabe von Sauerstoff nur im Bereich der Intensivpflege indiziert ist. Diese Züge – die zeitgleich zur Identität der Krankenschwester gehören, bilden eine einheitliche Aussage. Den Betrachtenden würde kaum in den Sinn kommen, dass es sich bei dem Modell nicht um eine ausgebildete Pflegefachkraft handelt. Ein zweiter, genauerer Blick offenbart den konzentrierten Blick auf den Schlauchansatz, wobei dieser in Wirklichkeit von der Akteurin abgewandt ist. Auch das Manometer ist den Betrachtenden zugewandt und entzieht sich dem Blick der Krankenschwester. Dadurch erhält der Sinngehalt des Bildes eine andere Schattierung: Es ist ein Bild, welches abseits des Kontextes Lehrbuch nicht wirklich authentisch wirkt, sondern vielmehr die Konstellation von Krankenfachperson und Apparatur darstellt. Ist die Flasche dagegen (wie bei einer Präsentation durch die Pflegefachkraft) der Leserschaft bewusst zugewendet worden, dann sind Auszubildende gegenwärtige Adressaten der Szene.
7. Welche sozio-kulturellen und historischen Kontextinformationen können die Interpretierenden nutzen (Erweiterung möglicher Lesarten)?
Die fünf Verfasser*innen des Buches sind aus Österreich. Das Lehrbuch ist in Inhalt und Gestaltung mitteleuropäischen Gegebenheiten angepasst. Auch das Modell hat mitteleuropäische Züge und Kleidungsstil, die auch den Modegewohnheiten der Zeitepoche entsprechen. Außer der Krankenschwester sind keine anderen Personen zu sehen. Das Licht ist künstlichen Ursprungs. Die Bildunterschrift „Plexiglasmaske zur Verabreichung von Sauerstoff.“ verdeutlicht diese Intention, anstelle einer physisch anwesenden Lehrperson tritt ein didaktisch beabsichtigtes Bild. Sowohl Kleidung, als auch Pose entsprechen dem beruflichen Umfeld. Die Krankenschwester auf dem Foto soll nicht erklären, sondern demonstrieren und illustrieren. Sie belebt das Bild, doch im Zentrum ist die Flasche, genauer, der Druckanzeiger der Sauerstoffflasche, der entscheidende Punkt, auf den es zu achten gilt. Dennoch ist dies nicht der einzige Zweck des Bildes. Es entsteht eine unterschwellig vermittelte Botschaft, da wo bereits ein Bild von der Maske ausgereicht hätte. In der ganzen Publikation ist dies mit Abstand das flächengrößte Bild; es nimmt 4/5 der Buchseite ein. Alle anderen Fotos haben maximal ½ Buchseite Formatgröße. Die zentrale Positionierung der adretten Krankenschwester, lässt den Blick auf dieser Seite länger verweilen. Die Betrachtenden sind eingeladen, ohne dass sie sich um die Bildunterschrift zu kümmern brauchen, mit der Rolle und der Person der Pflegefachkraft auseinanderzusetzen. Im Geleitwort auf Seite V ist angeführt, dass „Lehrende und Lernende in den Pflegeberufen“ sowie jene, die „sich im Beruf fortbilden“ (ebd.) wollen die Zielgruppe der Publikation bilden. Diese wird nicht nur mit den Bildinhalten, sondern auch mit Sinngehalten um die Persönlichkeitsmerkmale der abgebildeten Pflegefachkraft in Beziehung gebracht wird. Die Auszubildenden gelangen zur Überzeugung, dass auch sie womöglich eines Tages Neulinge bei der Verwendung der Sauerstoffflasche zu instruieren haben. Dies ist Teil ihrer Berufung. Die Fotografie spielt ohne Zweifel eine Rolle bei der Vermittlung von Berufsmythen.
8. Falls es mehrere konkurrierende Interpretationen (zum Gesamtbild oder zu einem Detail) gibt: Welche erscheint am wahrscheinlichsten? Warum?
Das Bild lässt verschiedene Interpretationen zu. Im Abschnitt zur Sauerstoffmaske positioniert, hat das Bild die Funktion, die im Bildvordergrund dargestellte Flasche mit dem Manometer abzubilden. Die Bildunterschrift macht Ziel und Zweck eindeutig, stimmt aber mit der Gestaltung nicht völlig überein, da die eigentliche Maske hinter der Flasche rückversetzt gehalten und eher schlecht zu erkennen präsentiert wird. Da die Plexiglasmaske unabhängig von der Sauerstoffflasche zwecklos ist, erscheint es logisch, dass auch die Flasche abgebildet ist. Die Flasche weist zahlreiche Strukturen auf, was ein Grund dafür sein mag, dass sie vordergründig – in Abweichung von der Bildunterschrift – positioniert ist. Die Fotografie ist so konstruiert, dass die Krankenschwester in ganzer Körpergröße vom Bildausschnitt erfasst ist.
Die zweite Lesart ist in der Stellung des Bildes im Rahmen des Buches zu erkennen. Es handelt sich um ein Bild, das sich durch seine Größe und Komposition von allen anderen abhebt. Die Tatsache, dass das Bild ca. 4/5 einer Buchseite einnimmt, lenkt die Aufmerksamkeit der Betrachtenden besonders auf dieses in Kapitel 6 „Die vitalen Funktionen“ positionierte Foto. Zudem ist die Krankenschwester vollumfänglich abgebildet, was dazu beiträgt, ihre Rolle näher zu untersuchen. Der konzentrierte, geradezu kühle, Blick der der Krankenschwester im Umgang mit Technik macht die Besonderheit ihres Berufs anschaulich. Es geht demnach um die Herausforderung des verantwortungsvollen Umgangs mit komplizierter Technik, der über Leben und Tod entscheiden kann (Sauerstoff wird in der Regel bei Schwerkranken in der letzten Lebensphase verwendet). Damit geraten die von Pflegefachkräften erwarteten Persönlichkeitsmerkmale in den Fokus. Die im Bild erkennbaren Merkmale sind Sauberkeit, Zuverlässigkeit, Technikaffinität und professionelle Sicherheit. Die Funktion als Ausbilder*in und Anleitende*r bei der Einführung in lebenserhaltende Maßnahmen eröffnet das Verständnis für Verantwortung und Breite des Tätigkeitsspektrums des Berufes. Indirekt wird auch die Nähe zur Palliativmedizin angedeutet – die häufige Konfrontation von Pflegefachkräften mit dem Tod, was von Angehörigen der Berufsgruppe die Befähigung erfordert einerseits Feingefühl zu bekunden, andererseits gilt es auch sachliche Distanz zu entwickeln.
9. Mit welcher Technik wurde das Bild aufgenommen (Weitwinkel, Tele, Perspektive, Ausschnitt, Licht)?
Es ist gut möglich, dass das Foto mit einer Brennweite von ca. 35 mm aus etwa 5 m Entfernung mit unterstützendem Blitzlicht aufgenommen wurde. Das Hauptlicht scheint künstlichen Ursprungs und kommt von einer Stelle oberhalb des oder der Fotograf*in und dem Modell. Die Kamera ist auf Brusthöhe des Modells, damit gleichzeitig, in Höhe des Manometers positioniert. Alle Konturen sind in gleicher Schärfe abgebildet. Das Schwarz-Weiß-Bild hat für die Technik einen ungewöhnlich schwachen Lichtkontrast (Weiß und Schwarz werden als grau wiedergegeben). Das mag nicht beabsichtigt sein, da auch bei Druck und Papierwahl (was bei vorliegender Publikation keinesfalls Weiß war) deutliche Verfälschungen auftreten. Der Ausschnitt ist so gewählt, dass die Szene den gesamten Körper der Krankenschwester abbildet. Auch dies trägt zum identitätsprägenden Charakter der Fotografie bei – es geht bei der Themenwahl für das Bild zwar um die Apparatur, auch ist diese vollumfänglich im Bild, aber die Krankenschwester bedient sie (als Einzige) und das drückt die Wahl des Bildausschnitts aus. Flasche und Krankenschwester sind genau bildmittig abgebildet.
10. Um nichts zu übersehen, sollte man abschließend durchaus systematisch- schematisch analysieren: von oben nach unten, von links nach rechts!
Der Abschlussblick offenbart zwei kleine Details, welche keinen besonderen Bezug zum Gesamteindruck haben, aber dennoch erwähnt werden sollen. Am Mittelfinger der rechten Hand trägt die Frau einen schlichten Ring. Durchaus kann die Wahl des Fingers andeuten, dass es sich um eine ledige Krankenschwester handelt. Hier in Verbindung mit der Sauerstoffflasche kann es andeuten, dass zeitliche Flexibilität ein wichtiges Kriterium im Schichtbetrieb einer Intensivstation ist. Geht der Blick weiter nach oben fällt die glänzende Türklinke etwas störend, weil genau zwischen Arm und Hüfte der Krankenschwester, ins Auge und irritiert damit die Harmonie der Gesamtdarstellung.
11. Bild eines maximalen Kontrastes in der Publikation:
Das 260seitige Lehrbuch enthält 45 Fotografien und 42 Zeichnungen. Nur eine klare Minderheit - sechs Fotografien - bilden Krankenpflegerinnen bei ihrer Arbeit ab, die übrigen Fotografien beziehen sich auf pflegerische Hilfsmittel und Instrumente; die Zeichnungen skizzieren in den meisten Fällen Arbeitsabläufe. Die folgende Kurzbetrachtung der 5 weiteren Fotos mit Pflegefachkräften im Buch soll die Kontrasteckpunkte der Publikation markieren, sowie weiteres Licht auf den Transport beruflicher Mythen werfen, sodass eine Vollerhebung der relevanten Fotografien vorliegen wird. Alle fünf Bilder können gleichranging interpretiert werden, da keines als besonderer Maximalkontrast gekennzeichnet werden kann. Zwei beschreiben als Bildfolge den Leintuchwechsel und zwei zeigen ebenfalls als Bildfolge die Handhabung einer Ampulle. Beim genaueren Hinsehen kommen die Betrachtenden zu dem Schluss, dass diese vier Fotos im selben Raum aufgenommen worden sind. Diese Zwei-Bild-Folgen füllen jeweils eine Buchseite. Das fünfte Foto bildet eine weitere Person ab, die Sauerstoff mittels Brille verabreicht. Jedoch ist erfreut sich das Bild aufgrund der Ausschnittwahl und seines Formats ebenfalls nicht derselben Prominenz wie das einleitend beschriebene Foto mit der Sauerstoffmaske.
Die Abbildungen auf Seite 234 des Lehrbuchs visualisieren die Handhabung einer Ampulle:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A 6: Kappelmüller 1984, 234 Copyright © ELSEVIER
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A 7: Kappelmüller 1984, 234 Copyright © ELSEVIER
Eine Krankenschwester demonstriert auf der Bildfolge Arbeitsschritte bei der Verwendung einer Ampulle. Das Thema scheint durch die Bildfolge eine zentrale Stellung im Buch zu erhalten. Damit wird kommuniziert, dass dafür Sorgfalt und Genauigkeit nötig sind. Die Ampulle wird nur mit den Fingerspitzen gehalten. Der entstehende Eindruck ist, dass die Tätigkeit Geschick und Feingefühl erfordert. In Kombination mit dem Gesichtsausdruck gewinnen die Betrachtenden den Eindruck von Ruhe und Sicherheit im geläufigen Umgang mit den kleinen Utensilien. Die Abläufe scheinen fest verinnerlicht. Im Hintergrund ist eine geflieste Raumecke mit Waschbecken und Spiegel deutlich wahrnehmbar. Die Aktion wird über einer Tischfläche ausgeführt. Da die Fotografien in Hochformat sind und untereinander angeordnet eine linke Buchseite füllen (die Bildtitel stehen jeweils rechts vom Bild), ist die Akteurin trotz ihrer jeweils das Bild dominierenden Positionierung im Kontext des Buches weniger augenfällig. Die Bildtitel geben den Betrachtenden eine Vorstellung von den recht winzig erscheinenden, und dennoch für den Sinn des Bildabbildung zentralen Abläufen der Handhabung einer Ampulle. Damit entsteht eine gewisse Dissonanz beim Betrachten. Trotz Hinweis auf die Nutzung der Ampulle, fällt der Blick der Betrachtenden stets auf das Gesicht der Krankenschwester. Das Gesicht erscheint nahezu fröhlich, es entsteht auf beiden Bildern ein Eindruck eines Lächelns, die Krankenschwester scheint Vergnügen an der Arbeit zu haben. Es könnte sich um Emotionsarbeit als Teil des Berufsbildes handeln: bestimmte Emotionen dürfen bzw. sollen gezeigt werden, andere dagegen gilt es zu verbergen. Der ernst zu nehmende Handlungsablauf ist begleitet von der jeweiligen inneren Verfassung der Krankenschwester, ein Fehler bei der Auswahl der Ampulle oder der der Dosierung könnte zu fatalen Folgen führen. Bei der Frage, warum die Betrachtenden immer wieder zur Person und hierbei speziell zum Gesicht der Schwester schauen, kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Die Stellung des Modells ist in beiden Bildern gleich. Im oberen Foto ist die Akteurin, obwohl seitlich durch die Ausschnittwahl nicht vollständig abgebildet, durch ihr gut einsehbares, freundliches Gesicht eine Art Blickfang. Der Effekt setzt sich im zweiten Bild fort, denn dieses ist durch die Helligkeitskontraste und Bildaufbau strukturierter und zieht in Folge die Aufmerksamkeit auf sich. Während ersteres Bild, das die Schwester bis in Höhe ihres Ellenbogens abbildet, durch den freundlichen Blick einer Einladung zum näheren Betrachten der Bildfolge gleichkommt, eröffnet es den Blick auf das untere Bild auf dem die Akteurin bis in Kniehöhe vollständig zu sehen ist. Die Ausschnittwahl frischt das Arrangement durch den Blick auf das weiße Häubchen der Schwester auf, wodurch ihre Frisur, ihr Körper, ja ihre Person visuell besser zugänglich werden. Soll die eigentlich auf dieser Abbildung erwartete Handlung anschaulich dargestellt werden, wäre es zielführender, nur die Hände mit der Ampulle und der Säge bzw. der Spritze abzubilden, denn es geht im Kern um die Frage des richtigen Haltens. Die Kameraperspektive fängt allerdings vorrangig den Blick der Schwester auf und auf dem zweiten Foto zusätzlich ihren Körper und das Umfeld, welches für die Darstellung der Abläufe nicht relevant ist. Auf der der Bildfolge vorausgehenden Seite ist stichpunktartig in konkreter Reihenfolge der Ablauf des Aufziehens einer Spritze aus einer Ampulle und das korrekte Ablegen selbiger auf dem Tablett angegeben. Laien, die zweifellos beim Betrachten in einer ähnlichen Situation sind wie angehende Fachkräfte, erwarten womöglich, wie solch eine Säge zum Anritzen der Ampulle genau aussieht, wie diese zu greifen ist und wie es mit nur einer Hand möglich ist die Spritze zu halten und gleichzeitig den Kolben aufzuziehen, sodass das Medikament aufgesogen werden kann. Diese relevanten Informationen werden durch die Bilder nicht vermittelt. Die Fotografien könnten daher das Ziel haben, neben dem abgebildeten Bildinhalten auch berufliche Identitätsmerkmale zu übertragen, die darin bestehen, dass eine Krankenschwester in Verbindung mit einer Injektion gegenüber dem Patienten eine positive Atmosphäre verbreitet. Das Umfeld ist ordentlich und aufgeräumt, was von Hygiene und Übersichtlichkeit zeugt und damit der Vertrauenswürdigkeit der Institution beiträgt.
Dagegen setzt sich beim Betrachten eine zweite Lesart durch: Die Krankenschwester könnte eher zum Zwecke der Illustration oder zur Vermittlung von Praxiseinblicken in einem natürlichen Arbeitsumfeld abgebildet worden sein. Hierbei werden berufliche Mythen transportiert. Sowohl Krankenpfleger*innen als auch Ärzt*innen verabreichen Spritzen, sodass durchaus eine andere Person die Injektion vornehmen könnte. Der der Bildfolge vorangehende Text beinhaltet als letzten Punkt des vorgeschriebenen Algorithmus die Anweisung „Spritze auf Tablett legen, leere Ampullen dazu geben“ (ebd. S. 233). Die Ampullen sind deshalb dazuzugeben, damit der Inhalt kenntlich ist, was dann erforderlich ist, wenn eine Pflegefachperson die Vorbereitungen für eine Verabreichung durch ärztliches Personal trifft. Die abgebildete Krankenschwester übernimmt somit, als Lesart des Bildes im Kontext des Buches, assistierende Aufgaben. Es geht im Bild, und damit in der kommunizierten Identität, um das professionelle Schaffen einer angenehmen Atmosphäre durch gezeigte Emotionen, die dem Gesamtablauf förderlich ist. Die positive Ausstrahlung und das vergnügt wirkende Gesicht wirken belebend und aufmunternd, da wo Krankheiten behandelt werden und Ängste vor Spritzen herrschen. Reinheit vermittelt nicht nur die weiße Kleidung (und deren adretter Stil), sondern auch die aufgeräumte Umgebung, in der keine ablenkenden Utensilien zu sehen sind. Ein genauerer Blick lässt den Kugelschreiber in der Brusttasche erkennen; die Tasche des Kittels in Bild zwei wirkt leicht nach außen gewölbt, die Form der Wölbung lässt vermuten, dass sich dort ein Notizheft bzw. Karteikarten im Format ca. A6 befinden könnte, was auf ihre Funktion zur sorgfältigen Dokumentation hinweist. Der am Kragen positionierte Knopf ist kein Stethoskop, sondern erinnert an einen Button, dessen Funktion nicht näher definierbar ist.
Die Bilder auf Seite 79 zeigen den Wechsel eines Lakens bei Bettlägerigkeit.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A 8: Kappelmüller 1984, 79 Copyright © ELSEVIER
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A 9: Kappelmüller 1984, 79 Copyright © ELSEVIER
Zwei Krankenschwestern wechseln offenbar auf einer Bettenstation das Betttuch unter einer liegenden Person, die nicht näher definierbar ist. Das zweite Bild zeigt, dass im Raum mindestens noch zwei weitere Betten stehen. Beide Akteurinnen prägen sich dem Gedächtnis der Leserschaft ein: Das eine Modell demonstriert auf Seite 123 die Sauerstoffmaske, während die zweite Akteurin den Lernenden auf Seite 234 die Handhabung der Ampulle näherbringt. Auch die Ecke im Hintergrund scheint dieselbe zu sein, so wie auf der Bildfolge von der Handhabung der Ampulle. Beide Bilder erscheinen nach Beschreibung des genauen Ablaufes des Wechsels der Bettwäsche im Text und nehmen eine ganze rechte Seite des Buches ein, womit ihre Anordnung für die Betrachtung optimal ist. Die Bilder tragen denselben Titel „Leintuchwechsel“. Den Betrachtenden fällt es schwer aufgrund der Bilder die Reihenfolge im Text nachzuvollziehen. Es entsteht eher ein Bild davon, dass der Wechsel von Bettwäsche bei Bettlägerigkeit aufgrund des Einsatzes zweier Fachkräfte eine gewisse Herausforderung darstellt. Das überdimensional technisch ausgerüstete erscheinende Pflegebett steht in steriler Umgebung. Die Wahl verschiedener Betrachtungsperspektiven verschärft den Effekt: Ein Foto gibt den Blick auf die geflieste Ecke mit dem Waschbecken frei; das zweite verdeutlicht, dass sich im karg ausgestatten Zimmer mindestens drei solcher Pflegebetten befinden. Damit wird der Gedanke einer Erwartung an psychische Stabilität von Krankenpflegerinnen vermittelt. Jeweils abwechselnd legt eine Schwester ihre Hand auf den oder die Patient*in, um ein Wegrollen zu verhindern. Der Aspekt körperlicher Schwierigkeit durch die Hand- bzw. Armstellungen nicht kommuniziert, auch sind keine zu Hilfe kommenden Ärzte im Bild. Damit wird eine gewisse Erwartung an den praktischen Unterricht geweckt, bei dem die Abläufe genau mitzuverfolgen und einzuüben sind. Ein Detail fällt beim Betrachten beider Fotografien auf und wird auch im Text erwähnt: Während eine Krankenschwester hantiert, stützt die jeweils andere den oder die Patient*in in Seitenlage. Beide Schwestern sind in ihrer Tätigkeit vertieft. Die Fotos wirken nicht künstlich gestellt. Der erfasste Aktionsraum und das fast schon als ungeschickt wahrgenommene Fotografieren mit Blitz erwecken den Eindruck von nicht sorgfältig geplanten und arrangierten Aufnahmen. Da beide Schwestern im Gegensatz zu den anderen Fotos im Lehrbuch eine kleinere Bildfläche einnehmen und die Aufmerksamkeit eher auf die Gesamtwirkung der Bildaussage achten, die in der Bildserie eine Erklärung zu den Textinhalten darstellt, tritt deren Persönlichkeit in den Hintergrund. Auch die Gesichtsausdrücke sind neutral. Es handelt sich bei Krankenschwestern keineswegs nur um einzeln agierende Fachkräfte, sondern oft werden schwierigere Tätigkeiten zu zweit ausgeführt. Als weiterer Aspekt der Persönlichkeitsanforderung, die durch das Bild kommuniziert wird, wird der Gedanke an Routinearbeit vermittelt: Die mit mehreren Betten belegten Zimmer einer Station, die immer wieder mit neuer Bettwäsche bezogen werden müssen, die Versorgung der Grundpflege bei Bettlägerigen, all dies erfordert stets gleichbleibende Motivation. Bei sorgfältiger Beobachtung fällt der Helligkeitskontrast der Kittel auf. Der Kittel der Schwester, die an anderer Stelle die Ampulle handhabt, hat offenbar eine reinweiße Farbe, während derjenige der Schwester, die aus dem bereits betrachteten Bild in Verbindung mit der Sauerstoffmaske etwas dunkler ist. Aufgrund der Schwarz-Weiß-Technik lässt sich keine Aussage darüber treffen, welche Farbe ihr Kittel hat. Denkbar wäre ein sehr helles Blau oder Grün. Denselben Kittel trägt sie auf dem Foto mit der Maske, was auch dessen düstere Wirkung (im Kontrast zu den hochweißen Strukturen auf den Bildern mit der Ampulle) erklärt.
Das Bild auf Seite 121 stellt gewissermaßen einen etwas größeren Kontrastpunkt im Rahmen der Vollerhebung der Fotografien des Lehrbuches dar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A10: Kappelmüller 1984, 121 Copyright © ELSEVIER
Das Bild bildet aufgrund seines Formates von einer halben Seitengröße (im Gegensatz zu den beiden Zweibildserien) den parallelen Gegenpol zur anfangs beschriebenen Fotografie mit der Frau bei der Sauerstoffflasche. Auf dem linken Teil der Doppelseite ist die Verwendung der Nasenbrille in knappen Stichworten näher beschrieben. Der Verweis auf das Foto erfolgt nach der einleuchtenden Aussage „Atmet der Patient durch den Mund, ist die Sauerstoffzufuhr mit der Brille wirkungslos“. Folglich ist auch die Patientin auf dem Bild mit – wie es scheint - bewusst geschlossenem Mund abgebildet. Auch Gestaltung und Anordnung des Bildes unterscheiden sich. Es ist etwas größer als die Einzelbilder der Zweibildserien. Die rechte Buchseite beginnt direkt mit der Fotografie, danach schließt die Seite mit zwei einfachen schemenhaften Zeichnungen zur Visualisierung eines Nasenkatheters zur Verabreichung von Sauerstoff. Außer den Bildunterschriften findet sich kein Text auf der Buchseite. Das Bild erfreut sich so einer für die Betrachtenden optimalen Positionierung, wird zum Blickfang und lädt zu längerem Verweilen ein. Im Unterschied zu den bereits besprochenen relevanten Fotografien fällt der Helligkeitskontrast auf. Etwa drei Viertel des Bildes werden durch die reinweiße Wand, die Bettwäsche und die den Kittel der Krankenschwester eingenommen. Dadurch wird der Blick auf die dunklen Partien gelenkt, für die in erster Linie die beiden Gesichter und die Hände der Krankenschwester relevant sind. Tatsächlich gewährt das Bild im Gegensatz zu den bereits besprochenen Fotografien freien Blick auf das Gesicht einer Patientin. Auch in diesem Punkt eröffnet sich ein Kontrast: Während die Krankenschwester dunkles Haar in sorgfältig frisierter Form trägt, ist das Haar der Patientin ungeordneter, ist vom Liegen (und Leiden?) zerzaust, seine Farbe scheint im vorderen Teil grau und im hinteren dunkel zu sein. Damit könnte angedeutet sein, dass der Leidensweg der Patientin bereits ein längerer ist, einst gefärbte Partien ausgewachsen, längst den Besuch beim Friseur, als Schlusspunkt des Leidensweges herbeisehnen. Der gläserne Blick der Patientin bestätigt den gewonnenen Eindruck. Die Patientin nimmt die Anwesenheit der Krankenschwester kaum wahr. Der Blick ist abgewendet, irgendwohin – ins Nichts. Die Betrachtenden können weder Freude, noch Leiden wahrnehmen. Kaum wird die Patientin in diesem Moment an irgendetwas denken. Möglicherweise erhält sie Schmerzmittel, denn oft ist die Gabe von Sauerstoff eine lebensverlängernde Notwendigkeit auf Intensivstationen. Wandert der Blick der Betrachtenden zur Krankenschwester, so entsteht ein komplementärer Eindruck. Denn ihr Gesichtsausdruck verkörpert Gelassenheit, Ruhe und einen fürsorglichen Ruhepol. Ihre Erscheinung verbreitet so etwas wie eine Atmosphäre der Geborgenheit. Im Kontrast zu den anderen Bildern ist das streng wirkende Häubchen nicht zu sehen; der Blick fällt frei auf die sorgfältig präparierte, zeigemäße Frisur. Das Kopfkissen ist nicht zerknittert und mag frisch aufgeschüttelt und bezogen worden sein. Die Wahl des Ausschnitts lässt die Gesichter beider Personen größer, zentraler erscheinen. Ihre Hände prüfen bzw. regeln sorgsam den Sauerstoffzufluss in der Nähe des Kopfes der Patientin. Tatsächlich geht es beim Beruf um Berührungspunkte zu Patienten. Wem menschliche Nähe und damit Einfühlungsvermögen als Fremdwort erscheint, eignet sich kaum als Pflegefachkraft. Was sich beobachten lässt, steht auch im gänzlichen Gegensatz zum Bild auf der folgenden Doppelseite, denn dort macht sich die Leserschaft mit der Erscheinung der bereits beschriebenen Protagonistin mit der Sauerstoffflasche vertraut. Da ist die abgebildete Krankenschwester kühl technikorientiert und sachlich, hier verraten ein entspannter und doch konzentrierter Blick und die locker und dennoch gezielt prüfenden Hände Einfühlungsvermögen einer hilfsbedürftigen Person gegenüber. Die die zweifelsohne transportierten beruflichen Mythen sind vielschichtig. Eine idealisierte Krankenschwester ist in Anwesenheit von Kranken stets rücksichtsvoll und empathisch. Dennoch bewahrt sie Ruhe und souveräne Professionalität auch in emotional schwierigen Situationen (wie auf Intensivpflegestationen). Auf dem Bild scheint sie der Zustand der schwerkranken Patientin nicht zu erschüttern – sie bringt Leben und erzeugt der Patientin das Bild sich in guten Händen fühlen zu können. Ein weiterer Gegenpol lässt sich im Alter der beiden Personen lokalisieren. Während die Patientin allem Anschein nach zwischen 50 und 60 Jahre alt ist, so ist die Krankenschwester offenbar noch keine 30 Jahre alt. Ihre Frisur ist gediegen dem allgemeinen Bewusstsein solider Mode jener Zeit angepasst; kommuniziert werden Pflege und Sorgfalt. Die Wahl eines jüngeren Modelles erscheint logisch, da sich das Lehrbuch „vor allem an die in Ausbildung in der Krankenpflege stehenden Personen“ (S.VII) wendet. Was kommuniziert wird, liegt gemäß dieser Lesart auf der Hand: Pflegefachkräfte stehen womöglich noch am Beginn ihres beruflichen Lebens, werden jedoch alltäglich mit dem anderen Ende des menschlichen Lebens konfrontiert. Sachliche Distanz und Sorgfalt werden identitätsprägend.
Globalcharakteristik und Zusammenschau der untersuchungsrelevanten Beobachtungen
Die sechs Schwarz-Weiß-Fotografien im Lehrbuch für „Allgemeine Krankenpflege“ von Irmgard Kappelmüller aus dem Jahre 1984 visualisieren auf sachliche Weise verschiedene Tätigkeiten von Krankenpflegefachkräften. Die mit dem Text in Verbindung stehenden Fotos haben vertiefenden erklärenden Charakter, sie transportieren jedoch auch berufliche Mythen. So vielschichtig die Aufgaben für Krankenpflegefachkräfte auch ausfallen mögen, so sehr unterscheiden sich auch die Fotografien. In zwei Fällen scheinen sie durch die Verwendung von Zweibild-Folgen die Wichtigkeit des Nachlesens und Beachtens bestimmter, im Text detailliert beschriebener Schrittabläufe anzuregen. Auf allen Fotografien sind weibliche Krankenpflegefachkräfte abgebildet, was bereits ein Hinweis auf die Stärkung beruflicher Mythen darstellt. Bemerkenswert bei allen Fotografien ist, dass die Krankenpflegefachkräfte ohne ärztliches Personal abgebildet sind. In der Praxis arbeiten beide Berufsgruppen jedoch oft Hand in Hand. Durch das Lehrbuch wird damit indirekt die zu erwartende Fachkompetenz und das autonome Handeln, wo immer erwartet und angebracht, in den Fokus gerückt, denn im Lehrbuch veranschaulichen Pflegekräfte ihr Handeln. Auch wenn die Protagonistin auf dem eingangs vertieft analysierten zentralen Bild technikversiert und sachlich-konzentriert erscheint, beweist die Darstellerin bei der Handhabung der Ampulle – einem nicht minder verantwortungsvollen Einsatzfeld – Professionalität in Emotion work. Fast entsteht der Eindruck eines freudigen Spieles mit kleinen Gegenständen, aber hierin schlummert die angedeutete Ambivalenz: Das, was wie Übermut erscheint mag durchaus erwartete Professionalität sein. Berufliche Identität bewegt sich hier im Bereich zwischen persönlichen Gefühlen und zu vermittelnden Gefühlsäußerungen, was beides im Spannungsfeld des Berufes liegt. Die Arbeit das, was einen Großteil der Lebenszeit ausmacht, weshalb Handlungen stets von unterschiedlichen Emotionen begleitet sind und, nach außen kommuniziert, begleitet werden sollten. Keineswegs vermitteln die Schwarz-Weiß-Fotos einen monotonen Eindruck, vielmehr entsprechen Gefühlsausdrücke der Fotomodelle der jeweiligen Situation. Während die Krankenschwester im Foto von der Sauerstoffapparatur technisch versiert dargestellt wird, ist jene in der Aufnahme mit der Nasenbrille einfühlsam, interessiert Geborgenheit zu bieten. Hierbei fällt auf, dass die Fotografien grundsätzliche Eigenschaften von Krankenschwestern kommunizieren. Einerseits ist für die Bewältigung des beruflichen Alltags mathematische Genauigkeit und Sorgfalt erforderlich, in anderen Situationen hingegen Menschenfreundlichkeit und Empathie. Auch das ambivalente Spannungsfeld als identitätsbildendes Moment im beruflichen Alltag von Pflegefachkräften ist auch im Kontrast von Teamwork (Leintuchwechsel) und Einzelverantwortung (Verwendung der Ampulle) erkennbar. Auf latente Weise verweist der adrette Kleidungsstil und der vorbildliche Zustand in puncto Reinheit in den Fotografien auf Ideale, welche Pflegfachkräfte in den erhabenen Stand ihrer Profession erheben und damit in die Lage versetzen, den oft unfreiwilligen Aufenthalt der Patienten auf Krankenstationen erträglicher und würdevoller zu gestalten und Vertrauen in eine solche Institution zu stärken. Die Kleidung kann auf den Fotografien auch als eine Art Barriere gelesen werden, denn oft müssen sich Pflegefachkräfte abzugrenzen vermögen. Die notwendige menschliche Nähe und Wärme die einerseits dem Genesungsprozess förderlich ist, steht der Unmöglichkeit den Wünschen aller Beteiligter (Ärzteschaft, Patienten, Angehörige) völlig entsprechen zu können entgegen. Um dem Dilemma professionell die Stirn zu bieten, erscheint die korrekte und dennoch fast sportlich anmutende Kleidung als geeignetes Mittel: Sie bildet die Trennung zwischen der individuellen Persönlichkeit der Krankenpflegerin und ihrer beruflichen Rolle, die sie jeweils einzunehmen hat. Emotion work ist dann notwendig, wenn die Krankenschwester ihre berufliche Rolle wahrzunehmen hat. Sobald die Berufskleidung angelegt ist, erfordert die Profession persönliche Gefühle zu kontrollieren. Ein Lächeln rein zur Belustigung in der Bildfolge vom Aufziehen der Spritze würde im starken Kontrast zu Emotion work nichts anderes als unprofessionell wirken. Zum Bestandteil beruflicher Identität gehört das Vermögen sich persönlich abgrenzen zu können, im Falle des Mangels dieser Fähigkeit wird eine Pflegefachkraft ihrer Rolle langfristig kaum gerecht zu werden vermögen.
Bildanalyse 3: Krankenpflegerin bei der Arztvisite 2014
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A11: Berga 2014, 78 Copyright © Westermann Gruppe
Quelle: Kompetente Pflege, Lernbereich 4, Pflege als Beruf – berufliches Selbstverständnis entwickeln, Bildungsverlag EINS, Köln 2014; S. 78; ISBN 978-3-427-16122-6 (Lehrheft 125 Seiten; 73 Zeichnungen und Fotos + Titelfoto; davon bilden 46 Pflegefachkräfte ab)
In der nun folgenden Analyse werden sechs der 46 Bilder analysiert, wobei der Schwerpunkt auf der Fotografie von Seite 78 liegt. Das Bild unterscheidet sich durch sein größeres Format (eine halbe A4-Broschürenseite) und durch die kontrastreiche Gestaltung. Bildkonstruktion, Farbgestaltung, Personenkonstellation und Kontext (Bildhintergrund) weisen mannigfaltigere Strukturen auf, die das Bild zum Blickfang in der Publikation werden lassen.
1. Was sind die ersten Eindrücke der Interpretierenden: a) vom Kontext; b) subjektive Assoziationen?
a) Ort: Arztpraxis; Zeit: offenbar tagsüber; Wetter: es ist eine Innenfotografie, jedoch scheint es ein klarer Tag zu sein – vermutlich etwa zur Mittagszeit, das Licht ist weißgefärbt; die meist dunklen unteren Partien sind allesamt gut ausgeleuchtet, wie es in tageshell lichtdurchfluteten Räumen möglich ist. Dieser Effekt lässt sich schwer mit ausschließlich künstlicher Beleuchtung erreichen.
b) Subjektiv fällt der Blick zuerst auf die den Betrachtenden direkt zugewandte und sich durch optische Kontraste prägnant abhebende Krankenpflegerin, danach – in Kontrastreihenfolge auf den links abgebildeten Arzt, dann auf das Gesicht des Patienten. Einen letzten deutlichen Halt macht der Blick bei der von allen drei Personen fokussierten Stelle, dem Knie des Patienten.
2. Was empfinden Interpretierende, wenn sie die Personen auf dem Bild nachstellen (Körperlichkeit)?
Der Nachstellungsversuch ergibt aus den Positionen der Personen ein sehr natürliches Bild: Die Krankenpflegerin hält zwar den Stift, schreibt aber im Moment der Aufnahme nichts, da sie über das Blatt hinweg Richtung Patientenknie blickt – offensichtlich, damit ihr für die Dokumentation nichts entgeht. Allerdings ist es unmöglich auf einer sehr dünnen Mappe in A4-Format, die nur ganz unten mit einer Hand gehalten wird, am oberen Rand eine Eintragung vorzunehmen. Ihr gesteigert konzentrierter Blick erscheint beim Nachstellungsversuch eher übertrieben. Die Haltung des Arztes ist der Arbeit entsprechend praktikabel gewählt und problemlos nachzuahmen. Der Patient schaut eher auf den Unterarm des Arztes, so als würde er sich auf sein Gefühl (des Schmerzes?) konzentrieren, der halb geöffnete Mund deutet an, als beschreibe er seine Wahrnehmung. Der Nachstellungsversuch zeigt, dass bei gewählter Kopfstellung der Blick auf das Knie nahezu unmöglich ist; auch ist sein leichtes Lächeln durchaus schwer nachzumachen und wirkt damit gekünstelt.
3. Was ist auf dem Bild zu sehen (Versprachlichung)? Welche Bedeutung drückt es aus (Sinngehalt)?
Versprachlichung: Es ist eine Szene in einem Behandlungszimmer abgebildet. Der Bildausschnitt ist gerade so groß gewählt, dass die gesamte Personengruppe abgebildet ist. Umliegende Details fehlen, sodass nicht klar ersichtlich ist, in welcher Art Einrichtung die Szene spielt. Die Personen sind alle drei in Aktion abgebildet. Der ca. 70-jährige Patient rechts hält seinen linken Oberschenkel mit beiden Händen, während der ca. 30-jährige Arzt mit seiner rechten Hand das linke Knie des Patienten berührt. Etwas zurückversetzt, jedoch deutlich mittig, sitzt der Kamera eine Krankenschwester gegenüber, den Blick interessiert auf die Untersuchung des Knies gerichtet und mit Mappe und Stift, schreibbereit, gerüstet.
Sinngehalt: In der direkten Lesart geht es um die Darstellung der Tätigkeit einer Krankenpflegefachperson, hier als Arzthelferin, vermutlich bei einer Erstaufnahme. Die Bildunterschrift bestätigt diese Annahme, wobei hier eine „Arztvisite“ genannt ist. Typischerweise sind bei solchen Untersuchungen, wie der abgebildeten bei Arztvisiten in Praxen kaum Krankenschwestern anwesend. In Rehaeinrichtungen und Krankenhäusern mag dies eher der Fall sein. Für die bildbetrachtenden angehenden Pflegefachkräfte ist die Krankenschwester Hauptprotagonistin. Interessanterweise beschreibt sie die Bildunterschrift als „Mitarbeiterin bei der Arztvisite“. Dies ist ein klarer Hinweis auf den Transport beruflicher Mythen. Eine Krankenschwester hat sich getreu an ärztliche Anweisungen zu halten. Sie ist aufmerksam interessiert am zu behandelnden Problem, stets bereit zu agieren. Dies ist konstitutiver Bestandteil ihrer beruflichen Identität als Mitarbeiterin. Tatsächlich hat der Arzt mit dem Stethoskop um den Hals ein etwas anspruchsvolleres Handwerkszeug im Bild zur Verfügung, die Krankenschwester dagegen ist in größerer Aktion mit dem Kugelschreiber dargestellt. Der Hintergrund mit dem Gummihandschuhspender im ähnlichen Blau wie der Kittel der Krankenschwester und die rechts hinten angedeutete Apparatur lassen weitere geforderte Fachkompetenzen und ein vielseitiges Aufgabenspektrum erahnen. Betrachtende kommen zu dem Schluss, dass für Gesundheitspflegende charakteristische Merkmale wie Aufmerksamkeit und Ernsthaftigkeit im Rahmen ihrer unterstützenden Rolle im hierarchischen Verhältnis in Bezug auf die Beruflichkeit zentral sind. Damit gibt die Fotografie Lernenden nicht nur Einblicke in eine Arztvisite, vielmehr vermittelt sie charakterliche Erfordernisse an Gesundheitsfachpersonen.
4. Gibt es etwas, das die Interpretierenden auf dem Bild erwartet hätten, was aber fehlt (Interpretation des Nicht-Vorhandenen)?
Beim genaueren Betrachten verwundert, warum bei einer Visite, das Knie – die zentrale Stelle der Untersuchung – von Kleidung verdeckt dargestellt ist. Dies wirkt tatsächlich unrealistisch. Ein praxisnahes Foto würde ein freies Knie abbilden. Eine konkurrierende Lesart, die jedoch aufgrund der Bildunterschrift auszuschließen ist, wäre, dass es sich nicht um eine Arztvisite handelt, bei der es um die Beobachtung der Genesung des Patienten geht, sondern um eine Patientenaufnahme in der Notfallstation eines Krankenhauses. Denn in einem solchen Fall kann es durchaus sein, dass sich der Arzt erst einen allgemeinen Überblick verschafft, bevor er das Knie genauer untersucht. Auch das Beisein der Pflegefachkraft wäre damit leichter erklärbar. Genannte Unstimmigkeit weist darauf hin, dass nicht die Realität abgebildet wird, sondern die Realität ist idealisiert dargestellt. Da die Fotografie die Rolle einer Krankenschwester bei der Arztvisite visualisiert, kann davon ausgegangen werden, dass versucht wurde eine Idealvertreterin abzubilden, womit die Übertragung beruflicher Identitätsauffassungen in den Fokus rückt. Dieses zentrale, weil optisch dominante Foto im Lehrheft, stellt eine Arztvisite idealisiert dar. Ein weiterer Aspekt ist das vollständige Fehlen von Kopf- und Körperschmuck - nicht einmal Eheringe oder Billen lenken vom Geschehen ab, sodass sich die Betrachtenden ohne Einfluss irritierender Details vollständig auf die Konstellation der abgebildeten Personen und deren Bedeutung konzentrieren können.
5. Wie ist das Bild aufgebaut? Was ist zentral (optische Gewichtung)?
Optisch zentral ist die Krankenpflegerin dargestellt. Genauer: die Mappe und der Stift, wodurch die Aufmerksamkeit auf die Krankenpflegerin gebündelt wird. Die zu erzielende Wirkung ist klar: es geht darum ihre Tätigkeit und Persönlichkeitsmerkmale abzubilden. Es ist eine bemerkenswerte Konstellation, obwohl sie bildmittig einzig den Betrachtenden zugewandt steht, ist sie dennoch im Hintergrund – ca. 80 cm zurückversetzt: Arzt und Patient umgeben sie vordergründig. Unten schließt der untersuchende Griff des Arztes zum Patientenknie das Bild rahmend ab. Den Blick fest und mit Spannung auf die Aktion gerichtet, ist die Arzthelferin ernsthaft sowohl am Führen der Patientenakte, wie auch an Patientenwohl interessiert, bereit jederzeit feinste Beobachtungen schriftlich festzuhalten. Die Dokumentation von Befunden und die Anwesenheit beim Untersuchungsgespräch heben die Wichtigkeit ihrer Arbeit hervor. Der Blick des Arztes und der Krankenschwester, sowie der Griff zum Knie des Patienten bilden eine Einheit, die das Knie fokussieren. Die Gesichter der drei abgebildeten Personen bilden eine Linie, jedoch ist das Augenpaar der Krankenschwester etwas über der Verbindungslinie der Augenpaare zwischen dem Patienten und dem Arzt. Es kann nicht geklärt werden, ob der Effekt gewollt ist, jedoch entsteht auf diese Weise der Eindruck, die Krankenschwester, obwohl im Hintergrund, überblicke die Situation. Auffallend ist auch der Farbkontrast: Sie allein erscheint in satterem Blau – ob die Box mit den blauen Behandlungshandschuhen, im Hintergrund gleich neben ihr versetzt angeordnet, zufällig auf dem Bild dargestellt sind, scheint ausgeschlossen zu sein. Erstaunlich auch der Kontrast der Haarfarben – während Arzt und Patient blond sind, ist die Krankenpflegerin einzig prägnant schwarzhaarig, was die Aufmerksamkeit zusätzlich zum Verweilen einlädt. Im Gegensatz zu den beiden männlichen Personen ist sie auffällig klein (Kopf, wie auch Körpergröße), was nicht nur damit zusammenhängt, dass sie etwas weiter zurückversetzt steht, es mag sich dabei um ein bewusst gewähltes Stilelement zum Erreichen einer bestimmten Wirkung handeln. Auch sind Krankenschwester und Arzt relativ jung, etwa desselben Alters, während der Patient ca. 40 Jahre älter ist. Darüber hinaus lässt sich in der Kleidung ein Stilkontrast zwischen Arzt und Krankenschwester lesen: Während er im weißen Kittel, mit langem weißem Hemd und Krawatte gekleidet, untersucht, hat sie einen kurzärmeligen, schlichten Berufskittel. Damit sind auch in der Kleidung die Hierarchiestufen abgebildet.
6. Wie sehen die abgebildeten Personen aus (Gestik, Mimik, Haltung, Kleidung)? Wie ist ihr Verhältnis zueinander?
a) Wie möchten sich die Personen möglicherweise darstellen (subjektiv- intentional)?
Die Personen scheinen hier ihre Rolle ernsthaft spielen zu wollen. Und tun es auch.
b) Wie stellen sie sich faktisch für die Interpretierenden dar (objektiv-latent)?
Die bereits genannten Abweichungen zur Realität - das nicht entblößte Knie eines Patienten während der Untersuchung und die unrealistische Schreibhaltung der Krankenpflegerin - tun in Wirklichkeit der Darstellung einer Pflegerin in ihrem Arbeitsumfeld keinen Abbruch, dem flüchtigen Auszubildenden mögen diese Details nicht wesentlich erscheinen, ja nicht einmal auffallen. Dass ein Patient als Beiwerk für das Berufsbild der Pflegeausbildung im Moment der Berührung eines schmerzhaften Gelenkes lächelt, erscheint angesichts des starken Auftrittes der Pflegerin bedeutungslos. Die Aufmerksamkeit der Bildbetrachtenden wird eher auf den genau mittig ausgerichteten, aufmerksamen Blick der Krankenschwester abgelenkt.
In welchem Verhältnis stehen diese beiden Sinnebenen zueinander? Es scheint sich eine Abweichung im Falle des Patienten zwischen subjektiver-intentionaler und objektiv-latenter Sinnebene zu ergeben. Bei der Bildbetrachtung ist deutlich spürbar, dass er seine Aufgabe vor der Kamera zu posieren ernst nimmt, jedoch widersprechen sich sein Lächeln und das besorgte Halten seines Oberschenkels mit beiden Händen. Der Arzt macht einen sehr authentischen Eindruck: sein Blick ist sachlich auf das zu untersuchende – wenn auch unter dem Stoff verborgene - Knie gerichtet. In seiner Rolle als Modell fühlt er sich offensichtlich wohl. Auch die Protagonistin des Bildes, vermutlich ist sie sich im Moment der Aufnahme nicht bewusst, dass ein reales Scheiben in der dünnen Mappe schwer möglich sein mag, aber die Aufgabe als Modell zu dienen, nimmt sie gern und zuverlässig wahr. Währe ihre Schreibposition tiefer und damit realistischer, könnten Betrachtende den Stift nicht sehen und der Transport dieses sinnstiftenden Details nicht mehr gegeben. Ein höheres Halten der stützenden Hand würde weniger geschickt aussehen und ihre Persönlichkeit weniger ausdrucksstark zur Geltung bringen. Die Interpretierenden kommen zu dem Schluss, dass die Pflegerin im Foto ihren Auftrag ernst nimmt und es in ihrem Falle zu einer völligen Deckung beider Sinnebenen kommt. - Eine bis auf wenige Details geschickt in Szene gesetzte Fotografie.
7. Welche (sozio-kulturellen und historischen) Kontextinformationen können die Interpretierenden nutzen (Erweiterung möglicher Lesarten)?
Das Bild nimmt im Gegensatz zur Mehrheit der Bilder in der Publikation eine sehr dominante Stellung ein: nur 7 Bilder sind größer als ein Drittel des A4 Formates einer Buchseite.
Das Kapitel beschreibt das Berufsbild von Gesundheits- und Krankenpfleger*innen, welches im Buch gleich nach der Beschreibung des Berufsbildes der Altenpfleger*innen beschrieben wird.
Die Bildunterschrift weist darauf hin, dass es sich um eine Gesundheits- und Krankenpflegerin – im Kontrast zur Altenpflegefachkraft – handelt. Hier ist sie explizit als Mitarbeiterin bei der Arztvisite dargestellt; die Bildunterschrift stellt demnach ihre Rolle in der Hierarchie von Spezialisten dar. Genau dieses Element ist auch im Bild dargestellt. Offensichtlich ist der Arzt der Akteur, sie scheint auf die Anweisungen des Arztes interessiert und aufmerksam zu warten. Damit ist sie fest institutionalisierter Teil der Arbeitsteilung im Rahmen medizinischer Behandlung. Darüber hinaus ist es bezeichnend, dass die Bildunterschrift den Begriff „Mitarbeiterin“ verwendet. Trotz zunehmender Anzahl männlicher Berufsvertreter wird an dieser Stelle die weibliche Form verwendet.
Tatsächlich werden, wie oben bereits angeschnitten, Krankenpflegefachkräfte als Assistenz bei der Arztvisite in der dargestellten Form eher in Krankenhäusern und Rehaeinrichtungen, sowie Arztpraxen mit sehr hoher Patientenfrequenz zum Einsatz kommen. Bei gewöhnlichen Hausarztpraxen ist es eher ungewöhnlich, dass Aufzeichnungen über den Gesundheitszustand von Arzthelferinnen zeitgleich zur Untersuchung gemacht werden.
Als weitere Lesart des Bildes kommt erneut die Personenkonstellation in den Blick. Arzt und Krankenpflegerin sind etwa gleichen Alters, wodurch eine Symmetrie visualisiert ist. Der Beruf der Krankenpflegefachkraft ist sehr nah am ärztlichen Beruf. Im Bild ist dies durch ihre räumliche Nähe zum Arzt erkennbar. Als unterstützende Kraft ist die Schwester um Bild zentraler Teil des Arzt-Patienten-Bündnisses, die vom fachlichen Können und Wissen des Arztes profitiert. Der Aspekt des Helfens betrifft beide Seiten – einerseits wird dem Arzt durch die Erfassung der Daten die Grundlage seiner Entscheidungen gelegt, andererseits erhält der Patient eine Behandlung, die optimal aufgrund der erfassten Daten zugeschnitten wurde. Auch wenn sein Lächeln etwas merkwürdig erscheint, kann damit versucht worden sein, sein Wohlbefinden bildlich auszudrücken. In Zeiten zunehmender Digitalisierung erstaunt die Beobachtung der handschriftlichen Datenerfassung in einer modern anmutenden Einrichtung. Jedoch kann auch dies als Symbolik der Entschleunigung gelesen werden. Nicht durch Technik forcierte Effizienz ist das Ziel – sondern dem persönlichen Wohl des Patienten soll Zeit gewidmet werden.
8. Falls es mehrere konkurrierende Interpretationen (zum Gesamtbild oder zu einem Detail) gibt: Welche erscheint am wahrscheinlichsten? Warum?
Das Bild macht einen einheitlichen Gesamteindruck und lässt wenig Raum für verschiedene Interpretationen. Unmittelbar unter der Überschrift „Berufsbild Gesundheits- und Krankenpfleger/in“ eingefügt. dient das Bild dazu, angehenden Fachkräften Einblicke ins künftige Arbeitsumfeld zu bieten. Das darüber im vorangehenden Abschnitt befindliche (kleinere) Bild einer Altenpflegerin bei der Tätigkeit, bildet eine Abgrenzung bzw. einen Kontrast zu verwandten Tätigkeitsfeldern. Die Bildunterschriften machen Ziel und Zweck eindeutig und stimmen mit der Gestaltung überein. Diese bestehen darin, einen Einblick in einen Teilbereich des typischen Tätigkeitsspektrums ausgebildeter Gesundheits- und Krankenpfleger*innen zu bieten. Im Rahmen des Kontextes ist zu erkennen, dass der Bildinhalt mit der im Text enthaltenen Information korreliert und damit didaktischen Zwecken entspricht. Die idealtypische Darstellung des Bildinhaltes, lädt zur Besprechung zu Unterrichtzwecken ein. Es ist gelungen, klare Botschaften an in Ausbildung befindliche Fachkräfte zu vermitteln. Das Bild ist offenbar speziell so konstruiert, dass die Lernenden eingeladen werden, sich etwas länger mit der Betrachtung des Bildes zu beschäftigen. Damit werden zweifellos Berufsmythen sowie beruflichen Ethos an angehende Fachkräfte transportiert. Ausgehend von der Zielsetzung der Interpretation weist das Bild auf den erwarteten Charakter bzw. die gewünschten Eigenschaften angehender Gesundheits- und Krankenpfleger*innen hin. Die abgebildete Mitarbeiterin ist typischerweise weiblich, aufmerksam, interessiert im Dienst für ärztliches Personal und Patient*in, beherrscht sowohl Praxisorganisation und Dokumentation und hat ihr Hauptaugenmerk auf gesundheitliche Belange. In Zeiten fortschreitender Digitalisierung, verwendet sie (offensichtlich der Flexibilität wegen) einen Stift und die Patientenakte in Papierform – was eine Orientierung an klassische, bewährte Werte demonstriert.
Das Bild rückt die zentral positionierte, den Betrachtenden gegenüberstehende, Krankenschwester ins Visier. Der Kontrast wird dadurch erhöht, dass sie im Gegensatz zu den beiden anderen Figuren weiblich ist. Auch ist sie in strahlend-kräftiges Blau gekleidet und unterscheidet sich in maximal möglichen Kontrast durch ihre Haarfarbe. Selbst ihr Blick scheint aufmerksamer und ernsthafter auf die dargestellte Problemsituation gerichtet zu sein, als dies beim Patienten und beim Arzt zu beobachten ist. Damit wird sie in den Augen der Betrachtenden, trotz ihrer in der Hierarchie niedrigeren Stufe, zur eigentlichen Protagonistin der Szene.
9. Mit welcher Technik wurde das Bild aufgenommen (Weitwinkel, Tele, Perspektive, Ausschnitt, Licht)?
Vermutlich wurde das Foto mit einem Normalobjektiv aus ca. 4 m Entfernung bei seitlich von links kommendem Licht und zusätzlich seitlich von rechts erhellenden Reflexionsschirm aufgenommen wurde. Der Ausschnitt zeigt die Mitte des Raumes, das Aktionsfeld besitzt größte Schärfe, wobei die hohe Tiefenschärfe den ganzen Raum klar abbildet. Lediglich wenige Gegenstände im Hintergrund sind etwas unschärfer (z.B. Handschuhbox), sodass der Blick von der optischen Gestaltung nicht abgelenkt wird. Durch die Wahl der Perspektive entsteht der Eindruck direkten Dabeiseins. Die perfekt konstruierte Perspektivmitte ist identisch mit dem Punkt, an dem sich die Blicke aller drei Modelle kreuzen, dies ist etwa ein Zentimeter links der Bildmitte, und zwar genau da wo der Kugelschreiber sich leicht unterhalb des Dekolletés der Krankenpflegerin befindet – dem eigentlichen Aktionspunkt der tätigen Berufsfachkraft. Der Bildausschnitt lässt außerhalb der Personengruppe keine weiteren Einblicke in das Umfeld der Praxis zu. Die scharfen Konturen der gesamten Bildkomposition und die strahlenden Farben fesseln den Blick der Bildbetrachtenden. Die dadurch gewonnene Zeit ist Voraussetzung für den Transport beruflicher Mythen.
10. Um nichts zu übersehen, sollte man abschließend durchaus systematisch analysieren: von oben nach unten, von links nach rechts!
Der Abschlussblick eröffnet noch die nicht gleich ins Auge fallende Lampe über dem Behandlungstisch. Mitunter finden sich solche Lampen auch in Arztpraxen, viel häufiger jedoch in Kliniken, sodass im gegebenen Fall eher Eindrücke über das Umfeld in einer größeren Gesundheitsinstitution wiedergegeben werden. Die Beobachtung hilft die Annahme auszuschließen, dass die Visite in einer Hausarztpraxis stattfindet. Letztlich spricht auch die Wahl der blauen Berufskleidung eher für eine größere Gesundheitsinstitution.
11. Bild eines maximalen Kontrastes in der Publikation:
Die Publikation, der das Bild entnommen wurde, ist ein 125-seitiges Lehrheft in A4-Format. Die Zielsetzung der Broschüre besteht (wie bereits im Titel formuliert) darin, Tätigen in den verschiedenen Pflegeberufen professionelles Selbstverständnis zu vermitteln. Damit ist zu erwarten, dass sämtliche Fotografien sorgfältig unter dem Aspekt berufliche Identität zu fördern ausgewählt wurden. 46 Fotografien bilden Krankenpflegefachkräfte in den verschiedensten Praxissituationen ab. Ein Kurzüberblick stellt vier Bilder dar, die zur analysierten Fotografie einen Kontrastpunkt bilden, wonach auf eine fünfte Fotografie als Maximalkontrast etwas näher eingegangen werden soll.
Ebenfalls auf Seite 78 positioniert bildet die Fotografie zum Abschnitt „Berufsbild Altenpfleger/in“ einen ersten markanten Gegenpol. Sehr auffallend am Bild ist das Lächeln. Es wirkt ausgelassen. Offenbar ist die Freude nicht gespielt. Hier legt die Pflegerin ihre ganze Persönlichkeit, Identität in den Beruf. Die berufliche Situation erfordert in der Szene den Einsatz von Gefühl, wodurch das Ziel der Arbeit – die Betreuung – zum Mehrwert für den Patienten wird. Allein die Bildunterschrift „Die Altenpflegerin arbeitet selbstständig und eigenverantwortlich“ grenzt die Akteurin des Bildes offensichtlich von der bereits näher betrachteten Gesundheits- und Krankenpflegerin ab. Während die Krankenpflegefachkräfte sich eng an den ärztlichen Unterweisungen zu orientieren hat, spielt bei Betreuungskräften Empathie und Gefühl für die jeweilige Situation eine zentrale Rolle, was den Ablauf der Arbeitsschritte bzw. die Vorgehensweise beeinflusst. Eine Betreuungsfachkraft hat damit einen höheren Freiheits- und Eigenverantwortungsgrad in der Gestaltung beruflicher Handlungsweisen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A12: Berga 2014, 78 Copyright © Westermann Gruppe
Das Bild der Altenpflegerin ist flächenmäßig etwa halb so groß und daher weniger augenfällig, als das darunter befindliche Bild der Gesundheitspflegerin. Allerdings laden die Gesichter zum Verweilen ein. Das Lachen der Pflegerin wirkt natürlich. Sie empfindet Freude bei der Arbeit, die im Moment der Aufnahme in einem Dominospiel besteht. Auch das Gesicht der betreuten Person (der Altersunterschied beider ist nahezu maximal gewählt und könnte gut 50 Jahre betragen) drückt große Freude. Beide schauen auf das Spiel, doch fallen zwei Details auf. Der Senior hat seine Steine auf die Seite gestellt, was durchaus unüblich ist. Es könnte sich dabei von einer von Demenz betroffenen Person handeln, deren kognitive Fähigkeiten durch das Spiel aktiviert werden sollen. Auch ist der persönliche Bezug stark durch sein Berühren des Handgelenkes der Pflegerin dargestellt. In einer weiteren Lesart können damit auch Herausforderungen in Form eines Nähe-Distanz-Dilemmas angedeutet sein, mit denen sich Pflegepersonal konfrontiert sehen mag. In der Tat müssen Pflegende sich persönlich gern in ihre Tätigkeit einbringen, will ihre Arbeit Freude machen und die gewünschten Resultate zeigen. Auf diesem Bild ist der Farbkontrast der Kleidung des Mannes ist wesentlich auffälliger, auch sitzt er den Beobachtenden gegenüber, wodurch durchaus zu verstehen gegeben wird, dass er die Hauptrolle spielt und zu Recht die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Auch dieses Bild transportiert berufliche Mythen. Eine Altenpflegefachperson, sollte Empathie haben, ihre Arbeit gern machen, ggf. aufopferungsbereit und verständnisvoll sein sowie in heiklen Situationen professionell reagieren können.
Auf Seite 75 gibt ein Bild Einblicke in den Alltag auf einer Pflegestation. Ein Krankenpfleger schiebt ein Pflegebett über den Korridor. Zwei Frauen kommen den Bildbetrachtenden sich unterhaltend entgegen. Die transmittierte Botschaft kann in der Abwesenheit von Stress, aber auch in Kollegialität; im Austausch mit involvierten Fachpersonen, ggf. der Ärztin, in Sorge um das Patientenwohl gedeutet werden. In gewisser Hinsicht ist hier ein Gehen in eher gemächlichem Schritt abgebildet. Ganz im Hintergrund sitzt eine ältere Dame in einem Rollstuhl. Ihr wendet sich, fast völlig durch das entgegenkommende Personal verdeckt, ein Mann mit ihr sprechend zu. Es ist nicht erkennbar, ob es sich um einen Besucher oder einen Arzt handelt. Der Begleittext beschreibt professionelles Handeln in der letzten Lebensphase, was auch bedeuten mag zur Wahrung wertfreien und objektiven Handelns die Versorgung einzelner Patienten an andere Mitarbeitende abzugeben.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A13: Berga 2014, 75 Copyright © Westermann Gruppe
Ein Bild das Ruhe ausstrahlt und dennoch nachdenklich stimmt. Bemerkenswerter Weise ist hier eine männliche Pflegefachkraft abgebildet. Der Text beschrieb die Pflege eines männlichen Patienten. Die transportierte Information: Auch in einer von Frauen dominierten Berufsrichtung gibt es zunehmend männliche Mitarbeitende.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A14: Berga 2014, 75 Copyright © Westermann Gruppe
Auf derselben Seite ist ein sehr kleines Bild zu sehen. Den Rahmen bildet erneut ein Gang auf einer Bettenstation. Zwei weibliche Fachkräfte schieben in blauen Anzügen ein Bett in Blickrichtung. Ist das Bett leer oder könnte jemand darauf liegen? Warum bewegen zwei Personen in Anbetracht des oft beklagten Fachkräftemangels das Bett? Diese Fragen müssen unbeantwortet bleiben. Dieses Bild erscheint entpersönlicht. Es geht allein um den Prozess des Transportes des Bettes. Die Farbgebung ist durch einen Farbfilter verändert, sodass nur kalte Farben zu Geltung kommen. Auch Arbeit mit Menschen kann eintönig sein; es kann emotionale Kraft kosten, sie dennoch zuverlässig auszuführen. Der Boden glänzt. Hygiene ist eine Grundvoraussetzung für Genesung und Gesundheit. Der Glanz erscheint in der speziellen Bildkomposition etwas anderes ausdrücken zu wollen. Die hüfthohe Perspektivwahl und das Weitwinkelobjektiv in dem engen Raum, lassen den Glanz des Bodens eher als Spiegelung wahrnehmen. Die abgewandten, sich entfernenden Personen rufen ein Gefühl des Schwimmens oder besser: Schwebens hervor. Fühlen sich mitunter Pflegefachkräfte im Arbeitsalltag so, wie nachdenklich werdende Betrachtende aufgrund der Bildwirkung? Ist institutionalisierte Pflege tatsächlich entpersönlicht? Sind die Gesichter, an beiden Enden des Bettes beliebig austauschbar? Wohin gehen sie als Individuen? Ein Detail regt hier zum Nachdenken an: Das Bild lässt vermuten, dass die hinten am Bett gehende und somit den Betrachtenden nähere Person dieselbe ist, wie die Schwester auf dem drei Seiten weiter erscheinendem und ausführlich besprochenem Leitbild. Sollte der Aspekt des Wiedererkennens beabsichtigt sein, dann ist bezeichnend, dass die Person hier Altenpflegerin beim Bettentransport ist, da jedoch Gesundheits- und Krankenpflegerin bei einer Visite. Die abgebildete Frau schlüpft demnach zum Zwecke der Buchillustration in beide Rollen. Dies könnte einen Zirkelschluss darstellen, denn noch vor 80 Jahren gab es eine solche Differenzierung in der Ausbildung nicht. Darüber hinaus kann damit vollständig ausgeschlossen werden, dass ersteres Bild in einer Hausarztpraxis aufgenommen wurde. Aber es könnte auch bedeuten, dass eine Ausbildung zur Altenpflegerin ein Sprungbrett, eine persönliche Chance auf dem Weg zur Krankenschwester sein kann.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A15: Berga 2014, 22 Copyright © Westermann Gruppe
Auf Seite 22 findet sich erneut ein Kontrastbild. Die Krankenschwester ist allein und bildmittig der Kamera gegenüberstehend abgebildet. Ein erster Eindruck vermittelt das Gefühl, dass es sich hierbei um eine Ärztin handelt. Jedoch ist diese Vorstellung im Rahmen des schriftlichen Kontextes zu verwerfen. Spätestens auf Seite 84 ist der kritischen Leserschaft klar geworden, dass Pflegefachkräfte durchaus mit einem Stethoskop am Hals abgebildet werden können. Dieses arzttypische Utensil und der sichere, durchdringende Blick, lässt keinen Zweifel daran, dass Krankenpflegefachkräfte kompetent und medizinisch versiert sein müssen. Es gibt Entscheidungen, die allein sie zu tragen haben. Jedoch lässt das auf Brusthöhe gehaltene Schreibbrett unschwer erkennen, dass Professionalität das sorgfältige Führen umfassender Aufzeichnungen fordert. Der übermittelte Gedanke erhebt die Pflegefachkraft von der Assistenz zur souverän handelnden Person. Das Bild weist einige bemerkenswerte Details auf. Die Kleidung besteht aus einem formalen weißen Kittel, der sich optisch mit dem Stethoskop ergänzt. Jedoch sind Hose und Bluse individuell gewählt. Individualität wird auch durch den offen getragenen Kittel (der damit eher den Eindruck eines notwendigerweise unverzichtbar zu tragenden Kleidungselementes hinterlässt) vermittelt. Der neutrale Blick direkt in die Kamera und die Perspektivwahl (etwas unterhalb der Brusthöhe) kombiniert mit dem leicht (fast unbemerkbar) abwärts gerichteten Kopf suggeriert die Interaktion der Akteurin mit der Leserschaft. Das auf den Korridor einstrahlende Sonnenlicht konstruiert eine freundliche Atmosphäre. Betrachtende können durchaus zu dem Schluss kommen, dass die Krankenschwester angesichts vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten mit ihnen die Frage besprechen möchte, wie es nach erfolgreicher Ausbildung weitergehen solle. Das Bild ist eine indirekte, aber deutlich ausgesprochene Einladung zum Nachdenken über die berufliche Zukunft und besitzt klar identitätsstiftenden Charakter.
Bei der Suche nach dem maximalen Kontrast sticht ein Bild besonders hervor, auf das nun nähereingegangen werden soll. Als einziges Foto erscheint es zweimal - großformatig auf dem Titelcover und dann erneut auf Seite 90. Es öffnet den Betrachtenden den Blick in die eigene Identität und ruft diese Identität am Ende der Überlegungen erneut wach.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A16: Berga 2014, 90 Copyright © Westermann Gruppe
Die Bildunterschrift auf Seite 90 „Die Pflegekammer soll die berufliche Qualifikation und die Qualität der Arbeit kontrollieren“, erscheint eher informativ, als bilderklärend. Vielmehr wird auch hier ein Mythos projiziert. Die Herausgeberschaft empfand das Bild für die Publikation so zentral, dass es als Coverbild erscheint. Zum genaueren Hinschauen veranlasst die ca.-15-Grad-Verdrehung nach links. Das irritiert zunächst und die Beobachter vermuten, dass der Rollstuhl nach hinten kippt. Nach einer Weile lässt sich jedoch am Fensterausschnitt erkennen, dass dies ein optisches Mittel ist. Eine Lesart wäre, dass die Tätigkeit der Altenpflege durchaus „verrückte“ Situationen mit sich bringen mag. Doch in jedem Fall haben es Patient und Pfleger gut miteinander. Das Lächeln wirkt authentisch und, obwohl der Patient den Betrachtenden abgewandt ist, ist sein Lächeln deutlich wahrnehmbar. Das Bild erzeugt eine vertraute Atmosphäre. Im unscharf abgebildeten Hintergrund ist ein grüner Garten in vollem Sonnenschein abgebildet. Dies ist jedoch nur der Rahmen für das Wohlbefinden. Die tatsächliche Freude entsteht auf der Grundlage zwischenmenschlicher Beziehung – so könnte die Lesart lauten. Auffallend ist, dass auch das Haar des Patienten sonnenbeschienen ist, mehr noch als es beim Gesicht des Pflegers der Fall ist. Dennoch ist dieser der Protagonist, der den Tag sonnig erscheinen lässt. Er überzeugt durch sein Strahlen. Arbeit ist nicht wirklich erkennbar, die Interaktion ist ein gegenseitiges Vergnügen. Der Patient fühlt sich geborgen und verstanden, der Pflegende fühlt sich in seiner Rolle wohl. Er durchlebt auf dem Bild alles andere als eine Identitätskrise, ganz im Gegenteil - dem Titel entsprechend - hat er berufliches Selbstverständnis erlangt. Bildbetrachtenden kommt es bei der Szene wohl kaum die Frage in den Sinn, warum der junge, intelligent wirkende Mann seine Laufbahn in der Altenbetreuung gewählt hat. Erneut lässt sich der Mythos hautnah erleben: Als Pflegefachkraft braucht es neben Empathie auch ein gehöriges Maß Idealismus. Ein weiteres Faktum brennt sich bei den Betrachtenden in die Wahrnehmung: Längst ist die Zeit vorbei, zu der Beruf der Krankenpflege ausschließlich Domäne von Frauen war, einer Zeit, als es für Frauen galt Verwundete aus Kriegen zu pflegen. Pflege galt zu jeden Zeitphasen als heroische weibliche Leistung. Pflege ist auch keine Tätigkeit nur für Zivildienstleistende und für schwer auf dem Arbeitsmarkt integrierbare Zuwanderer mehr. Die zunehmende Lebenserwartung stellt die Gesamtgesellschaft zwar vor Herausforderungen, jedoch vermittelt das Foto die Botschaft, dass es sich bei der Betreuung Bedürftiger um eine lohnende, sinnstiftende Aufgabe handelt, die nicht durch Digitalisierung und Institutionalisierung zu ersetzen ist. Pflege ist inzwischen zu einer edlen Stufe von Beruflichkeit herangereift, da sie altruistische Züge in sich trägt. Diesen Aspekt kommuniziert das Foto. Denn nicht immer ist die Krankenpflege so beschwingt wie es das Foto zelebriert. Eine an einem sonnigen Nachmittag nahezu vergnügt „tanzende“ (ggf. eine mögliche Lesart bei Berücksichtigung des beschwingt samt Rollstuhl nach links gekippten Fotos) Patient-Betreuer-Konstellation gewinnt dem allzu oft gering bezahlten Beruf die wonnigsten Momente ab. Nur selten ist die berufliche Betreuung Betagter erste Wahl bei Menschen, die persönliche Qualitäten und Voraussetzungen dafür haben. Insofern ist das Bild besonders, wenn seine Stellung als Titelbild berücksichtigt wird, ein Werbefoto, mit dem regional aufgewachsene, junge Männer mit besten Fähigkeiten für eine Karriere im Pflegebereich angesprochen werden. Diese Lesart wird auch dadurch bekräftigt, dass es weniger ein erklärendes Bild ist, welches im Text verankerte Sachverhalte visuell unterstützt bzw. zur Besprechung einlädt.
Globalcharakteristik und Zusammenschau der untersuchungsrelevanten Beobachtungen
Das Lernheft „Kompetente Pflege, Lernbereich 4, Pflege als Beruf – berufliches Selbstverständnis entwickeln“ vom Bildungsverlag EINS aus dem Jahre 2014 bildet auf 46 Fotografien Pflegefachkräfte ab. Zur Objektivierung des Gesamteindrucks der Untersuchung wurden neben einem besonders markanten Bild fünf weitere betrachtet. Wenngleich in der Mehrheit der Fälle Frauen als Krankenpflegerinnen auf den Fotos präsent sind, werden in der Publikation auch Männer abgebildet. Diese Beobachtung spiegelt sich auch im neutral gehaltenen Titel der Publikation – die Autoren geben zu verstehen, dass es nicht um Geschlechterzuschreibungen geht, sondern um „Pflege als Beruf“. Dennoch offenbaren die Bildkonstellationen latente Sinnunterschiede. Auf Seite 75 schieben zwei Frauen gemeinsam ein Krankenbett den Flur entlang, während dieselbe Seite auf einem weiteren Bild kommuniziert wird, dass dies eine männliche Pflegefachkraft auch allein zu bewältigen vermag. Eine ähnliche Botschaft vermitteln die Fotografien in Verbindung mit der Seniorenbetreuung. Das Bild auf Seite 78 zeigt eine Pflegefachfrau beim Dominospiel mit einem älteren Herrn, die von ihm aufgestellten Spielsteine könnten andeuten, dass er dement ist, jedoch erscheint er körperlich rüstig, Auf Seite 90 findet sich dann eine Fotografie von einem Krankenpfleger, der einem im Rollstuhl sitzendem Manne Gesellschaft leistet. Beide Bilder im Vergleich deuten darauf hin, dass weibliche Sensibilität und Einfühlungsvermögen im Umgang mit dementen Personen vorteilhaft ist - physische Kraft, ein Symbol der Männlichkeit, hingegen ist beim Transfer körperlich beeinträchtigter Personen erforderlich. Werden die Gesichtsausdrücke der abgebildeten Fachpersonen gelesen, so vermitteln sie auf den Fotografien, welche Betreuungsleistungen darstellen, keineswegs nur einen positiven Eindruck, sondern sind regelrecht vor Freude strahlend. Sowohl der Krankenpfleger als auch seine Kollegin erscheinen nahbar und zugänglich. Beide scheinen in ihrer beruflichen Rolle völlig aufzugehen und damit einen Beruf gefunden zu haben, der auch ihrer persönlichen Identität entspricht. Die drei Fotografen, auf denen das Personal auf dem Gang einer Station abbilden vermitteln hier ein anderes Bild. Der Gesichtsausdruck der Krankenschwester auf der Fotografie von Seite 22 ist schwer zu deuten. Sie macht einen eher konzentriert-überlegten Eindruck. Der Blick ist weniger streng, doch strahlt er Entschlossenheit und Sicherheit aus. Die Bildkomposition, ihre Kleidung und die gehaltenen Utensilien, lassen die Betrachtenden leicht zu dem Schluss kommen, es könnte sich um eine Ärztin handeln. Deutlich werden dabei die Aufstiegsmöglichkeiten in der Gesundheitsbranche, für jene die sich verantwortungsvoll und zuverlässig einbringen. Gänzlich anders sind die Bilder auf Seite 75. Lange Korridore bestimmen das Bild, die Gesichter der Akteure sind von den Betrachtenden abgewandt. Pflegebetten werden durch die Stationen geschoben. Die Fotografien stimmen nachdenklich. Es ist ein Kommen und Gehen inmitten der Anonymität. Patient*innen kommen zu einer Institution, nicht zu einzelnen Mitarbeitenden. Leere Betten rufen die Frage an das Danach wach. Nicht alle verlassen Krankenhäuser und insbesondere Pflegeeinrichtungen in genesenem Zustand. Dies ist anderer Teil einer identitätsprägenden Realität, mit der sich Pflegefachkräfte täglich auseinanderzusetzen haben. Das umfangreich analysierte Bild auf Seite 78 bleibt in vielerlei Hinsicht neutral. Es ist reich an Strukturen, die zum Nachdenken einladen. Ebenso abwechslungsreich wie verantwortungsvoll ist die Tätigkeit als Arzthelfer*in. Das Bild drückt bei klar geregelten Hierarchie- und Ablaufstrukturen sinnstiftende Kurzweiligkeit in einem festen Umfeld aus. Vermutlich ist es das, was das Betrachten des Bildes zu einem Erlebnis werden lässt.
Bildanalyse 4: Montage elektrischer Licht- und Kraftanlagen 1903
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A17: Pohl 1903, 14
Quelle: Die Montage elektrischer Licht- und Kraftanlagen - Ein Taschenbuch für Elektromonteure, Installateure und Besitzer elektrischer Anlagen, Pohl, H., Verlag von Gebrüder Jänecke, Hannover 1903, S. 14; (Lehrbuch 272 Seiten; 328 Abbildungen, davon sind 29 Fotografien, von denen 5 Personen darstellen)
1. Was sind die ersten Eindrücke der Interpretierenden: a) vom Kontext; b) subjektive Assoziationen?
a) Ort: vermutlich eine Industriehalle; Zeit: wahrscheinlich tagsüber; Wetter: es ist eine Innenfotografie, das Licht ist offenbar Tageslicht, welches über eine Fensterfront von links kommt; die Beleuchtung entspricht den Gegebenheiten und wurde offenbar nicht für die Fotografie angepasst.
b) Der Blick fällt zuerst auf das Rad, dessen Proportionen erst nach dem Wahrnehmen des Arbeiters rechts daneben vollständig wahrgenommen wird. Obwohl der Vordergrund reichlich herumliegendes Material aufweist sowie ein gewaltiges Rohrende zu sehen ist, wechselt der Blick nach der Betrachtung des Arbeiters erneut zum Rad und seinen Strukturen auf der den Betrachtenden zugewandten Seite.
2. Was empfinden Interpretierende, wenn sie die Personen auf dem Bild nachstellen (Körperlichkeit)?
Ein Nachstellungsversuch verspricht bei dem Foto wenig Erkenntnis, da weder die Arme, noch der Körper unterhalb der Hüftregion der Person zu sehen sind. Dennoch erscheint die Haltung natürlich und in der gegebenen Situation authentisch. Es könnte sein, dass der Arbeiter während seiner Tätigkeit gemerkt hat, dass ein Foto gemacht wurde und deshalb kurz den Blick am Rad vorbei dem oder der Fotograf*in zuwandte.
3. Was ist auf dem Bild zu sehen (Versprachlichung)? Welche Bedeutung drückt es aus (Sinngehalt)?
Versprachlichung: Auf dem Bild ist ein Arbeiter neben einem gewaltigen Rad zu erkennen. Er blickt ins Objektiv der Kamera. Der Text verweist darauf, dass es sich bei der Szene um die Montage eines größeren Drehstromgenerators handelt, dessen rotierendes Magnetgestell gerade zusammengefügt wird. Offenbar ist der Ort der Installation eine Industriehalle. Im Vordergrund ist Bauschutt erkennbar, sowie das Ende eines großen Rohres, vermutlich für Wasser.
Sinngehalt: Im Rahmen des Lehrbuches versetzt das Foto die Leserschaft an einen realen Einbauort für Generatoren. Die Größenverhältnisse werden durch das Foto erkennbar, denn generell spielt die Größe zwar für Leistungsfähigkeit und Effizienz der Anlage eine Rolle, nicht aber bei den Prinzipien des Zusammenbaus. Den fachlich Interessierten leuchtet durch das Bild ein, was unter dem Begriff „grössere Drehstehstromgeneratoren“ zu verstehen ist. Die Tatsache, dass der klein wirkende Monteur allein im Umfeld des Generators zu sehen ist, deutet auf seine große Leistung hin. Er wirkt keineswegs stolz, sondern es erscheint, dass es für ihn eine Berufung ist, das Anfügen der fehlenden Elemente zu besorgen. Dass dafür körperliche Kraft nötig ist, leuchtet beim Betrachten ein. Auch das Umfeld des Einbaus erscheint voller Gefahren: Herumliegende Baumaterialien und Schutt sind offenbar allgegenwärtig, scheinen nahezu die Arbeiten zu behindern. Der Blick des Elektromonteurs verrät jedoch keine Befremdung, keinen Unmut. Die Umstände, der mangelnde Arbeitsschutz sind für jene Zeit charakteristisch. Der transportierte Mythos: Ein Elektromonteur in der Industrie hatte schwere Arbeit unter zahlreichen Gefahren zu bewältigen. Es waren schwere Einzelkomponenten, die es zusammenzufügen galt. Oft mag er auf sich allein gestellt gewesen sein. Hierin bestand wohl auch ein gewisser Stolz. Er war direkt am Herzstück, am Rotor, dem Dreh- und Angelpunkt der sich unaufhaltsam aufblühenden Industrialisierung.
4. Gibt es etwas, das die Interpretierenden auf dem Bild erwartet hätten, was aber fehlt (Interpretation des Nicht-Vorhandenen)?
Das Bild drückt seinen Sinngehalt aus. Beim Betrachten entsteht die Frage nach den genaueren Arbeiten. Welche Werkzeuge wurden beim Zusammensetzen verwendet, was macht der Monteur im Moment genau? Die Fragen müssen ungeklärt bleiben, da der Aktionsraum des Arbeiters vom Magnetgestell verdeckt bleibt. Eine weitere Erwartung der Leserschaft könnte in einem engeren Bezug zur Elektrizität bestehen. Die Fotografie erzeugt die Assoziation zu schwerer Schlosserarbeit. Der erste Gedanke an „Die Montage elektrischer Licht- und Kraftarbeiten“, lässt den Wunsch nach spürbarer Nähe zum elektrischen Strom – etwa in Form sichtbarer Kabel oder Verdrahtungen – unbefriedigt.
5. Wie ist das Bild aufgebaut? Was ist zentral (optische Gewichtung)?
Optisch zentral ist das noch nicht vollständig zusammengefügte rotierende Magnetgestell. Die aufgeschraubten Pole werden der Kamera zugewandt, neben dem klein erscheinenden Arbeiter präsentiert. Das Magnetgestell nimmt etwa die Hälfe der gesamten Bildfläche ein und seine klar strukturierten Helligkeitskontraste fesseln den Blick der Betrachtenden. Am linken Bildrand ist im Hintergrund erkennbar, dass es noch etwa ein Sechstel des Umfanges mit weiteren Polen zu bestücken gilt. Dort liegt offenbar der eigentliche Ort, an dem die Arbeiten ausgeführt werden. Der Arbeiter erscheint eher als Illustration für die Größe des Magnetgestells. Das Umfeld, besonders der Vordergrund mit dem Bauschutt gibt zu erkennen, dass der Generator gerade eingebaut wird (er wird also nicht repariert oder gewartet). Dennoch ist die Positionierung des Arbeiters bemerkenswert. Er nimmt etwa ein Siebentel der Gesamtbildhöhe ein, befindet sich jedoch genau in der Mitte der Gesamtbildhöhe. Wird das Foto vertikal in der Mitte geteilt, so ist der Arbeiter erneut in der Mitte der Bildbreite der rechten Bildhälfte. Dies deutet darauf hin, dass es sich kaum um einen Zufall handeln kann. In der Lesart des geometrischen Aufbaus spielt der Arbeiter eine eher zentrale Rolle.
6. Wie sehen die abgebildeten Personen aus (Gestik, Mimik, Haltung, Kleidung)? Wie ist ihr Verhältnis zueinander?
a) Wie möchten sich die Personen möglicherweise darstellen (subjektiv- intentional)?
Der abgebildete Monteur macht den Eindruck, er sei am Arbeitsplatz und erst am selben Morgen hat er erfahren, dass er neben dem Magnetgestell posieren soll. Seine Kleidung ist für die Arbeit typisch. Soweit erkennbar trägt er eine grobe, dickere Arbeitsjacke und eine Kopfbedeckung – vermutlich eine Baskenmütze. Dadurch entsteht der Eindruck, dass es am Arbeitsort kühl ist. Sein Blick verrät keinerlei Bezüge zur fotografierenden Person. Offensichtlich ist er kein Modell, sondern die Person, womöglich die Einzige, die zum Zeitpunkt der Aufnahme am Gestell arbeitete. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass er aufgefordert wurde sich kurz danebenzustellen, bzw. kurz bei der Arbeit in Richtung Kamera zu sehen. Für eine speziell gestellte Aufnahme, wäre es optisch vorteilhafter gewesen seinen ganzen Körper abzubilden. Da das Buch eine ganze Reihe Technikabbildungen ohne Personen aufweist, könnte in einer weiteren Lesart davon ausgegangen werden, dass der Arbeiter zur besseren Veranschaulichung und Bereicherung der Fotografie mit einbezogen wurde.
b) Wie stellen sie sich faktisch für die Interpretierenden dar (objektiv-latent)?
Der Gesichtsausdruck des Arbeiters kann als eher scheu gelesen werden. Zur damaligen Zeit war Fotografie zwar bekannt, jedoch nicht allgegenwärtig. Die Zurückhaltung mag auch darin begründet liegen, dass der Monteur versteht, dass der Fokus der Fotografie auf dem Magnetgestell liegen soll.
In welchem Verhältnis stehen diese beiden Sinnebenen zueinander? Kann davon ausgegangen werden, dass der Monteur als illustratives Beiwerk das Bild bereichern soll, dann entsprechen subjektiv-intentionale und objektiv-latente Sinnebene einander gut.
7. Welche (sozio-kulturellen und historischen) Kontextinformationen können die Interpretierenden nutzen (Erweiterung möglicher Lesarten)?
Aufgrund des relativ großen Aufwandes beim Anfertigen von Fotografien Anfang des 20. Jahrhunderts ist wohl auszuschließen, dass es sich um einen Schnappschuss handelt. Wird davon ausgegangen, dass die Publikation zu Lehrzwecken erstellt wurde, dann dienten die Fotografien neben den zahlreichen Zeichnungen (teils mit Maßangaben), nicht nur dazu, technische Gegebenheiten zu visualisieren. Die abgebildeten Personen transportieren auch berufliche Mythen. Inwieweit eine Intention seitens der Autorenschaft dabei vorliegt, lässt sich nur sehr schwer beurteilen, denn auch auf den weiter unten beschriebenen Fotografien nehmen die abgebildeten Menschen nur eine kleine Bildfläche ein.
Der Text bietet auch einige Informationen zum Verständnis des Bildes. Es ist ein Buch, welches ein breites Spektrum elektrotechnischen Wissens, inklusive einer Beschreibung relevanter Handlungsvorschriften vermittelt. Einige Stichworte sind Akkumulatoren, Umformer, Messinstrumente, Schalttafeln, Leitungen, Kabel, Sicherungen, Motore, Beleuchtung, Bergwerkselektrotechnik, Besonderheiten in gefährdeten Räumen. Der Abschnitt über den Antrieb von Dynamomaschinen ist der erste des Buches. Das Bild illustriert den Zusammenbau eines solchen Stromerzeugers aufgrund seiner Größe an Ort und Stelle. Solche Drehstromgeneratoren fanden zu jener Zeit in der Industrie zur Stromerzeugung ihre Anwendung. Zum Antrieb der Generatoren wurden „alles die Maschinen verwendet, welche auch sonst zum Antrieb von Arbeitsmaschinen Verwendung finden, wie Dampf- und Gasmaschinen, zu denen auch die häufig verwendeten Petroleum- und Benzinmotoren gehören, und hydraulische Motoren“ (S.1). Es kamen jedoch auch Turbinen zum Einsatz (S.15). Mit diesem Texthinweis ist es wahrscheinlicher, dass es sich nicht um ein Kraftwerk für die Speisung des öffentlichen Netzes handelt, sondern um einen Generator, der Strom für Maschinen liefern soll, die auf den Betrieb mit Elektroenergie angewiesen sind. Das Foto wurde demnach in einer Industriehalle aufgenommen. Damit ist es auch weniger wahrscheinlich, dass das im Vordergrund sichtbare Rohr mit einer Turbine in Verbindung steht.
8. Falls es mehrere konkurrierende Interpretationen (zum Gesamtbild oder zu einem Detail) gibt: Welche erscheint am wahrscheinlichsten? Warum?
Nach Einbezug der Kontextinformationen erscheint es als gesichert, dass die Abbildung dazu dient, den Zusammenbau eines Drehstromgeneratoren für eine Industrieanlage zu visualisieren: das Bild befindet sich im Abschnitt unter der Überschrift „Die Montage von Dynamomaschinen“ auf S. 14 als Illustration einer solchen Installation.
Dennoch hat die Rolle des abgebildeten Monteurs nicht allein eine erklärende Funktion, denn seine Arbeit ist nicht unmittelbar sichtbar. Er steht in direktem Kontext zum Gestell und ist offenbar mit der Montage der Pole beschäftigt, diese sind jedoch noch auf der gegenüberliegenden Seite fehlend. Somit fesselt der Monteur die Gedanken der Bildbetrachtenden. Einerseits werden die Größenverhältnisse durch seine Anwesenheit deutlich. Andererseits belebt seine Anwesenheit das Bild. Zusätzlich werden Vorstellungen zur beruflichen Identität von Elektromonteuren jener Zeit vermittelt. Es war die erste Welle der Industrialisierung, welche die Produktion des Grundlagenbereichs ergriff. Einst schwere körperliche Arbeit in Stahl-, Kohle- und Chemieindustrie wurden durch Maschinen ersetzt. An die Stelle der Dampfmaschinen traten fortschrittlichere elektrobetriebene Maschinen. Das Bild versinnbildlicht etwas Heroisches. Als Monteur ist er als Vorreiter dieser Entwicklung zu sehen. Gewaltige Technik übernahm die Roller menschlicher Kraft. Durch die Installation der abgebildeten Anlage wurde der Strom als Ausgangskraft weiterer Entwicklungen bereitgestellt. Dass dieser Schritt epochal ist und riesige Auswirkungen haben würde, veranschaulichen die auf dem Bild dargestellten Größenverhältnisse. Mit dieser Lesart wird der sachliche Blick des Monteurs verständlicher. Ein kleiner Mensch neben schwerer Technik. Als Mann an vorderster Front in einer Zeit gewaltiger industrieller Umbrüche kennzeichnen seine Züge kein Erstaunen, denn für ihn ist Elektrizität nicht Zauberwerk. Der leicht gekrümmte Rücken deutet die schwere Arbeit für Monteure in der Industrie an. Heute kaum vorstellbar, waren Elektromonteure vor über 100 Jahren fast immer männlich. Unbewusst stellen sich die Betrachtenden die Frage, welches Gewicht die zu montierenden Pole haben mögen und ob noch Helfer zur Hand gehen mögen. Doch abgebildet ist er allein. Mit seiner Tätigkeit ist wohl ein gewisser Ruhm zu einer Zeit verbunden, in der viele Arbeiter noch ungelernt sind.
9. Mit welcher Technik wurde das Bild aufgenommen (Weitwinkel, Tele, Perspektive, Ausschnitt, Licht)?
Das Schwarz-Weiß-Foto wurde offenbar bei natürlich im Raum vorgefundenem Licht gemacht – nichts deutet auf die Verwendung von Blitzlicht oder zusätzlicher Beleuchtung hin. Der Gesamteindruck des Fotos bleibt eher düster. Dies liegt nicht daran, dass es auf dem Bild keine hellen Stellen gäbe, diese sind nur wenige in der offenbar dunklen Industriehalle (ein Indiz für das korrekt hergestellte Foto). Den Größenverhältnissen nach zu urteilen, wurde offenbar ein Normalobjektiv aus ca. 15 m Entfernung zum Objekt verwendet. Die Wahl des Ausschnitts erfasst in den oberen zwei Dritteln das Magnetgestell auf der gesamten Bildbreite. Wäre dieses auch im unteren Teil sichtbar, so würde es den Bildausschnitt vollständig ausfüllen. Damit ergibt sich durch den Bildausschnitt eine anschauliche Vorstellung von der Größe des ganzen Gestells, andererseits auch von den Einbaubedingungen, die durch das Abbilden des Vordergrunds ersichtlich werden.
10. Um nichts zu übersehen, sollte man abschließend durchaus systematisch analysieren: von oben nach unten, von links nach rechts!
Ein Detail gibt Anlass zum Nachdenken. Im Hintergrund ist keine Mauer zu erkennen, sondern eine bildfüllende Plane bzw. ein Stoffvorhang. Der Zweck dieser Rückwand ist nicht erkennbar. Hier könnte sich eine weitere Lesart ergeben. Es ist durchaus denkbar, dass es sich um eine große Zeltkonstruktion handelt unter der die Arbeiten verrichtet werden. Der Bauschutt im Vordergrund unterstützt den Gedanken, dass die Montage des Magnetgestells zeitgleich mit dem Bau der Halle stattfindet. So könnte die Wand einer bereits bestehenden Halle herausgerissen worden sein, um die Bestandteile des großen Generators in die Halle zu transportieren - oder die Arbeiten sollen sehr schnell vorangehen, weshalb zeitgleich gearbeitet wird.
11. Bild eines maximalen Kontrastes in der Publikation
Im Lehrbuch wurden 29 Fotografien zur Verbildlichung elektrischer Anlagen verwendet. 5 dieser Fotos bilden auch Personen ab. Die markanten Merkmale der bislang noch nicht besprochenen Fotos sollen nun näher beschrieben werden. Begonnen werden soll mit dem Foto auf Seite 10 desselben Abschnitts im Buch. Erneut ist die Montage einer Dynamoanlage abgebildet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A18: Pohl 1903, 10
Mit Verweis auf das Foto wird im Text erklärt: „Der Beginn der Montagen grösserer Dynamomaschinen, welche mit der Betriebsmaschine direkt gekuppelt werden, kann in der Regel erst dann erfolgen, wenn die Aufstellung der Antriebsmaschine soweit fortgeschritten ist, dass die Grundplatten fertig verlegt und vergossen und die Wellen ausgerichtet sind“ (S. 7). Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieses Bild früher (vor Anbau des Magnetgestells) aufgenommen wurde und dieselbe Anlage abbildet. Ein Indiz dafür ist die ebenfalls im Hintergrund sichtbare Textilwand. Das Magnetgestell würde in diesem Falle das Zentrum des Bildes – das rechte Ende der gut sichtbaren Welle – einnehmen. Das Bild zeigt 4 Personen. Da diese jedoch - ihrer Kleidung nach zu urteilen - keine Elektroinstallateure sind, verliert das Foto im Rahmen der Analyse an Relevanz und sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Die beiden Personen unten rechts im Bild tragen schwarze Anzüge, Gehstöcke sowie Zylinder bzw. Melone und könnten Geschäftsleitung oder Besitzer der Industrieanlage sein. Der Anzug des Mannes in der unteren Mitte des Bildes ist ebenfalls dunkel, jedoch nicht schwarz. Es ist denkbar, dass es sich um einen leitenden Angestellten handelt, möglicherweise einen Ingenieur, der als Einziger mitten in der Anlage steht. Ganz links am Rand steht ein weiterer Mann in schwarzer, offizieller Kleidung, auch er könnte zur Unternehmensleitung gehören. Der Hintergrund erfasst einen Hallenkran. Das Bild vermittelt den Eindruck der Repräsentation des Stolzes eines bereits viele Jahre erfolgreichen Unternehmens. Dargestellt wird nicht der Mensch – sondern der Einzug industrieller Innovationen. Der Mensch erscheint machtlos. Fast wie eine Spielzeugfigur - Teil des Ganzen, doch nicht in der Lage, den bereits in Gang gesetzten Prozess stoppen zu können.
Das Bild auf Seite 16 erscheint für die Beantwortung der Frage nach beruflicher Identität relevanter. Es nimmt auf der gegenüberliegenden Seite des neuen Abschnitts „Dynamomaschinen.“ eine gesamte Seitenfläche ein.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A19: Pohl 1903, 16
Auf Seite 15 wird auf das Bild im Text Bezug genommen: „Nachdem die ausgerichtete Welle in ihre Lage gebracht, wird die zweite Hälfte des Magnetgestells aufgesetzt und beide Teile zusammengeschraubt, wobei beide Teile sorgfältig gestützt werden müssen. Hierauf werden die Pole aufgeschraubt (Fig. 11)“. Das Bild visualisiert dieselbe Arbeit, wie das Bild auf Seite 14, jedoch ist ein anderer Generator abgebildet. Das Bild offenbart einige Einblicke mehr in die Tätigkeit der Elektromonteure. Die Pole sind bei dieser Anlage kleiner, als bei der ersten. Auf dem Bild sind zwei Monteure zu erkennen, die Hilfswerkzeuge verwenden. Offenbar wurden die Pole bis zum Verschrauben durch das oben im Bild sichtbare Kantholz vor dem Verrutschen gesichert, was eine große Kraftersparnis ist. Ein Arbeiter hält einen Hammer an der Schulter. Diese Haltung ist nicht arbeitstypisch. Es wirkt eher so, als posiere der Arbeiter. Dennoch schaut keiner der beiden Personen in die Kamera. Der Blick beider ist auf einen gemeinsamen, vor ihnen liegenden Punkt liegenden Punkt gerichtet. Jeder schaut aus seiner Perspektive betrachtet genau nach vorn unten, als wolle er den nächsten Schritt verfolgen. Welches ringförmige Bauteil oder Werkzeug der seitlich stehende Arbeiter in der Hand hat, kann nicht definiert werden. Es könnte durchaus ein gerolltes Kabel sein. Der Gesamteindruck des Bildes unterscheidet sich erheblich von dem des zuerst betrachteten, denn der Bildhintergrund ist einfach hell – ohne erkennbaren Kontext. Fast scheint das Bild aus dem Umfeld geschnitten, indem alles Störende entfernt wurde. Auch der Vordergrund ist wohlgeordnet. Kabeltrommeln oder Spulen stehen sorgfältig aufgereiht vor der Achse des Magnetgestells, nichts Herumliegendes ist erkennbar. Der Blick fällt einzig auf das Magnetgestell, das bildfüllend und vollständig abgebildet ist. Die Arbeiter stehen unscheinbar posierend vor den bereits angebrachten Polen. Durch den helleren Hintergrund ist das Bild weniger düster; der abwärts geneigte Blick beider erscheint weniger heroisch oder entschlossen, vielmehr nachdenklich. Übermenschlich und perfekt geformt steht das Magnetgestell beherrschend über beiden. Auch in diesem Foto spiegeln sich berufliche Mythen: Macht und Ohnmacht als Ambivalenzen eines ungewissen und doch unaufhaltsamen Fortschritts. Die Konstellation Mensch-Technik in einer Zeit industrieller Umbrüche stimmte sicher besonders jene nachdenklich, die an vorderster Front – Pionieren jener Zeit gleich - den Weg für weitere Innovationen ebneten.
Das Bild auf Seite 51 hat einen gänzlich anderen Charakter.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A20: Pohl 1903, 51
Der Text zum Bild erklärt, dass auf dem Foto ein „Westinghouse-Drehumformer in einer Unterstation in Glasgow“ (S. 49) abgebildet wurde. Der Kontext des Buches beinhaltet die zum Verständnis der Anlage relevanten Schaltpläne und Grafiken. Folglich hat die Fotografie einen illustrativen, auflockernden oder veranschaulichenden Charakter. Die Anlage wird realitätsnäher, greifbarer. Der Drehumformer ist bereits vollständig installiert und in Betrieb genommen. Auffallend sind Größenverhältnisse und Perspektive. Genau in der Flucht der Schalthebel steht der Bedienende, zweifelsohne ein Elektrofachspezialist und blickt genau ins Objektiv. Damit ist er Protagonist der Szene. Der Umformer ist längst fotografiert, damit fällt seine riesige Länge weniger ins Auge und erscheint auf ein Minimum seiner Größe reduziert. Der betrachtende Blick korrespondiert vielmehr mit dem Blick des Elektrikers von dessen Gesicht alles andere auseinanderzulaufen scheint. Dem Umformer den Rücken zugewandt, als schenke er seiner Größe keine Beachtung steht er bereit entsprechend den Anzeigen die Hebel in Gang zu setzen, welche er mag. Ein Heft (vermutlich mit Daten) gibt ihm Sicherheit. Sowohl die Hebel, als auch die Anzeigeuhren scheinen sich seiner Gegenwart unterzuordnen. Er allein beherrscht die Szene, daran besteht kaum Zweifel. Die Konstellation wirkt perfekt inszeniert. Die Kleidung des Angestellten unterstreicht dessen Souveränität. Die schicke Weste auf weißem Hemd, der weiße Schal, sie wirken, als sei er virtuoser Künstler inmitten eines mächtigen Ensembles. Seine Körperstatur ist kräftig, vielleicht gar etwas wohlgenährt. Das Schuhwerk ist, soweit erkennbar elegant - schwere Arbeit mag kein Bestandteil seiner Tätigkeit zu sein. Wer möchte nicht an Stelle der abgebildeten Person sein? Damit entsteht im Kontext des Buches der Eindruck des „angekommenen“ Elektromonteurs. Keine dunkelgraue Fabrikhalle, keine derbe verschmutzte Kleidung, kein herumliegender Bauschutt – nur ein sauberer, lichtdurchfluteter Innenraum, der den Auserwählten dazu ermächtigt, feingekleidet und exklusiv die Regie gemäß Drehbuch über die Schalthebel zu übernehmen. Auch dies ein Mythos, der wohl durch das Bild des „Westinghouse-Drehumformers“ auf überwältigende Weise transportiert wird.
Das letzte Foto mit einer Person im Buch findet sich auf Seite 70.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A21: Pohl 1903, 70
Zum besseren Verständnis, worum es sich dabei handelt, sei das Bild der Vorderseite der Anlage von S. 69 hinzugefügt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A22: Pohl 1903, 69
Abgebildet ist „die Hauptschalttafel der von Siemens & Halske erbauten Zentrale in Mexiko“ (S. 68). Einleitend wird ihr Zweck erklärt: „Die von Stromerzeugern gelieferte elektrische Energie wird zu Schalttafeln geleitet, von denen aus die Stromverteilung und die Bedienung der Dynamos sowie der ganzen Anlage stattfindet. […] Die Uebersichtlichkeit und gute Ausführung der Schalttafeln trägt sehr wesentlich zum guten Betrieb und zur leichten Bedienbarkeit einer Anlage bei.“ (S. 64). Der Kontrast könnte ernüchternder kaum sein: Die Vorderseite repräsentativ und künstlerisch gestaltet, ist der Raum dahinter zwar geordnet und übersichtlich aber auch düster und nüchtern sachlich. Werden beide Bilder als eine Gesamtkomposition verstanden kommen erneut die Ambivalenzen im Arbeitsleben des Elektromonteurs ans Licht. Da ist die Seite, in der sich sein Beruf idealisiert erhaben darstellt. Er ist der würdevolle Dirigent einer mächtigen Schalttafel, dessen Funktionsweisen andere außer seiner Kollegen kaum je zu verstehen vermögen. Die Kehrseite ist zwar geordnet, wohlstrukturiert, jedoch auch gleichförmig, denn ein Abweichen von den Gesetzen der Elektrizität würde ihn seiner Berufung untauglich machen. Er steht ganz am Rande des Bildes auf all die Verkabelungen und Isolatoren schauend. Nach Installation der Schaltanlage wird sein Weg nur zu Wartungsarbeiten und in Störfällen noch hinter die Fassade führen. Tatsächlich macht aber genau der Weg hierhinter seine Profession aus. Im Laufe der Zeit wird es im Rahmen beruflicher Differenzierung zunehmend Bediener geben, die sich auf der Sonnenseite der Anlage bewegen, es kaum jedoch hinter die Kulissen zu wagen vermögen, denn hier ist allein das Reich des Elektromonteurs, des Professionellen, der die Anlage bis in ihre kleinsten Bestandteile und Funktionsweisen kennt. Auch dieses Bild wirkt durch den Effekt der Perspektive. Die Anlage scheint vom Elektromonteur zu fliehen, von ihm getrieben zu werden (im Sinne von „Antreiben“ und Bedienen). Obwohl die Anlage nahezu das ganze Bild einnimmt, ist der betrachtende Blick allein auf den, obwohl klein im dunkelsten Teil des Bildes stehenden, Monteur gebannt. Das Bild macht Appetit auf eine Lehre, erzeugt Spannung und beflügelt die Lernenden sich den Herausforderungen des für die Ahnungslosen gefährlichen elektrischen Stromes zu stellen, ja ihn zu beherrschen.
Globalcharakteristik und Zusammenschau der untersuchungsrelevanten Beobachtungen
Die fünf Fotografien des Lehrbuches „Die Montage elektrischer Licht- und Kraftanlagen“ von H. Pohl aus dem Jahre 1903 romantisieren die Arbeit der Fachkräfte keineswegs. Ganz im Gegenteil gewinnen die Beobachter*innen den Eindruck, dass der Zweck der Abbildung von Monteuren allein darin bestand, den Menschen als belebendes Beiwerk zur Illustration der Größenverhältnisse zu verwenden. Es sind Fotografien aus der Zeit des industriellen Aufbruchs. Elektromonteure wurden in erster Linie in der Schwer- und Grundlagenindustrie eingesetzt. Die Entwicklungen technischer Möglichkeiten im Wirtschaftswettkampf jener Zeit waren von der Nutzung des elektrischen Stromes abhängig. Es verwundert daher nicht, dass Elektromonteure auf den Bildern vor riesigen Generatoren und Umformern eher klein erscheinen. Wo es möglich war, erfassten die Fotografien vollumfänglich die Ausmaße der technischen Anlagen. Der Fokus des oder der Fotograf*in lag weniger auf der Tätigkeit der Monteure, vielmehr wurde die Technik glorifiziert. Drei der fünf untersuchten Bilder visualisieren die Installation von Industriegeneratoren, eines bildet einen Drehumformer und ein letztes die Rückseite einer Schalttafel ab. Einiges lässt sich anhand der Bilder die berufliche Identität von Elektromonteuren erfahren. Gerade die Glorifizierung der Technik ist ein identitätsprägendes Moment. Menschen die von Technik ergriffen sind, haben keine Berührungsängste mit ihr. Unbewusst kommen den Betrachtenden kleine Kinder in den Sinn, die Kosmonaut, Pilot, Lkw-Fahrer oder Kapitän werden wollen. Es ist der Wunsch groß sein zu wollen, wie die Großen sein zu wollen, der sich in den Wünschen spiegelt. Der Maßstab ruft den Wunsch hervor, etwas Besonderes zu sein. Obwohl der Mythos der Elektriker, ganz im Gegensatz zum Laien in ihrem selbstverständlichen und entschlossenen Umgang mit Elektrizität besteht, sind die abgebildeten Größenverhältnisse zentral. Das ist auch logisch, da sich Wissen und Erfahrung schwer abbilden lassen. Die Gesichter der Arbeitenden sind in keinem Falle fragend. Nie scheinen sie vor Herausforderungen oder Problemen zu stehen. Die Arbeit im industriellen Umfeld – insbesondere die Installation der Generatoren - erfordert körperliche Kraft. Es verwundert nicht, dass Männer (es finden sich keine Bilder von Elektromonteurinnen) mit derber Kleidung, in einem Falle mit einem Hammer – dem Symbol kräftigen Anpackens – abgebildet sind. Die Gesichtsausdrücke sind nüchtern und sachlich, in einem Falle nach unten geneigt, vielleicht nachdenklich. Bezeichnend ist bei der Publikation, dass in vier Fällen die Protagonisten direkten Blickkontakt mit dem oder der Fotograf*in und damit mit den Bildbetrachtenden haben. Tatsächlich scheinen sie mit den Beobachtenden interagieren zu wollen. Die Konstruktion der Bildausschnitte verstärkt den Effekt. Die fotografierten Räume sind düster, nicht durch optische Möglichkeiten der Fotografie aufgehellt. Dadurch wird der Gedanke an harte Arbeit vertieft. Das Bild vom Westinghouse-Drehumformer ist ein gewisser Kontrastpunkt diesbezüglich, nicht nur, dass der abgebildete Raum heller ist, auch ist die Kleidung des angestellten Elektrofachmanns nahezu elegant. Im Kontext zu den vorangegangenen Bildern zeigt sich eine logische Entwicklung: Der Aufbau der elektrischen Einrichtungen gleicht einem Mut erforderndem, kräftezehrendem Abenteuer, sind die Anlagen einst installiert, dann ist der Gedanke an Lärm, Ruß, Schutt und schwere Werkzeuge schnell verflogen. Elektrotechnik galt offenbar bereits 1903 als saubere, zukunftsweisende Alternative. Die Reihenfolge der Fotografien im Buch folgt der Logik: von der Erzeugung der Energie über die Umformung hin zur Verteilung an die Endverbraucher. Auch hierin zeigt sich, dass sich Elektriker rein mathematisch nachvollziehbarer Genauigkeit und keinen eigenen Gefühlen unterwerfen.
Bildanalyse 5: Berufsbild Elektromonteur 1980
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A23: Verband Schweizerischer Elektroinstallationsfirmen 1980, 7 Copyright © EIT.swiss
Quelle: Der Elektromonteur, Verband Schweizerischer Elektroinstallationsfirmen (VSEI) in Verbindung mit dem Schweiz. Verband für Berufsberatung, Zürich 1980, S. 7 (Berufsbild, Format A5, 24 Seiten, 10 SW-Fotos + farbiges Umschlagbild, 8 davon bilden Elektromonteure ab)
1. Was sind die ersten Eindrücke der Interpretierenden: a) vom Kontext; b) subjektive Assoziationen?
a) Ort: es könnte sich um ein Garagendach handeln; Zeit: tagsüber; Wetter: bedeckter Himmel (keine scharfen Schattenbildungen erkennbar) – Licht und Kleidung deuten auf einen Tag in der kühleren Jahreszeit hin.
b) Das Bild zeigt großflächig abgebildet zwei Männer, auf die zunächst der Blick fällt, aber bald fängt der Bildkontext an zu wirken. Zu spüren sind das (vermutlich) kalte Wetter und die zu verrichtende unaufschiebbare Arbeit. Denn auf Baustellen geht Arbeit Hand in Hand, der Fortschritt des Gesamtprojekts hängt vielfach davon ab, ob wie geschickt und durch gute Planung verzahnt die unterschiedlichen Gewerke miteinander harmonieren. Dicke Arbeitsjacken lenken die Aufmerksamkeit auf die Wettersituation. Der hockende Mann im Vordergrund scheint einen dunklen Rollkragenpullover unter der Jacke zu tragen. Auch bei dem stehenden jüngeren Mann ist an den Ärmeln zu sehen, dass er einen Pullover unter der Jacke trägt. Subjektiv fühlen sich die Betrachtenden der abgebildeten Szene zugehörig. Es ist kein Bild, das Mitleid mit den Arbeitenden suggeriert, vielmehr spüren sich die Betrachtenden die äußeren Umstände. Dies ist kein negatives Gefühl – es entwickelt sich eine heroische Passion, die die Zugehörigkeit zur Szene ausmacht. Es kommt auf den Einsatz aller Beteiligten an, denn niemand anderes könnte die dringenden Arbeiten jetzt ausführen. Zu erkennen sind zwei Mauern aus Hohlziegeln und offenbar eine auf Mauerhöhe abschließende Holzverschalung auf der das Drahtgeflecht bereits verlegt wurde. Bei dem schwarzen Rohr im Hintergrund mag es sich um ein Abwasserrohr handeln. Nach Verlegung der Kabelkanäle wird - aller Voraussicht nach - die Betondecke gegossen. Das Bild stellt somit die grundlegende Bedeutung der Elektromontage und damit des Berufes bei Hausbau oder -erweiterung. In Verbindung mit diesen groben Grundlagentätigkeiten, ist die Kleidung den Umständen entsprechend praktisch gewählt. Sie erscheint auf dem Bild abgenutzt. Der Stoff an der Knieregion des stehenden Arbeiters ist ausgebeult – womöglich von einer häufigen knienden Haltung. Bei den aufgesetzten Taschen der Hose wirken die Risse – sofern es tatsächlich solche sind – wie ein Blickfang. Der offene Ärmel der Jacke kann auf einen fehlenden Knopf hindeuten. Die Kleidung beider Arbeiter ist sauber, erscheint jedoch vom häufigen Waschen abgenutzt und an den beanspruchten Stellen ausgeblichen.
2. Was empfinden Interpretierende, wenn sie die Personen auf dem Bild nachstellen (Körperlichkeit)?
Beim körperlichen Nachstellen entsteht kein unnatürliches Gefühl. Der hockende Mann stützt sich mit seiner linken Hand stabilisierend ab. Diese Haltung ist logisch und anders kaum denkbar. Ein Knien auf dem Drahtgeflecht ist nicht möglich, der unebene Boden erfordert die zusätzliche Stütze. Sein Blick ist realistisch auf den Aktionspunkt gerichtet.
Der jüngere stehende Mann hat den Plastikschlauch am Körper gestützt. Sein hinteres Bein trägt die Last. Diese Haltung ist die einzig mögliche. Er reicht den Schlauch so, wie es in der Praxis sein würde, und die Rolle hält er an der Hüfte abgestützt, sodass er dem knienden das Rohr Mann Meter für Meter abrollen kann, ohne dass die Rolle aus der Hand gelegt werden müsste. Da die Rolle einiges an Gewicht hat, wird verständlich, dass die auf den ersten Blick etwas künstlich wirkende gekrümmte Rückenhaltung für die Balance erforderlich ist.
Im Prinzip ist der Nachstellungsversuch ein Indiz dafür, dass die Fotografie tatsächlich natürlich auf einer Baustelle entstanden ist und nicht zum Zwecke des Fotos konstruiert wurde. Es kann sich bei der Aufnahme in der Tat um einen Schnappschuss handeln.
3. Was ist auf dem Bild zu sehen (Versprachlichung)? Welche Bedeutung drückt es aus (Sinngehalt)?
Versprachlichung: Zwei Elektromonteure verlegen Plastikkabelrohre auf einem Drahtgeflecht. Am Giebel des Hauses im Hintergrund ist erkennbar, dass die Fläche, auf der sich beide Männer befinden ein Garagendach sein könnte. Durchaus denkbar wäre auch, dass es sich um einen Erweiterungsanbau handelt. Während der hockende, ca. 45-jährige Mann die Rohre an einer durch die Decke abwärts führenden Öffnung festbindet, reicht der stehende, ca. 20-25-jährige Mann ein Ende von der Plastikrohrrolle, die er gerade hält. Beide sind in die Arbeit vertieft und schauen gemeinsam auf den Aktionspunkt, die Stelle, an der der hockende Arbeiter mit einem nicht näher definierbaren Werkzeug die Rohre befestigt, bzw. herunterbindet, sodass diese beim späteren Gießen des Betons vollständig unsichtbar in der Decke verlegt sein werden.
Sinngehalt: Neben einigen anderen Informationen findet der Leser der Broschüre auf der linken Seite gegenüber dem Bild im Text folgende Information: „Bei Neubauten ist er bereits im Rohbau anzutreffen. Vor dem Betonieren, beim Erstellen der Mauern und Decken verlegt er die Schutzrohre für die elektrischen Leitungen, setzt Kasten für die Montage der Apparate. Termingerecht muss er erscheinen, Aussparungen nach Plan vorsehen, um spätere Nacharbeit auf ein Minimum zu reduzieren.“. Der Kontext beschreibt was das Bild visualisiert. Auch grundlegende Arbeiten im Rohbau müssen mit Verlässlichkeit und Sorgfalt ausgeführt werden. In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre erhöhte sich die Anzahl der Eigenheime in der Schweiz. Damit erhöhten sich auch die Berufs- und Verdienstchancen der Elektromonteur*innen. Dies gibt der Kleidung eine neue Bedeutung: Die zukünftige Sicherheit hing von der (damals) gegenwärtigen Bereitschaft ab auch gröbere und körperlich schwerere Arbeit zuverlässig und genau zu erfüllen. Der folgende Absatz projiziert den weiteren Ablaufplan: „Später – wenn Maurer, Gipser, Schreiner, Bodenleger und Maler an der Arbeit sind – ist der Elektromonteur wieder anzutreffen. Er zieht Drähte und Kabel – dem Verwendungszweck angepasst – in die Rohre, montiert die Apparate bei den Verteilstellen, setzt Schalter, Verteil- und Steckdosen.“. Damit wird der Sinngehalt klarer: Hier werden Schutzrohre für die Kabel verlegt. Der Kontext zeigt die Arbeit der Monteure als Teil eines Ganzen auf. Nur durch handwerklich und zeitlich präzise geplante Arbeiten kann die Montage der Elektroinstallation zufriedenstellend dem Bauprozess dienen. Die Verschiedenartigkeit der Einzeltätigkeiten macht den Beruf attraktiv.
Die tiefere Sinnebene ergibt jedoch auch weitere Lesarten. Da sehen die Bildbetrachtenden einerseits den aktiv am Aktionspunkt des Bildes dargestellten Lehrmeister und seinen offenbar beobachtenden und assistierenden Lehrling. Für den Lernerfolg ist die Praxisbegleitung in Handwerksberufen mit vielfältigen Einsatzspektren durch erfahrende professionelle Kräfte unabdingbar. Eine weitere Interpretation ergibt sich aus dem Umfeld. Wenn der gegenüberliegende Text Termingerechtigkeit ansprach, dann erlangt die Wettersituation tiefere Bedeutung. Auch bei kaltem Wetter müssen Tätigkeiten im Außenbereich ohne Verzögerung erledigt werden können. Robuste, ja grobe Schutzkleidung ist dabei hilfreich. Den Bildbetrachtenden wird beim Lesen des Textes bewusst, dass auch die erwähnten Maurer, Gipser, Schreiner, Bodenleger und Maler jener Zeit durchaus ähnliche Kleidung wie die abgebildeten Elektromonteure getragen haben. Damit werden Interessent*innen für den Beruf darauf vorbereitet, nicht wählerisch sein zu können. Es wird bereits durch das Bild damit begonnen, berufliche Identitätsideale zu vermitteln. Elektromonteur*innen sehen sich auf Baustellen zahlreiche Gefahren gegenüber. Verbildlicht ist dies zusätzlich durch die fehlenden Handschuhe. Die Drahtgeflechte aus rohem Walzstahl sind in aller Regel rostig, scharfe Drahtkanten lauern überall. Umso mehr fällt der Kontrast an der Hand des Meisters auf: Er macht es vor, wie ein Elektromonteur zu sein hat: Er muss fest zugreifen können und unbeirrt seine Arbeit termingerecht beenden. Tatsächlich behindern Arbeitshandschuhe allzu oft die Arbeitsabläufe da, wo es auf Geschick und Fingerspitzengefühl ankommt, an der Grenze zur Verletzungsgefahr. Die 1:1 Anleitung berührt alle Einzelheiten des gesamten Arbeitsablaufes und wirkt auf diese Weise identitätsprägend auf den Lernenden.
4. Gibt es etwas, das die Interpretierenden auf dem Bild erwartet hätten, was aber fehlt (Interpretation des Nicht-Vorhandenen)?
Das auf den allerersten (flüchtigen) Blick des Laien vermeintliche Kabel, entpuppt sich in Wirklichkeit als Plastikschlauch. In einem Berufsbild „Elektromonteur“ wäre ein Kabel zu erwarten gewesen. Jedoch sehen die Betrachtenden an den fünf im Bild erfassten Enden anstelle der Kabeladern einen glatten Abschluss, eine hohle Öffnung oder (links im Vordergrund) eine Plastikkappe. Dadurch wird erklärbar, dass der jüngere Mann die Rolle überhaupt über eine gewisse Zeit zu halten vermag. Tatsächlich werden vor Betongüssen Plastikrohre verlegt, in die später die Kabel gezogen werden, sodass diese im Nachhinein (z.B. bei Schäden) ausgetauscht werden können.
5. Wie ist das Bild aufgebaut? Was ist zentral (optische Gewichtung)?
Das vom Auszubildenden gereichte Rohrende befindet sich in der Bildmitte. Auch wenn die Hauptaktion des Bildes das tiefer im Foto das Festbinden der Plastikrohre durch den Meister ist, springt der Blick stets aufwärts zur Bildmitte. Die Aufmerksamkeit der Betrachtenden wird dadurch auf den Lehrling gelenkt. Er dominiert, genau in Bildmitte stehend, über 2/3 der vertikalen Ausdehnung bis fast zum oberen Rand die Fotografie. Die Wahl der Perspektive und seine etwas zurückgelehnte Haltung lässt ihn überragend erscheinen. Der Bildaufbau beschreibt ein Dreieck, beginnend vom Gesicht des Meisters bildet das Loch in dem förmlich alle Rohre verschwinden einen unteren Zentralpunkt, dort verweilt der Blick jedoch nicht, sondern wandert automatisch über das darüberliegende Schlauchende zur Person des Lehrlings, mit der sich, dort angekommen, die Betrachtenden intensiver beschäftigen. Er ist es, der den Betrachtenden genau frontal gegenübersteht, und wird so zum „Gegenüber“ der Bildkommunikation.
6. Wie sehen die abgebildeten Personen aus (Gestik, Mimik, Haltung, Kleidung)? Wie ist ihr Verhältnis zueinander?
a) Wie möchten sich die Personen möglicherweise darstellen (subjektiv-intentional)?
Das Foto kann ein Schnappschuss auf einer Baustelle sein. Die Arbeiten erwecken nicht den Anschein gestellt worden zu sein. Der Meister bindet mit Draht in realistischer Haltung die Rohre und der Lehrling recht ihm ein weiteres Schlauchende. Nachdem auch dieses an der Abwärtsöffnung befestigt wurde, erwartet das betrachtende Auge, dass der Lehrling mit der Rolle das Rohr in die geplante Richtung verlegt. Dennoch wissen die beiden, dass sie fotografiert werden, ihr Ziel ist es anscheinend, sich so natürlich wie möglich zu geben.
b) Wie stellen sie sich faktisch für die Interpretierenden dar (objektiv-latent)?
Es scheint so zu sein, dass sich die Personen nicht in der Rolle von Fotomodellen sehen (oder speziell dafür engagiert wurden), vielmehr wurde die Arbeit eines echten Meisters und seines Lehrlings abgelichtet. Vermutlich wussten die beiden, dass am jenem Tag Fotos von ihrer beruflichen Tätigkeit gemacht werden, bei der sie sich so natürlich wie möglich zu geben hätten. In diesem Fall geben sich die fotografierten Männer so, wie sie es auch ohne Beisein des*der Fotograf*in gemacht hätten.
c) In welchem Verhältnis stehen diese beiden Sinnebenen zueinander?
Subjektiv-intentionale und objektiv-latente Sinnebene harmonieren tatsächlich miteinander. Selbst im Rahmen des Berufsbildes ist dieses Bild die einzige der acht Fotografien, das als nicht gestellt wahrgenommen wird.
7. Welche sozio-kulturellen und historischen Kontextinformationen können die Interpretierenden nutzen (Erweiterung möglicher Lesarten)?
Als zweite Fotografie in der Broschüre stellt sie auch einen Entwicklungsschritt bei der Ausbildung von Elektromonteuren dar. Nachdem erste grundlegende handwerkliche und mechanische Fertigkeiten – und zweifellos auch theoretische Kenntnisse vermittelt sind, begleitet der Lehrling seinen Meister auf die Baustelle, übernimmt dort jedoch noch keine eigenverantwortliche Tätigkeit, sondern beobachtet, beginnend zunächst bei einfachen Arbeiten, den Meister und steht ihm helfend zur Seite. Der Bezug zur Elektrizität ist aufgrund der fehlenden Kabel entfernter als bei den Folgefotografien, jedoch schon etwas erkennbarer als beim ersten Bild des Lehrlings an der Ständerbohrmaschine. Zum Zeitpunkt der Fotografie entwickelten sich die Aufgabenspektren hin zu immer aufwändigeren Verkabelungen auch bei Installationen in Privathäusern. Die folgenden Bilder werden komplexer und auch die Handlung geht im Folgenden vom Lernenden aus. Dieses Bild erfasst einen Teilbereich des Berufsfeldes von Elektromonteuren, es gehört jedoch eher zum simplen Grundlagenkönnen. Die Analyse der weiteren im Buch verwendeten Fotografien illustriert die von Lernenden im Laufe der Ausbildung nachzuweisenden Fertigkeiten. Beginnend von der Ausführung einfacher Installations-, Montage- und Reparaturarbeiten und dem Lesen einfacher Pläne und Schemata im ersten Lehrjahr (S. 12), werden im Laufe der Ausbildung verschiedenste Installations- und Reparaturtätigkeiten erlernt, bis hin zum selbständigen Spleißen von Kabeln und der Installation elektrischer Raumheizungs- sowie Steuer- und Regelanlagen.
8. Falls es mehrere konkurrierende Interpretationen (zum Gesamtbild oder zu einem Detail) gibt: Welche erscheint am wahrscheinlichsten? Warum?
Dieses Bild hat verschiedene Sinngehalte. Der direkte Zugang im Kontext des Berufsbildes ist die Darstellung einer typischen (einfachen) Arbeitsaufgabe von Elektromonteuren. Interessent*innen für den Beruf bekommen – wie auf einer Exkursion ein praxisnahes, realistisches (Ausschnitts-) Bild des künftigen Berufs vermittelt. Dabei ist offenbar bewusst nichts fotografisch geschönt.
Eine zweite Lesart ist in der Stellung des Bildes im Rahmen des Buches begründet, wie im Folgenden dargestellt, handelt es sich um ein Foto in einer Bildserie, die nicht nur unterschiedliche Tätigkeiten visualisiert, sondern auch eine Entwicklungshierarchie im Laufe der Lehrausbildung. Das Bild an zweiter Stelle von insgesamt acht Bildern, welche die zu durchlaufenden Ausbildung illustrieren, ist offenbar das Einzige, auf dem ein Lehrmeister mit dem Lehrling abgebildet ist. Es ist gleichzeitig das erste Bild von einem Einsatz auf einer Baustelle. Als weitere Besonderheit in der Reihe der Fotografien, ist es die Einzige, auf der ein Einsatz unter freiem Himmel abgebildet ist. Trotz der Sonderstellung des Bildes sind sich die Betrachtenden sicher, dass sich die berufliche Zukunft durchaus häufiger unter freiem Himmel abspielen wird und dass selbst nach absolvierter Ausbildung noch oft praktischer Rat erfahrener Kolleg*innen benötigt sein wird.
Für den Transport beruflicher Idealvorstellungen hat die Fotografie eine besondere Stellung, da sie zahlreiche latente Sinngehalte erkennen lässt. Fotografien für Publikationen weisen meist ideale Kontextbedingungen auf. Das Bild entstand bei trübem Wetter. Doch genau das scheint hier zum Ausdruck gebracht zu werden. Es geht um die Herausforderungen des Berufes. Kälte ist kein Hinderungsgrund für termingerechtes Arbeiten. Die Arbeit ist grob und erfordert die Bereitschaft anzupacken. Ganz gleich, ob es die schwere Rolle ist die gehalten wird oder ein hartes Drahtgeflecht, es ist so etwas wie eine Passion zu spüren, die beide Protagonisten kennzeichnet. Sie sind völlig von der Arbeit ergriffen. Nicht einmal das unbequeme Stehen und Gehen auf dem Drahtgeflecht, mit unzähligen Stolperfallen interessiert die Beiden. Die Eindrücke sind offenbar bewusst durch die Perspektivwahl verstärkt, dann der Vordergrund wird vom Drahtgeflecht und dem Wirrwarr der verlegten Rohre völlig eingenommen. Das Bild ist packend, es spricht all jene an, die bereit sind sich der Herausforderung einer keineswegs ungefährlichen Arbeit zu stellen. Aber dieses Bild demonstriert auch Geschick und Vielseitigkeit. Denn nach dem Guss der Betondecke kommen die Monteure wieder um die nunmehr im Inneren des Gebäudes erfolgenden Installationen fortzusetzen. Exakte Planung, das rechte Timing und Feingefühl in der Ausführung sind Schlüssel zum Erfolg in diesem spannenden Beruf. Damit wird die Brücke zur Zukunft geschlagen. Denn gebaut wird für die Zukunft. Wenn die Wirtschaft wächst und der Bau boomt, dann werden Elektromonteure benötigt, die damit einer gesicherten Zukunft, voller Weiterentwicklungsmöglichkeiten entgegensehen können, denn Innovationen prägen das sich kontinuierlich wandelnde Gesicht der Elektrotechnologien. Die Betrachtenden sind kaum darüber verwundert, dass es sich um zwei Männer handelt. Der Beruf scheint wie für Männer geeignet zu sein, denn er erfordert körperliche Kraft und die Fähigkeit der Witterung zu trotzen. Er bietet aufgrund seiner durch ständige Innovationen genährten Zukunftsträchtigkeit individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten und ist geeignet langfristig eine Familie zu ernähren.
9. Mit welcher Technik wurde das Bild aufgenommen (Weitwinkel, Tele, Perspektive, Ausschnitt, Licht)?
Das Foto wurde vermutlich mit einem leichten Weitwinkelobjektiv (25-30 mm) aus etwa 3-4 m Entfernung ohne Blitz aufgenommen. Alle Konturen sind in gleicher Schärfe abgebildet. Die Schwarz-Weiß-Fotografie wurde vermutlich aufgrund der Drucktechnik gewählt, denn außer dem Deck- und Rückblatt der Infobroschüre ist diese durchgehend in Schwarz-Weiß gedruckt. Der Lichtkontrast erfasst das komplette Helligkeitsspektrum. Die Wahl des Ausschnitts erfasst beide Elektromonteure vollumfänglich und verstärkt die Einsicht in den Vordergrund. Damit wird die Betonung auf das Verlegen der Rohre – die Tätigkeit der beiden gelegt. Dadurch werden die Betrachtenden in die abgebildete Szene mit einbezogen. Die Fotografie eröffnet den Zugang zur Arbeit auf dem Dach. Der Effekt wird durch die Wahl der Perspektive verstärkt, denn die Bildbetrachtenden schauen von derselben Höhe aus wie der aktivere Meister auf das Geschehen. Dabei entsteht eine Reihenfolge der Aktivität: der Meister beherrscht die Szene; der Auszubildende steht ihm bei, wartend, und doch wissend, was zu tun ist, die Bildbetrachtenden (jene, die sich für den Beruf interessieren) erhalten dagegen die Einladung sich in aller Ruhe das Geschehen unbeteiligt und doch interessiert anzuschauen, dazu befinden sie sich auf Augenhöhe mit dem Meister an den Aktionspunkt und erleben hautnah den Arbeitsalltag. Sie spüren das kalte trübe Wetter, auch sie hocken auf dem Drahtgeflecht mit wackeligen Beinen, müssen sich ggf. abstützen; unter ihren Beinen verlaufen zwei bereits verlegte Plastikrohre. Das Umfeld könnte kaum realistischer durch ein Foto erfasst werden. Diese Fotografie vermittelt nahezu greifbare berufliche Mythen.
10. Um nichts zu übersehen, sollte man abschließend durchaus systematisch-schematisch analysieren: von oben nach unten, von links nach rechts!
Es finden sich Details, die nicht zentral sind, aber dennoch die Gedanken anregen. Der kniende Mann hat eine für den Zeitpunkt der Aufnahme modische Armbanduhr mit Metallband und einen Ehering. Dies erscheint ein wenig merkwürdig, da in einer Reihe von Handwerksberufen aufgrund der Unfallgefahr generell auf Schmuck verzichtet wird. Hier mag dies allerdings in der Freiheit des Lehrmeisters als eine Art Statussymbol wirken. Mit anderen Worten: Der Meister, bzw. ein Geselle, den der Lehrling begleitet, steht souverän über allen Dingen. Gesetzt den Fall es ist ein Meister, dann stünde er am anderen Ende der angestrebten Karriereleiter und dennoch packt er ohne Zurückhaltung an. Das Merkmal praktischer Tatkraft durchzieht das gesamte Spektrum der Berufspositionen von Elektromonteur*innen. Die abstützende Hand bildet aufgrund ihres Helligkeitskontrastes einen Blickfang. Das oben erwähnte Spannungsfeld zwischen Arbeitsschutz (hier ohne Handschuh); Termingerechtigkeit (die Armbanduhr) und handwerklichen Fingerspitzengefühl zentriert sich in diesem, dem Betrachter naheliegendsten relevanten Punkt (obwohl es nur eine abstützende Hand ist) am stärksten.
Auch die Hauswand bietet Stoff zur genaueren Betrachtung. Deutlich zu erkennen sind die fünf Flecken über dem hockenden Lehrmeister. Ein Rohrende weist nahezu einem Zeigestock gleich auf den untersten Fleck. Offenbar waren das Bohrlöcher, die später mit Zement verschlossen wurden. An dieser Stelle mögen frühere Anschlüsse einer Freileitung gewesen sein. Die vier äußeren, im Rhombus angeordneten, Flecken waren dann die Befestigungspunkte der Isolatoren und das längliche in der Mitte mögen zwei Löcher gewesen sein, durch die die Verkabelung ins Hausinnere lief. Auch wenn dieses Detail nebensächlich ist, so trägt dies eine tiefgründige symbolische Bedeutung, denn im Vordergrund sind zwei Elektromonteure damit beschäftigt eine neue Verkabelung zu installieren, die künftig vollständig unsichtbar verlaufen wird. Damit ist der Beruf des Elektromonteurs einer ständigen Anpassung an die Paradigmen und Sicherheitsbestimmungen der betreffenden Zeit angepasst. Dieser Beruf ist nichts Stehendes, sondern in einem Schritt mit dem elektrotechnischen Fortschritt einem fließenden Wandel unterworfen. Auch der Gedanke an die einst vier Isolatoren und den nunmehr zahlreicher gewordenen Plastikschlauchzuleitungen, illustriert eine komplexer werdende Moderne, der sich jeder Elektromonteur unmittelbar bei der Lösung beruflicher Herausforderungen zu stellen hat.
11. Bild eines maximalen Kontrastes in der Publikation:
Die Publikation bietet einen Einblick in das Tätigkeitsspektrum und den Verlauf der Ausbildung von Elektromonteuren. Auf allen Fotos sind männliche Elektromonteure bzw. Lernende des Berufs in Schwarzweiß abgebildet. Alle Bilder (außer das oben beschriebene) machen den klaren Eindruck speziell für die Publikation gestellt worden zu sein. Die Bilder nehmen jeweils eine ganze Seite der A5-Broschüre ein und sind jeweils auf der übernächsten Seite der Publikation, stets rechts positioniert. Das erste Motiv ist ein junger Arbeiter an einer Ständerbohrmaschine mit einem nicht näher definierbaren Werkstück. Der Kleidungsstil ist durchaus dem der Arbeiter des auf Seite sechs befindlichen Fotos entsprechend, mit einem typischen Unterschied: der Lernende an der Bohrmaschine trägt einen für Werkstattarbeit gebräuchlichen Overall, während die Arbeiter auf dem Flachdach zweiteilige Anzüge tragen. Dies kann als Hinweis auf den Schwerpunkt auf Werkstattarbeit im ersten Lehrjahr sein. Während Ein Erlernen handwerklicher Grundfertigkeiten ist für das erste Lehrjahr vorgesehen (S. 12), was die Auszubildenden im Umgang mit Maschinen und Werkzeugen geschickter werden lässt. Allerdings werden ausgebildete Elektromonteure wesentlich häufiger mit einer Schlagbohrmaschine Bohrungen in Betonwände setzen, als an der Ständerbohrmaschine in der Werkstatt zu arbeiten (siehe Bild von S. 5). Das zweite Bild ist das oben beschriebene, und exemplarisch für die Bildanalyse ausgewählte. Danach folgt eine Nahaufnahme eines jungen Mannes, der Kabel in die Rohre an der Zuführung einer Doppelsteckdose einzieht. Die Tätigkeit erscheint wenig anspruchsvoll, sie scheint dem Arbeiter jedoch Freude zu machen (siehe Bild von S. 9). Nach einem Bild mit elektrotechnischen Werkzeugen, folgt eine Nahaufnahme eines jungen Mannes bei der Neuinstallation einer Telefonanlage, er arbeitet gerade mit dem Schraubenzieher an der Verkabelung, das Bild weist hohe Ähnlichkeit mit der Darstellung des Arbeiters an der Steckdose auf. Hier fallen der aufmerksamere Blick, die verschiedenen Kabelenden sowie zu verbindendenden Elemente auf, was auf die deutlich anspruchsvollere Tätigkeit hinweist (siehe Bild von S. 13). Das nächste Bild bietet einen Kontrast. Das Foto hat keine Beschreibung, jedoch findet sich auf der nebenstehenden S. 14 die Aussage das dritte Lehrjahr betreffend: „Lichtanschlüsse mit elektromagnetischen und elektronischen Schaltern […] erstellen“. Der Installateur verkabelt also einen Schaltschrank, selbst ist er älter als die bisherigen Fotomodelle und trägt einen Kittel, im Gegensatz zu den groben Arbeitsanzügen auf den vorangehenden Fotografien. Die Arbeiten erscheinen feiner, jedoch anspruchsvoller; die Dynamik im Bild ist dadurch erreicht, dass er gerade die eingezogenen Kabel auf entsprechende Länge kürzt. Damit wird Sicherheit und Kenntnis vermittelt, auch könnten damit die Aufstiegsmöglichkeiten bzw. der Einzug von Zukunftstechnologien, die ständige Fortbildung erfordern, angedeutet werden (siehe Bild von S. 15). Die folgende Doppelseite wird durch eine Fotografie von einem ca. 35-jährigem Installateur mit Bauhelm illustriert, der in einem Neubau (vermutlich in Kellerräumen) auf einer Leiter stehend eine Verkabelung an einer Wand anbringt. Elektriker stehen häufig auf Leitern und müssen in unterschiedlichen Positionen arbeiten und damit schwindelfrei und körperlich fit sein. Markant ist seine für heutige Begriffe etwas ungewöhnlich anmutende lange Frisur. Dieser Effekt wird durch das Tragen des Bauhelms zusätzlich verstärkt (siehe Bild von S. 17). Es folgt das Bild zweier Monteure, die gemeinsam auf einer Leiter stehend eine Deckenleuchte installieren. Das logische Denkmuster wäre hierzu: Nach der Wand, nun an der Decke. Den Betrachtenden wird die Schwierigkeit von Über-Kopf-Arbeiten deutlich nähergebracht, dabei lässt sich so manche Arbeit nur im Team verrichten. Gerade dieses Bild illustriert durch die Körperhaltungen, dass so manche Arbeit eine Herausforderung sein mag. Im Arbeitsalltag von Elektromonteuren, nimmt das Planen der Arbeiten und Lösen von Problemen an schwer zugänglichen Stellen durchaus einen beachtlichen Teil der Arbeitszeit ein. Zweifelsohne werden sich die Betrachtenden der Komplexität und Vielfalt der Aufgaben von Elektromonteur*innen bewusst (siehe Bild von S. 19).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A24: VSEI 1980, 5 Copyright © EIT.swiss
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A25: VSEI 1980, 9 Copyright © EIT.swiss
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A26: VSEI 1980, 13 Copyright © EIT.swiss
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A27: VSEI 1980, 15 Copyright © EIT.swiss
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A28: VSEI 1980, 17 Copyright © EIT.swiss
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A29: VSEI 1980, 19 Copyright © EIT.swiss
Nun folgt ein Bild, das als maximaler Kontrast gelten kann. Bevor die letzte Fotografie (eine im Dunklen durch ein beleuchtetes Geländer erhellte Brücke) erscheint, interessiert sich die Leserschaft für die bei der Lehre durchlaufene Entwicklung: Die Reihe lässt eine stetige Steigerung der Komplexität und der Verantwortung bei der Aufgabenerfüllung erahnen. Eine Systematik bei der Gestaltung lässt sich deutlich wahrnehmen: Die Bilder sind jeweils ganzseitig rechts auf einer Doppelseite angeordnet. Bis auf das erste Bild blicken die Protagonisten stets nach links, um eine maximal vorteilhafte optische Wirkung zu erzielen. Sie sollen den Text illustrieren, den Text, ihnen zugewandt, erklären. Dargestellt ist ein junger, im Gegensatz zu den vorhergehenden Fotografien, eher fein gekleideter Mann mit einem Schraubenzieher. Sein Kittel erinnert an andere Berufsgruppen: Apotheker*innen, Drogist*innen, Laborant*innen, medizinisches Personal, sogar Lehrer*innen trugen Kittel, an denen ihr Beruf zu erahnen war. Damit deutet die Kleidung auf eine berufliche Weiterentwicklung an. Auf einem Tritt steht er vor einem für Laien recht unübersichtlich erscheinendem Schaltschrank. Er richtet die einzelnen Elemente mit gelassenem Gesichtsausdruck ein. Die Verkabelung sind noch nicht zu sehen, dies ist nach Anbringen der Schaltelemente der nächste Arbeitsschritt. Somit setzt der Einbau der Schaltelemente größere Weitsicht voraus, als das reine Verkabeln. Ein Vergleich mit dem Bild auf Seite 14 lässt auch die größere Komplexität der Anlage aufgrund der Verschiedenartigkeit und Anzahl bereits verbauter Elemente erkennen – ein Hinweis auf das sukzessive Heranführen an komplexere Arbeiten. Der Monteur ist in seine Arbeit vertieft, diese scheint ihn weder körperlich noch geistig zu beanspruchen – im Gegenteil, sein Gesichtsausdruck zeigt, seine Freude an der Tätigkeit.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A30: Verband Schweizerischer Elektroinstallationsfirmen 1980, 21 Copyright © EIT.swiss
Er hat den Überblick und vermag sich zielgerichtet zu konzentrieren. Die Botschaft gegen Ende der Lehrzeit ist klar – zu einem solchen Können sollen die Lernenden hin, zumindest einige von ihnen. Auch dieses Bild transportiert ein berufliches Ideal. Es spiegelt in Verbindung mit dem vorausgehen betrachteten Bild die gesamte Bandbreite der Tätigkeiten von Elektromonteuren wider. Dem Bild gehen zwei Seiten Text voraus, in denen detailliert die zu Lehrabschlussprüfung erwarteten Kenntnisse und Fertigkeiten aufgeführt werden. Somit ist davon auszugehen, dass die Aufnahme einen Eindruck von einem erfolgreichen Absolventen der Lehrausbildung vermitteln soll. Zur Zeit der Aufnahme waren Elektromonteure in aller Regel männlich. So finden sich im Berufsbild von 1980 ausschließlich männliche Modelle. Das Bild scheint eigens für die Informationsbroschüre gestellt worden zu sein. Ein sonniger Lichtstrahl streift die Hüfte des Monteurs und triff in der Bildmitte den zentralen Teil des Schaltkastens. Es sind kein Staub, Schmutz oder Unordnung zu erkennen. Im Hintergrund sind Kartons zu erkennen, die durchaus die verbauten Schaltelemente beinhaltet haben können. Damit fällt der Blick auf die darüber erkennbare Metalleinheit, die einen weiteren zu bestückenden Kasten kenntlich machen könnte. Die komplexe Arbeit scheint noch längere Zeit in Anspruch zu nehmen. Der Mann hat sanfte Gesichtszüge, die Frisur ist zeitlos ordentlich. Er repräsentiert solide Werte. Betrachtende mögen einen Schaltplan erwartet haben, doch der Installateur scheint sicher zu wissen, wie er die komplex anmutende Arbeit zu verrichten hat. Der Anblick der Fotografie romantisiert und idealisiert seine Tätigkeit. Dennoch bleibt den Betrachtenden wohl klar, dass ein Großteil der Arbeit von Elektromonteuren eher auf anderen Baustellenumfeldern stattfindet. Die Art der Heroisierung der Tätigkeit von Elektromonteuren auf diesem Bild ist eine völlig andere als beim Ausgangsbild. Während jenes Wetterfestigkeit, Kraft und Tatkraft vermittelte, so kennzeichnet diese Fotografie die andere Seite es Elektromonteurs. Die Arbeit kann auch in angenehmen, sauberen Umgebungen stattfinden. Das Bild suggeriert durch die Größe des Kastens auch, dass der Arbeiter hier offenbar mehrere Wochen zubringen wird, wobei das Kontrastbild auf dem Dach die Tätigkeit weniger Stunden abbildet. Dennoch erweckt die Fotografie am Schaltkasten keineswegs den Eindruck von Eintönigkeit - im Gegenteil - es scheint interessant zu sein, die Bauelemente einzufügen, in weiteren Schritten zu verkabeln und auf Funktion zu prüfen. Die Aufnahmeperspektive zentriert die Schaltelemente. Der Blick wird auf den Strukturen des Schaltkastens durch die scharfen Schwarz-Weiß-Kontraste der kantigen Bauteile gefangen. Doch links am äußersten Rand des Bildes steht gelassen der Monteur. Der Bildausschnitt ist so gewählt, dass er nicht vollständig abgebildet ist, ein nicht unwesentlicher Teil seiner Frisur und seine Füße liegen außerhalb des Bildes, sein Rücken schließt förmlich den rechten Rand. Dennoch erscheint er vollständig erkennbar. Er dominiert das Bild, umschließt den Schaltkasten. Den Betrachtenden wird klar: Ohne den Monteur würde ein wesentliches Element fehlen, ohne ihn, würde der Kasten seinen Zweck nicht erfüllen können. Für ihn gibt es keinen Ersatz. Tatsächlich ist es für Laien unerklärlich, was hinter Schaltschranktüren verborgen ist, kaum würde jemand den Mut aufbringen solch eine Tür aufzuschließen. Die Schaltschrankklappe ist tatsächlich eine Schranke, eine selektierende Grenze zwischen den wenigen Elektrofachkundigen und dem staunenden Rest der Menschheit. Dieser Mythos wird auf dem Bild nicht nur gezeigt – er wird zelebriert. Will er gelebt werden, gilt es die entsprechende Lehrausbildung zu Ende zu bringen.
Globalcharakteristik und Zusammenschau der untersuchungsrelevanten Beobachtungen
Die acht Fotografien des Berufsbildes „Der Elektromonteur“ vom Verband Schweizerischer Elektroinstallationsfirmen in Verbindung mit dem Schweizerischen Verband für Berufsberatung vom Jahre 1980 können als Entwicklungsreihenfolge aufgefasst werden, die Lernende im Laufe ihrer Ausbildung durchlaufen. Nicht nur der Titel sagt es deutlich – es ist auch allen Fotografien gemein, dass junge Männer bei deutlich erkennbaren Tätigkeiten im Praxisumfeld dargestellt sind. Ziel der Publikation ist es, potentiell am Beruf Interessierten Einblicke in Ausbildungsverlauf und ins künftige Arbeitsumfeld zu bieten. Insofern hat die Publikation neben dem rein informativen, auch einen gewissen Werbecharakter. Dieser Umstand sowie die Tatsache, dass die Monteure als Personen klar bei der Arbeit erkennbar sind, macht die Publikation für die Beantwortung der Frage nach identitätsstiftenden Merkmalen besonders interessant. Die Fotografien bilden Neuinstallationen von Elektroanlagen zur Gebäudeausstattung ab. Damit wird der Gedanke der Betrachtenden an die alle berührende Zukunftsträchtigkeit der Arbeit von Elektromonteuren angestoßen. Während das Cover der Publikation farbig ist, sind sämtliche Fotos in Schwarz-Weiß. Das mag Ursachen in den drucktechnischen Herstellungsmöglichkeiten haben, andererseits kommuniziert die Broschüre damit, dass der Elektromonteur keineswegs ein neu entstandener Beruf ist. Die Resultate der Arbeit von Elektromonteuren sind allgegenwärtig und werden im Alltag kaum noch wahrgenommen, die Bildauswahl der Broschüre eröffnet erneut den Blick für die aktuelle Bedeutung des Berufs. Es fällt auf, dass auf keinem der Bilder Schaltpläne zu sehen sind. Stets sind die jungen Männer in direkter Berührung mit Kabeln und Schaltelementen, scheinen mit Selbstverständlichkeit das passende Werkzeug zu verwenden. Soweit ersichtlich, tagen die Akteure derbe Arbeitskleidung bzw. Schutzkittel. Das Arbeitsumfeld ist geprägt von Herausforderungen. Auf Seite 17 ist ein Monteur auf einer Leiter mit einem Bauhelm abgebildet. Direkt oberhalb vor seinem Kopf ist eine gefährliche Kante eines Kabelkanals erkennbar. Das Bild auf Seite 19 zeigt das erschwerte Arbeiten über Kopf zu zweit auf einer Leiter. Die von der Sprosse durchgebogenen Schuhsohlen und die an der Leiter herabhängenden Kabel lassen den Betrachtenden die Verweildauer der Monteure in solch einer Haltung erahnen. Eine ähnliche Botschaft vermittelt das Bild auf Seite 7. Das Stehen auf dem Drahtgeflecht an einem trüben, kühlen Tag mit einer sicher schweren Rolle Kabelkanal in der Hand verlangt stetige Aufmerksamkeit. Auf keinem der Bilder kommen Schutzhandschuhe zum Einsatz – wer nicht anpacken kann, sollte einen anderen Beruf wählen. Die Bilder kommunizieren männliche Entschlossenheit und Tatkraft. Keines der Gesichter wirkt angespannt oder müde, dennoch wirkt jeder Monteur konzentriert seiner Sache gewidmet. Der Blick ist immer auf den Aktionspunkt gerichtet, dem jeweils der Blick der Betrachtenden folgt – für niemanden gibt es einen Grund sich ablenken zu lassen. Auf diese Weise ziehen die Bilder die Betrachtenden in ihren Bann. Ein gewisser Reiz geht von den Personen auf den Fotos aus: Sie tragen keineswegs das Moment von Einengung und Monotonie in sich, selbst die Schaltkästen erscheinen ein begehrter Ort für Individuen, die ein interessantes Arbeitsumfeld mit persönlicher Freiheit anstreben. Das was das Faszinosum des Berufs ausmacht wird umfassend kommuniziert. Elektromonteure gehen sicher mit dem um, was für Berufsfremde schlichtweg ein Rätsel bleibt: der selbstverständliche, intuitive Umgang mit dem unsichtbaren, lebensbedrohlichen elektrischen Strom, den Schaltplan lediglich vor dem inneren Auge lesend.
Bildanalyse 6: Elektroinstallation in Wohngebäuden 2018
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A31: Schmolke 2018, Innenbuchdeckel vorn Copyright © VDE Verlag GmbH
Quelle: Schmolke, Herbert; Elektroinstallation in Wohngebäuden, VDE Verlag GmbH, Berlin 2018, vorderer Innenbuchdeckel (Handbuch für die Installationspraxis, Format A5, 684 Seiten, 243 Abbildungen und Grafiken)
1. Was sind die ersten Eindrücke der Interpretierenden: a) vom Kontext; b) subjektive Assoziationen?
a) Ort: der Außenbereich einer Baustelle; Zeit: tagsüber; Wetter: bedeckter Himmel (keine scharfen Schattenbildungen erkennbar) – Licht und Kleidung deuten auf einen Tag in der wärmeren Jahreszeit hin. Das Thema des Buches „Elektroinstallation in Wohngebäuden“ lässt die Betrachtenden zu dem Schluss kommen, dass es sich bei den abgebildeten Personen um Elektroinstallateure oder mit Elektroplanung betraute Personen handeln könnte.
b) Das Bild zeigt großflächig abgebildet eine Frau und, neben ihr stehend, einen Mann, auf denen der Blick der Betrachtenden verharrt. Das Foto wirkt durch die Farbkontraste von Gelb und Blau. Beide sind offenbar mit planerischen Überlegungen beschäftigt, denn der Mann hat einige lose A4 - Blätter unter seinem Arm, während er gemeinsam mit der Frau auf ihr Tablet schauen. Beide scheinen sich zu orientieren, dem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, stehen sie jedoch vor Fragen, die sich mit Hilfe des Tabletcomputers lösen lassen.
2. Was empfinden Interpretierende, wenn sie die Personen auf dem Bild nachstellen (Körperlichkeit)?
Das Nachstellen des Bildes gestaltet sich problemlos. Das Halten des Tablets ist natürlich. Ein Punkt fällt jedoch auf: Der Mann hält die Papierblätter (es sind zwei sicher erkennbar) ungewöhnlich hoch. Diese Haltung kann darauf hindeuten, dass die Geste beabsichtigt ist. Aufgrund des Werbecharakters der Fotografie kann davon ausgegangen werden, dass Stellung und Haltung Beider zwecks Platzierung der entsprechenden Botschaften bewusst gestaltet wurde.
3. Was ist auf dem Bild zu sehen (Versprachlichung)? Welche Bedeutung drückt es aus (Sinngehalt)?
Versprachlichung: Die Fotografie bildet eine ca. 18-20-jährige Frau und einen ca. 40-jährigen Mann mit Bauhelm und Warnweste mit karierten Hemden in schwer definierbarem Umfeld ab. Der Mann hält einige A4-Blätter unter dem Arm, während beide gemeinsam auf den von der Frau gehaltenen Tabletcomputer schauen.
Sinngehalt: Der Sinngehalt wird durch die Unterschrift „Die NormenBibliothek“ und der dann folgenden Produktanpreisung geklärt. Hierbei handelt es sich um ein Softwareprodukt, dass über Android, also elektronische Endgeräte wie Smartphone oder Tabletcomputer nutzbar ist. Die Abbildung ist ein reines Werbefoto zum Zwecke der Vermarktung der Software.
Jedoch erlangt das Foto im Kontext des Lehrbuches eine nicht unwesentliche Bedeutung. Wenn eine Person zum Zwecke der Ausbildung die Publikation erhält, dann sollte sie zunächst mit den darin enthaltenen Informationen umfassend ausgerüstet sein. Der Wunsch zum Erwerb der Software mag im Ausbildungsverlauf auch noch nicht am Arbeitsplatz entstehen, da zu diesem Zeitpunkt kaum von der Erwartung an eigenständiges Planen ausgegangen werden kann. Das Beherrschen dieser Fertigkeiten, sowie das genaue Beachten der damit in Verbindung stehenden Normen, gewinnt nach Eintritt ins Berufsleben wesentlich mehr Bedeutung. Der Kontrast des in Schwarz-Weiß publizierten Buches mit dieser doppelt verwendeten einzigen Farbabbildung hat eine starke optische Anziehung. Dadurch „fängt“ sich der Blick Lernender beim Gebrauch des Buches am Foto und es erfolgt ein Abgleich der kommunizierten Sinngehalte mit den eigenen Identitätsvorstellungen.
4. Gibt es etwas, das die Interpretierenden auf dem Bild erwartet hätten, was aber fehlt (Interpretation des Nicht-Vorhandenen)?
Beide Personen lassen kaum Interpretationsspielraum bezüglich ihrer individuellen Identität. Weder Umfeld noch Kleidungsstil geben darüber nähere Auskunft. Einzig ist im Bild die Verbindung der beiden über die Software erkennbar.
5. Wie ist das Bild aufgebaut? Was ist zentral (optische Gewichtung)?
Das Zentrum des Bildes nehmen die Gesichter der Darstellenden ein. Der Blick beider ist auf das Tablet gerichtet. Obwohl das Bild die Software anpreist, verharrt der Blick der Betrachtenden auf dem Gesicht der jungen Frau. Dieses ist mehr in der Bildmitte als das des Mannes. Hieraus ergibt sich eine Lesart: Die Frau könnte Lernende der Elektrobranche symbolisieren. Diese werden durch die Bereitschaft zur Annahme technischer Innovationen der Branche zukunftsfähig. Der erfahrene Monteur bzw. Lehrmeister mit den Papierbögen steht neben ihr nahezu staunend auf das Tablet schauend. Die Lernende ist im Umgang mit dem Tablet und der Software sicher und schaut eher vorwärts, als der Mann, dessen Gesicht gesenkt erscheint. Die Kleidung beider ist völlig identisch, wodurch die gemeinsame berufliche Zugehörigkeit angedeutet sein könnte.
6. Wie sehen die abgebildeten Personen aus (Gestik, Mimik, Haltung, Kleidung)? Wie ist ihr Verhältnis zueinander?
a) Wie möchten sich die Personen möglicherweise darstellen (subjektiv- intentional)?
Nichts deutet auf einen Schnappschuss hin. Es handelt sich um ein Werbefoto, für das offenbar speziell von einer Agentur zur Vermarktung der Software erstellt wurde. Folglich sind Aktion und Blick auf das Tablet gerichtet. Durchaus wäre vorstellbar, dass die Darstellenden Modelle sind, die eine Rolle spielen, also nicht der Elektrobranche zugehörig sind. Das Foto selbst kann vor einem beliebigen Gebäude aufgenommen worden sein, denn klare Hinweise auf eine Baustelle sind nicht erkennbar.
b) Wie stellen sie sich faktisch für die Interpretierenden dar (objektiv-latent)?
Durchaus wäre vorstellbar, dass sich eine Szene in dieser Form abspielt. Der Mann könnte die Frau nach einer gewissen elektrotechnischen Norm bzw. Sicherheitsbestimmung befragen und diese schaut in den Tabletcomputer. Dennoch erscheint die Situation gekünstelt, denn der Mann hat Dokumente unter dem Arm, durch die Vorbereitung und Wissen kommuniziert wird. Die Frau mit dem Tablet wird in dieser Lesart eher als Dekoration wahrgenommen.
c) In welchem Verhältnis stehen diese beiden Sinnebenen zueinander?
Aufgrund des Fehlens eines realistischen Bild-Hintergrund-Kontextes und der Werbebotschaft erscheint das Foto wenig authentisch. Die schrillen Farben verstärken diesen Effekt. Die Werbebotschaft unter dem Bild ist mit leuchtendem Blau unterlegt, was steht im starken Kontrast zu dem komplett in Schwarz-Weiß-Druck gefertigten Buch steht. Die Betrachtenden kommen zu dem Schluss, dass es für die Zweckerfüllung des Fotos nicht erforderlich ist, dass objektiv-latente und subjektiv-intentionale Sinnebene deckungsgleich sind, die Modelle könnten auch berufsfremd sein.
7. Welche sozio-kulturellen und historischen Kontextinformationen können die Interpretierenden nutzen (Erweiterung möglicher Lesarten)?
Die 648-seitige Publikation als Kontext für die Fotoanalyse erweitert die Vielfalt der Lesarten. Das schlicht gehaltene Buch der VDE-Schriftenreihe „Normen verständlich“ wird auf dem Titel als „Handbuch für die Installationspraxis“ ausgewiesen. Das Buch richtet sich, wie es der Rücktitel beschreibt an Planer, Projektierungsingenieure, Meister, Techniker, Facharbeiter sowie Auszubildende und soll In Meister- und Berufsschulen sowie Bildungseinrichtungen Gebrauch finden. Es enthält 38 Kapitel, die systematisch Normen und Richtlinien zur Elektroinstallation in Gebäuden aufführt. Auf Seite eins sind Hinweise zum Erhalt des vorliegenden Buches als E-Book gegeben. Das gegenüber auf dem inneren Buchdeckel positionierte Foto verweist auf einen anderen Titel desselben Verlages. Hierbei wird ersichtlich, dass obwohl die Publikation als Print-Version vorliegt, und als solche auch von den Adressat*innen genutzt wird, eine Orientierung hin zu elektronischen Angeboten erfolgt. Die Publikation zeigt hierbei ein zukunfts- und technologieorientiertes Selbstverständnis. Dies erscheint nicht ungewöhnlich für eine Branche, die durch Gebäudeinstallationen die Grundlage für den Einzug technischer Innovationen in die Haushalte legt. Für Lehr- und Handbücher der Elektromontage ist charakteristisch, dass sie neben Tabellen und Grafiken wenige bzw. gar keine Fotografien enthalten. Sind solche vorhanden, werden in den seltensten Fällen Personen abgebildet, meist sind es Bauelemente oder Installationsbeispiele, die thematisiert werden. So auch im Falle der „Elektroinstallation in Wohngebäuden“. Insgesamt zählt die Publikation 243 Abbildungen, die Anwendungsbeispiele von Installationen sowie Schaltpläne der Leserschaft näherbringen. Das gesamte Buch ist in Schwarz-Weiß gefertigt. Es findet sich im Buch kein einziges Foto von Elektroinstallateur*innen. Auch der Einband ist ohne illustrierende Abbildung. Damit erhält das Foto eine völlig neue Stellung. Es fällt bei jedem Aufblättern des Buches ins Auge. Bemerkenswert bei der Gestaltung ist, dass der vordere Innenbuchdeckel die „NormenBibliothek“ bewirbt. Dabei handelt es sich um eine Software, die fest auf einem Computer oder Tablet installiert wird. Die innere Seite des Rückdeckels enthält die identische Fotografie und bewirbt die „Normenauskunft“ desselben Verlages, die auch in einer App besteht, jedoch kein umfassendes E-Book der „VDE-Schriftenreihe und weitere[r] Fachbücher“ darstellt. Dies stellt die Verbindung beider Produkte zum selben Anbieter heraus, könnte aber auch andeuten, dass sich die Inhalte einen hohen Verwandtschaftsgrad aufweisen.
8. Falls es mehrere konkurrierende Interpretationen (zum Gesamtbild oder zu einem Detail) gibt: Welche erscheint am wahrscheinlichsten? Warum?
Die Fotografie hat unterschiedliche Sinngehalte. Die erste Lesart ist im Text unter dem Bild zu erkennen. Mit der Fotografie wird visualisiert, dass beide Personen nur in Verbindung mit dem Tablet als komplett ausgerüstet erscheinen. Selbiges (wodurch der Gedankenkreis zur Software geschlossen wird), gehört wie auch Bauhelm und Warnweste zur Ausstattung moderner Elektrofachkräfte. Gerade diese Utensilien fehlen auf Fotografien von Elektromonteuren früherer Jahrzehnte. Gegenwärtig ist Sicherheit oberstes Gebot bei Installationen und auf Baustellen. Die Fotografie ist bunt, gerade aufgrund der abgebildeten Sicherheitsbestandteile der Ausrüstung, vor Farbe sprühend – ein Maximalkontrast gegenüber den zerknitterten Blättern unter dem Arm des Mannes und dem rein in Schwarz-Weiß gedruckten Buchinhalt. Das Tablet deutet die Bedeutung der Branche bei der Einführung technischer Innovationen an. Ohne das Schaffen der Vorrausetzungen – in Form der Installation verschiedenster Netzwerksysteme durch Elektrofachkräfte – sind Fortschrittstechnologien zur Ausweitung der Digitalisierung nicht denkbar. Ironischerweise arbeitet das Tablet völlig ohne sichtbare Verkabelung – das bislang klassische Symbol von Elektromonteuren. Dass die junge Frau das Tablet bedient und gleichzeitig einen fast lächelnden Blick andeutet, verweist auf den selbstverständlichen Umgang der jüngeren Generation mit Netzwerktechnologien und Datenbanken. Der klassisch ausgebildete Lehrmeister scheint unmerklich im Abseits zu geraten.
Eine weitere Interpretationslesart ergibt sich in der Betrachtung des Fotos im Gesamtkontext Lehrbuch. Denn hier ist es, zumal auf vorderem sowie hinterem Inneneinband großflächig abgebildet, als einziges Farbbild des umfangreichen Bandes ein willkommen illustratives Bild. Nirgends sonst in der Publikation sind Personen abgebildet. Die abgebildete Konstellation macht die Elektrobranche erstrebenswert. Die Attraktivität der jungen Frau ist durch das lässig in Szene gesetzte lange Haar, die scharfen Konturen der Augenbrauen und ihre Positionierung im Vordergrund, offenbar bewusst eingesetzt worden, um eine bestimmte Botschaft zu vermitteln. Nicht unbeachtet bleibt im Kontrast dazu der reifere Mann, der durch seinen Blick Erfahrung und einen Anflug von Erfolg darstellt. Er könnte einen Lehrmeister oder Elektroingenieur repräsentieren. Sein Erfolg beruht einerseits auf der langjährigen Erfahrung, gestützt durch stetige Weiterbildung und die Unterstützung jüngerer Kolleg*innen bzw. Auszubildende. Längst scheint die Zeit vorbei, in der Planung, Installation und Abnahme der Elektroinstallation in Großgebäude durch Einzelfachkräfte bewältigt werden konnte. Den Betrachtenden wird der Beruf lukrativ präsentiert, in eine sichere Zukunft weisend, für jene, die der Herausforderung technischer Innovationen offen gegenüberstehen. Wer wollte nicht Anteil an den Vorzügen eines solch attraktiv präsentierten Berufes haben?
Speziell ausgehend von der Kleidung, die durch schrille Farben die Blicke der Betrachtenden fängt, lässt sich eine weitere Lesart ableiten. Die dominierenden Farbeffekte der Pflichtbestandteile der Sicherheitsausstattung, lassen wenig Platz für Individualität. Ergänzt durch das Tragen karierter Arbeitshemden, erinnert der Kleidungsstil der Beiden an Uniformen. Kaum Platz für kreativen Freiraum ist auch Kennzeichen des Berufs. Grenzen der Individualität setzen der umzusetzende fertige Installationsplan sowie gesetzliche Normen. Auch hier schlägt sich die gedankliche Brücke zur „NormenBibliothek“. Der gemeinsame Aktionspunkt ist das Tablet - hier sind die Informationen zu finden, die es einzuhalten gilt. Alles Ablenkende fehlt; vergeblich suchen die Betrachtenden Werkzeuge oder Hinweise auf das Umfeld der Baustelle. Damit kann eine zunehmende Identitätsdiffusion vor dem Hintergrund von Digitalisierung angedeutet sein. Das Abenteuer Arbeit scheint nunmehr nirgends als in der virtuellen Umgebung des Tabletcomputers zu finden sein.
Auch wenn die Fotografie auf dem ersten Blick reinen Werbecharakter zu haben scheint, so führt ihre Verwendung in einem Lehrbuch, welches an Ausbildungsstätten der Elektrobranche eingesetzt wird, primär zu einer Identifikation der Auszubildenden zur Beeinflussung ihrer Vorstellungen vom künftigen identitätsprägenden Beruf. Ein solches vermitteltes Identifikationsmerkmal ist die Affinität zu technischen Innovationen. Wer bereit ist, sich durch permanente Weiterbildungen mit den neu eingeführten und neu einzuführenden (denn Elektromonteure sind hier Wegbereitende) Technologien zu qualifizieren, kann von den Zukunftschancen der Branche profitieren. So mag es durchaus kein Zufall sein, dass der Lehrmeister mittleren Alters weniger fröhlich als die junge Dame in Szene gesetzt wurde. So scheint er, mit den durch häufigen Gebrauch und Witterungseinflüsse gewellten und unordentlich aussehenden Dokumenten unter dem Arm, gegenüber der attraktiven jüngeren Frau mit dem modern wirkenden Tablet, unbewusst ins Abseits geraten zu sein. Dies mag als Tücke eines dynamischen Berufs gelten. Junge dynamische Menschen beider Geschlechter werden durch die Fotografie angesprochen, als Kunden für das Softwareprodukt und als Auszubildende für die Berufe der Elektrobranche umworben. Würde das Foto als Inserat in einer Zeitschrift für Elektrointeressierte erscheinen, dann wäre seine Wirkung eine andere. Die Betrachtenden könnten sich in diesem Falle eher für den begleitenden Text interessieren. Im Rahmenkontext des Lehrbuches ist es jedoch so, dass die Leserschaft mit Erhalt bzw. Erwerb des Buches die gewünschten Informationen bereits in gedruckter Version vorliegen hat. Erst später, ggf. nach Abschluss der Ausbildung, könnte es sich im Praxisumfeld als vorteilhaft erweisen, die gewünschten Daten stets aktuell und umfassender als in der Printversion zur Verfügung zu haben. So deutet das Bild auch den erfolgreichen Verlauf der Ausbildung an und suggeriert, dass die tägliche Nutzung im Praxisumfeld zur Realität künftiger Fachkräfte gehört. Damit entsteht eine Gewichtung der virtuellen Welt. Das Bild verschweigt, dass ein Großteil der Arbeit von Elektromonteuren bei Gebäudeinstallationen nach wie vor im Verlegen und Anschließen von Verkabelungen besteht.
9. Mit welcher Technik wurde das Bild aufgenommen (Weitwinkel, Tele, Perspektive, Ausschnitt, Licht)?
Neben der Verwendung als Werbefoto, erinnert die Bildkonstruktion an Portraitaufnahmen. Ein Normalobjektiv könnte von ca. vier Meter Entfernung eingesetzt worden sein. Die Perspektivwahl ist interessant, denn das Objektiv wurde in etwa auf der Höhe, in der das Tablet gehalten wird, eingesetzt. Damit wird das Tablet optisch hervorgehoben. Das Licht scheint natürlicher Herkunft zu entsprechen, möglicherweise kann ein Schirm verwendet worden sein, um die im Schatten liegenden Partien aufzuhellen. Als spezielles Stilelement wurde die Tiefenschärfe minimal gehalten, womit die Gegenwart der beiden Personen hervorgehoben wird. Der Effekt wird durch die Wahl des Ausschnitts zusätzlich betont.
10. Um nichts zu übersehen, sollte man abschließend durchaus systematisch-schematisch analysieren: von oben nach unten, von links nach rechts!
Der Abschlussblick eröffnet keine ergänzenden Lesarten oder fehlende Details.
11. Bild eines maximalen Kontrastes in der Publikation:
Die gesamte 684-seitige Publikation beinhaltet keinerlei Fotografien von Personen, daher lässt sich kein Kontrast herstellen. Dennoch gilt zu beachten, dass gerade durch das Fehlen anderer Fotografien die Stellung der beiden Innenbuchdeckelbilder umso zentraler für die Übertragung von Mythen wird. Die Suche nach Lehrbüchern für Fachkräfte der Elektrobranche, in der Fotografien von Akteuren abgebildet sind, gestaltet sich relativ schwierig, im Fokus der Bebilderung sind jeweils Grafiken von Schaltungen bzw. Abbildungen technischer Bauelemente.
An dieser Stelle soll als Kontrastbeispiel knapp auf die drei kleinformatigen Fotos mit abgebildeten Elektromonteuren aus dem Buch von Heinz O. Häberle „Einführung in die Elektroinstallation“, Hüthig Verlag, München/Heidelberg 2016, eingegangen werden.
Das 380-seitige Buch ist Teil der Reihe de-Fachwissen, einer „Fachbuchreihe für Elektro- und Gebäudetechniker in Handwerk und Industrie“ (S. 2) und enthält 300 Abbildungen neben zahlreichen Tabellen. Die Abbildungen sind zum Großteil Darstellungen von Schaltungen, Grafiken, neben wenigen Fotos von Bauelementen. Nur drei Bilder der Publikation zeigen Elektromonteure bei ihrer Tätigkeit. Die Bildzuschriften erläutern den Zweck des jeweiligen Bildes. In jedem Fall geht es darum, Hilfsmittel für die Montagepraxis zu visualisieren. Alle drei Bilder zeigen jeweils einen männlichen Elektromonteur auf der Baustelle. Es könnte sein, dass es sich dabei um dieselbe Person handelt. Doch lässt die Wahl des Bildausschnitts keine genaue Identifikation zu. Für den Zweck der Fotografie spielt die abgebildete Person offenbar keine Hauptrolle. Vielmehr werden die Größenverhältnisse visualisiert, bzw. die Haltung der verwendeten Werkzeuge. Jeweils etwa zweit Drittel der Bildfläche nimmt die Darstellung der eingesetzten Werkzeuge bzw. Hilfsmittel ein. Der Blick des Monteurs ist auf seinen Aktionspunkt gerichtet. Bildbetrachtende sind nicht in Interaktion, z.B. durch Blickkontakt mit dem Protagonisten. Aufgrund des sachorientierten Blicks des / der Fotograf*in lässt sich nur wenig zur beruflichen und persönlichen Identität der Akteure aussagen. Bild 8.7 zeigt den Monteur bei der Arbeit mit der Mauerschlitzfräse. Fachunkundigen erscheint das Halten des Gerätes schwer, vermutlich ist die Arbeit laut und staubintensiv. Der Kontext bestätigt die Annahme: „Beim Arbeiten mit der Mauerschlitzfräse muss auf gute Standfestigkeit geachtet werden, da das Gerät stark angedrückt werden muss. Das Tragen einer Staubmaske ist zweckmäßig.“ (S. 162). Dennoch mag das Werkzeug eine wichtige Innovation sein, durch das die langwierige Arbeit mit Hammer und Meißel ersetzt wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A32: Häberle 2016, 162 Copyright © Hüthig GmbH
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A33: Häberle 2016, 171 Copyright © Hüthig GmbH
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A34: Häberle 2016, 175 Copyright © Hüthig GmbH
Eine Absaugvorrichtung ist nicht erkennbar, dennoch wird durch den Einsatz der Maschine eine größere Menge Mauerwerk zu Gesteinsmehl verwandelt, indem Fugen zur Kabelverlegung geschlitzt werden, das Buch gibt eine Fräsbreite von bis zu 30mm und eine Tiefe von bis zu 45 mm an, die durch Handvorschub erreicht wird (S. 163). Der Helm und die Arbeitsjacke deuten an, dass es gilt den Körper zu schützen. Es ist eine bezeichnende Dissonanz, dass der Text das Tragen einer Staubmaske empfiehlt, diese jedoch im Bild nicht verwendet wird. Damit bekommen die Betrachtenden etwas Einblick auf das Gesicht des Arbeiters und es lässt sich ein Anflug von Individualität und persönlicher Freiheit verspüren. Der Elektromonteur verzichtet bewusst auf die Empfehlung des Tragens der Maske. Die Haltung der Maschine nahe am Körper deutet die einzusetzende Kraft an. An dieser Stelle eine Frau zu sehen, würde eher als befremdend wirken. Der Schnurbart wirkt auf diesem Bild als selbstverständliches Symbol von Männlichkeit. Bild 8.16 zeigt die Verwendung des pneumatischen Stegleitungsnaglers. Der Kontext beschreibt, dass mittels Druckluft Stahlnadeln durch die Nadelrille der Stegleitungen zu ihrer Arretierung im Mauerwerk geschlagen werden, was eine Möglichkeit der Verlegung von Leitungen im Putz darstellt. Das Foto zeichnet ein schweigendes Bild vom Gewicht des Werkzeuges, dessen Handhabung durch den angeschlossenen Druckluftschlauch ermöglicht wird. Es lässt das hämmernde Geräusch, den aufgewirbelten Staub und die heftigen Rückstöße beim Nageln erahnen. Auch diese Fotografie ist schwer mit einer weiblichen Akteurin vorstellbar. Vom Monteur ist nur der haltende Unterarm und ein Teil seines Helmes zu sehen. Der Arm vor dem unverputzten Mauerwerk bildetet einen sinnstarken Kontrast. Vor dem Hintergrund der rauen Umgebung hat dich der Arm und damit der Elektromonteur zu arrangieren. Anders ausgedrückt müssen Elektromonteur*innen verschiedene Arbeiten ausgeführt werden, auch wenn sie als schmutz- und lärmintensiv auf den Körper einwirken. Bild 8.22 zeigt schließlich einen Elektriker, der Kabel in Montagehilfsrohren verlegt. Der Kontext beschreibt dazu, dass bei der Verlegung auf Putz häufig die Leitungen durchhängen und das Anbringen zahlreicher Schellen zu Erhöhung der Arbeitszeit führt. „Deshalb werden seit einigen Jahren oft steife Kunststoff-Montagehilfsrohre verwendet […]. Durch sie wird die Montagezeit (Arbeitszeit) verkürzt und Befestigungsmaterial eingespart.“ (S. 175). Das Bild fokussiert das Aussehen solcher Rohre an einer Abbiegung. Er ist nur von hinten, bis zu seiner Schulterregion zu sehen. Er trägt keinen Helm, aber eine Arbeitsjacke. Wenngleich die Arbeit weniger staub- bzw. lärmintensiv erscheint, wie die Tätigkeiten auf den bereits beschriebenen Fotografien, fällt den Betrachtenden die über der Schuler getragene Kabelrolle auf, die ein beachtliches Gewicht zu haben scheint. Der fehlende Helm auf diesem Bild stellt eine Art Entspannung (im Vergleich zu den vorangegangenen Fotos) dar, denn tatsächlich erscheint die Arbeit des Einziehens der Kabel weniger staub- und lärmgeprägt, insgesamt durch das Fehlen der Werkzeuge zudem weniger gefährlich.
Alle drei Bilder entsprechen im Wesentlichen dem Gesamtcharakter der Fotos des Lehrbuches, denn es geht vorrangig um die Darstellung der Werk- und Hilfszeuge am Einsatzort in der Praxis. Damit kann die Annahme bezweifelt werden, dass ein bewusster Einsatz der Bilder zur Übertragung beruflicher Mythen vorliegt. Dennoch ließen sich einige kennzeichnende Momente beobachten. Es sind jeweils männliche Berufsvertreter abgebildet, in einem eher rauen Umfeld mit körperlichen Herausforderungen und Gefahren. Die Personen sind auf ihre Arbeit konzentriert. Arbeitserleichternde Hilfsmittel ermöglichen es zeitsparender vorzugehen, diese sind jedoch nicht schmutz-, lärm- und kraftsparend.
Globalcharakteristik und Zusammenschau der untersuchungsrelevanten Beobachtungen
Die Suche nach geeignetem Quellenmaterial in der Berufsbranche der Elektrotechnik gestaltet sich schwierig. Viele Publikationen beinhalten eine Reihe von Grafiken, Tabellen und oft Abbildungen von elektrotechnischen Bauteilen, viel seltener dagegen Fotografien von Berufsvertreter*innen. Die drei Schwarz-Weiß-Fotografien im Fachbuch von Heinz O. Häberle „Einführung in die Elektroinstallation“ vom Hüthig Verlag, München/Heidelberg 2016, sind typische Beispiele für solche Visualisierungen, die den Gebrauch spezifischer Werkzeuge visualisieren, der Mensch hat eher veranschaulichenden Charakter. Dennoch lassen sich gewisse Rückschlüsse in Bezug auf den Transport beruflicher Mythen gewinnen. Auffallend ist, dass alle drei Fotografien Männer bei körperlich anspruchsvoller Arbeit darstellen. Zwei Fotos lassen vermuten, dass der Einsatz der Werkzeuge zudem staub- und lärmintensiv ist. Bild 8.7 zeigt den zielgerichteten Blick des Arbeiters, dessen Männlichkeit durch den Schnurbart verstärkt erscheint. Das Gewicht der Mauerschlitzfräse ist durch das kräftige, körpernahe Halten spürbar inszeniert. Obwohl der Text das Tragen einer Staubmaske empfiehlt ist diese im Foto nicht abgebildet. Hierbei wird suggeriert, dass der Beruf individuelle Freiheit verspricht. Der Kontrast zwischen der Verletzlichkeit des menschlichen Körpers und der Härte des Mauerwerks ist in Bild 8.16 durch den entblößten Arm vor der unverputzten Wand erkennbar. In beiden Bildern sind die Arbeiter mit Helm abgebildet, wodurch an Gefahren und einzuhaltende gesetzliche Regeln an Baustellen erinnert wird. In Bild 8.22 ist die Verlegung von Kabeln in Montagehilfsrohren auf Putz dargestellt. Ein Arbeiter ohne Helm ist dem Aktionspunkt zugewandt. Eine solche Installation wird vielfach nachträglich angewandt, um bei Hausinstallationen zu modernisieren bzw. Elektroleitungen zu ergänzen. Folglich ist das Umfeld weniger gefahrvoll, wie auf der Baustelle eines Neubaus. Das Bildelement, welches erneut auf den Mythos „Mann“ im Berufsfeld verweist ist die scheinbar mit Leichtigkeit über der Schulter getragene Kupferkabelrolle. Ob Monteure generell eine größere Rolle beim Einziehen der Kabel üblicherweise geschultert tragen, oder diese eher abgelegt wird, was gewiss kraftschonenderes und beweglicheres Arbeiten ermöglicht, sei dahingestellt.
Ein völlig anderes Bild über Identitätsmerkmale Angehöriger von Elektroberufen zeichnen die beiden (identischen) Werbefotografien auf dem vorderen und hinteren Innenbuchdeckel des von Herbert Schmolke verfassten Werkes „Elektroinstallation in Wohngebäuden“, VDE Verlag GmbH, Berlin 2018. Im Buch finden keinerlei weitere Bilder mit abgebildeten Berufsvertretern. In Lehr- und Handbüchern der Elektrotechnik dienen Abbildungen häufig lediglich dazu, Schaltpläne oder Bauelemente der Leserschaft näherzubringen. In der durchweg in Schwarz-Weiß gedruckten Publikation wirkt die farbig-strahlende Fotografie des Innenbuchdeckels als Blickfang. Einzig hier ist vorn, wie hinten auf voller Seitenbreite das Bild zweier Elektrofachkräfte zu sehen. Lernende eines Berufes der Elektrobranche werden zweifellos auf das Bild aufmerksam und stellen beim Lesen das dazugehörenden Textes fest, dass eine Software angepriesen wird. Für den Transport beruflicher Mythen scheint die Tatsache, dass die Fotografien zwei Softwareprodukte umwerben, keine Rolle zu spielen, denn sie bilden durchaus eine willkommene Abwechslung in der sachlichen Umgebung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. A35: Schmolke 2018, Innenbuchdeckel hinten Copyright © VDE Verlag GmbH
Auffallend sind leuchtende Elemente der Sicherheitskleidung. Diese zeichnen bei beiden Personen ein einheitliches Bild. Offenbar geht es um das Einhalten von Regeln und Grundsätzen. Auf einer Werbefotografie für die Software zu elektrotechnischen Normen kann dies bewusst inszeniert sein. Dennoch ist es auch ein Merkmal der Gegenwart. Zuallererst geht es um Sicherheit am Arbeitsplatz, dann erst um die Erfüllung der Aufträge. Für den Beruf des Elektromonteurs, so die Lesart, ist das Einhalten der Gesetze und Bestimmungen fundamental. Die karierten Hemden mit den lässig geöffneten beiden oberen Knöpfen deuten dennoch einen Anflug von beruflich orientierter Individualität an. Bemerkenswerterweise ist eine jüngere Frau vor einem Mann mittleren Alters stehend abgebildet. Während die attraktiven scharfen Konturen und Gesichtszüge der Frau natürlich sein könnten, erscheint sie den Betrachtenden geschminkt. Im Kontrast von Bauhelm und Warnweste unterstreicht das selbstbewusst getragene braune Haar ihre Feminität im von Männern dominierten Arbeitsumfeld. Der Mann bildet mit seinem sportlich-kurzen Bart, dem ergrauten Haar und den tiefen Furchen des Gesichts einen Kontrapunkt, während diese eine frische Lernende ist, hat jener jahrzehntelange Berufserfahrung hinter sich. Den Erwartungen der Betrachtenden entsprechend, wird das Tablet (mit der umworbenen Software) von der Frau gehalten. Der Mann – der durchaus einen Berufsausbilder darstellen könnte – hält einige zerknitterte A4 Blätter, gut sichtbar und dennoch abseits, unter dem Arm. Fast schon als längst nicht mehr im Vordergrund, als nicht mehr mit dem Puls der Zeit gehen könnend, schaut der erfahrene Mann verwundert auf das Tablet. Das Foto spricht junge Personen beider Geschlechter an. Es vermittelt, dass Elektromonteure führend im Umgang und Einführung neuer Technologien vorangehen.
Der Aufbau der dargestellten Szene stellt im markanten Farbkontrast identischer blauer Helme und gelber Warnwesten beider Personen den Bezug zur Baustelle her, obwohl die Kulissen auf dem Foto gar nicht eindeutig erkennbar sind. Die individuelle Kleidung besteht aus karierten Hemden in dezenten Farben. Das Umfeld ist durch die unscharfe Fassade im Hintergrund angedeutet. Damit stehen die Sicherheitskomponenten im Vordergrund und schaffen die gedankliche Brücke zur „NormenBibliothek“ bzw. zur „Normenauskunft“. Dass beide Produkte innovativ und zukunftsweisend sind, wird durch die junge Frau dargestellt, die möglicherweise Berufseinsteigerin ist, das Tablet jedoch bedient, während der Mann mittleren Alters klassische Unterlagen (Pläne?) in Papierform nahezu demonstrativ unter dem Arm hält. Das deutet an, dass nunmehr auch Frauen erfolgreich die Männerdomäne erobern und aufgrund ihres Geschicks im Umgang mit neuer Technik, da weiterzuhelfen wissen, wo konventionelles Vorgehen zu langsam, oder zu ungenau erscheint. Die Konstellation der Blicke beider verstärkt diesen Effekt, da die junge Frau sicher und selbstbewusst die Software zu nutzen vermag, während im Blick des – möglicherweise Lehrmeisters – etwas Fragendes oder Erstauntes gelesen werden kann. Wenngleich die Gesichtszüge des Mannes, dessen Bart, das graue Haar und die Furchen in seinem Gesicht seine Männlichkeit und seine Erprobung im beruflichen Praxisumfeld betonen, so ist die stärkere Gewichtung der Einhaltung von (Sicherheits-)Normen ein Kennzeichen des Wandels in den Elektroberufen. Die Gegenüberstellung der Bilder beider Publikationen belegt damit eindrücklich die fortschreitende Spezialisation der Berufe der Elektrobranche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Inhaltsverzeichnis des Dokuments?
Das Inhaltsverzeichnis listet die Kapitel und Abschnitte des Dokuments auf, einschließlich Abbildungsverzeichnis, Tabellenverzeichnis, Danksagung, Einleitung, Berufsausbildung und Identität im Wandel, Empirische Erhebungsmethode, Beschreibung der relevanten Bildmerkmale, Diskussion der Ergebnisse, Reflexion der Gütekriterien, Bildungswissenschaftliche Implikation, Schluss, Literaturverzeichnis, Bildnachweis und Anhang mit Leitfaden und Auswertung der Bildanalysen.
Was ist der Abstract des Dokuments?
Der Abstract fasst die Untersuchung zur Auswirkung von Innovationssprüngen und soziologischen Veränderungen auf die Bildung beruflicher Identität zusammen. Fotografien werden als Medium zur Veranschaulichung historischer und berufssoziologischer Hintergründe verwendet. Die Analyse prägnanter Bilder aus Lehrbüchern und Berufsbildern identifiziert Merkmale, die berufliche Mythen transportieren können. Die Ergebnisse spiegeln Informalisierung, Individualisierung und berufliche Differenzierung wider. Die Arbeit veranschaulicht die Bedeutung von Abbildungen in Lehrmedien.
Was ist das Abbildungsverzeichnis?
Das Abbildungsverzeichnis listet die Abbildungen im Dokument mit ihren jeweiligen Titeln auf.
Was ist das Tabellenverzeichnis?
Das Tabellenverzeichnis listet die Tabellen im Dokument mit ihren jeweiligen Titeln auf.
Was wird in der Danksagung ausgedrückt?
In der Danksagung wird der Familie für die Unterstützung bei der Umsetzung des Projekts gedankt.
Was sind die Leitfragen der Einleitung?
Die Leitfragen sind: Welche Hinweise finden sich in den Fotografien in Lehrbüchern verschiedener Jahrzehnten zur beruflichen Identität? Welche Erwartungen und Ideale werden den Lernenden kommuniziert – welche Berufsmythen transportiert? Wie veränderten sich Anforderungen und Erwartungen an künftige Fachkräfte?
Welche Begriffe werden in der Einleitung definiert?
Es werden die Begriffe Berufsbilder, Identität, Persönlichkeitsentwicklung und Mythus definiert.
Was wird im Kapitel "Berufsausbildung und Identität im Wandel" behandelt?
Dieses Kapitel untersucht den Wandel der Arbeitswelt und die wissenschaftliche Sicht auf Berufsbildung. Es werden Themen wie der Qualifizierungsdiskurs, der Kompetenzbegriff, unterschiedliche Sichtweisen zur Identität, Lehrbuchgestaltung und Bildanalyse behandelt.
Was wird im Kapitel "Empirische Erhebungsmethode" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Arbeit, einschließlich der Wirkungsweise von Bildern, der hermeneutischen Methode und der Methode nach Beck. Es werden auch die Auswahl der Bildquellen und Berufskategorien begründet.
Was ist das Ziel der Hermeneutischen Fotoanalyse?
Ziel ist das Verstehen des Sinns (z.B. von in Texten verwandelter Bilder).
Was sind die Berufskategorien der Analyse?
Krankenpflege und Elektromontage.
Welche Gütekriterien werden in der Reflexion der Gütekriterien untersucht?
Intersubjektive Nachvollziehbarkeit, Indikation, Nähe der Theoriebildung zu empirischen Daten, Limitation, reflektierter Subjektivität, Kohärenz, Relevanz und Offenheit.
Was ist die bildungswissenschaftliche Implikation der Arbeit?
Die Untersuchungsergebnisse belegen die berufssoziologischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte. Die Bedeutung von Fotografien bei der Lehrbuchgestaltung anhand der verwendeten Praxisbeispiele veranschaulicht.
- Quote paper
- Michael Hojbjan (Author), 2021, Das berufliche Ideal im Wandel der Zeit. Eine hermeneutische Analyse identitätsstiftender Fotografien in berufsbildenden Dokumenten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1301316