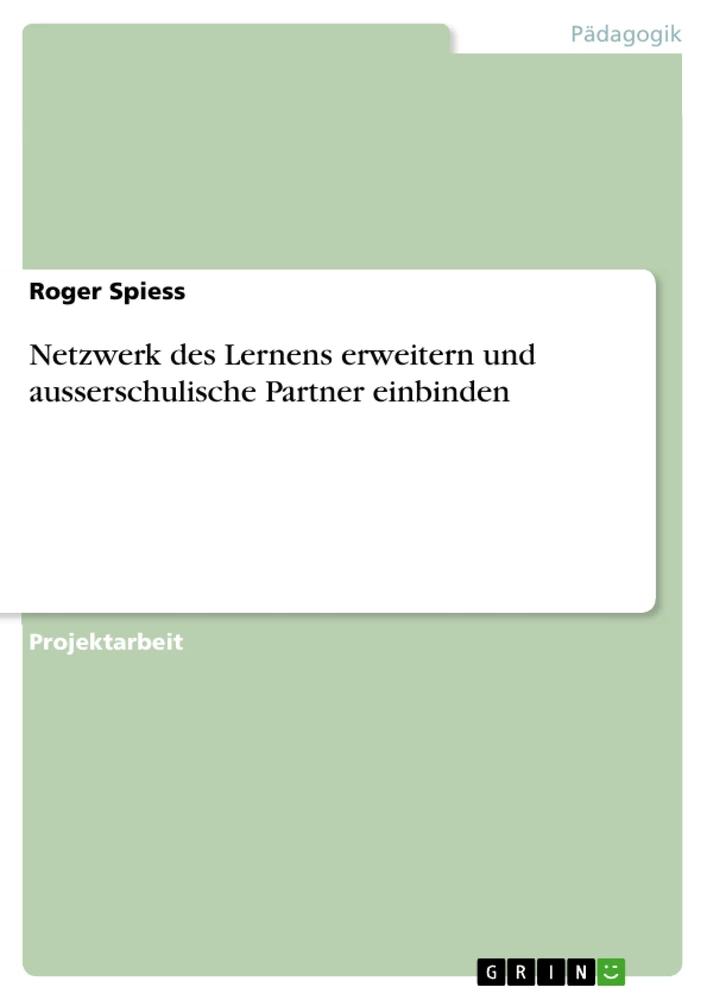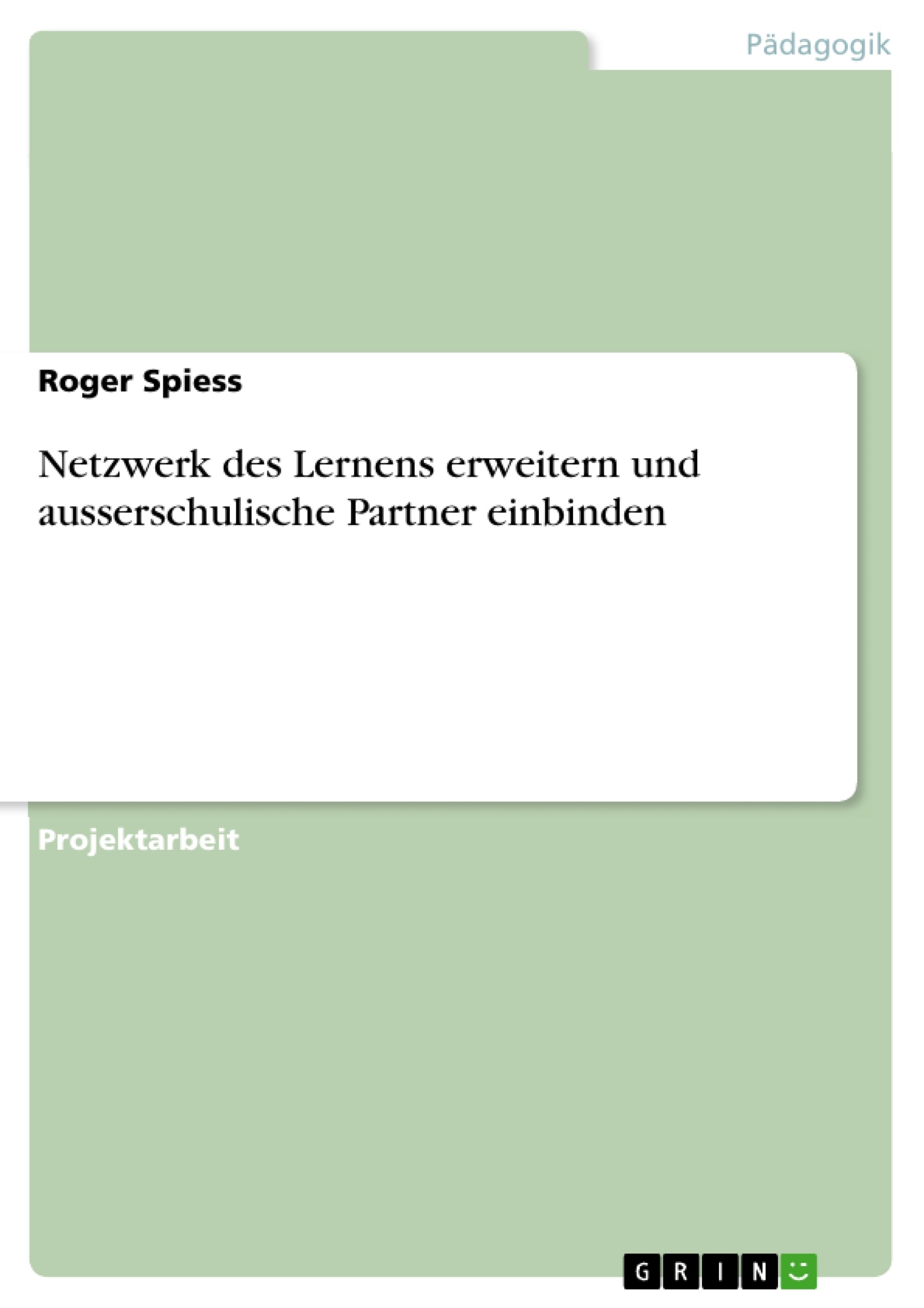Durch die Erreichung der drei Projektziele wollen wir als Schule Einfluss nehmen im Sinne des Titels «Netzwerk des Lernens erweitern – ausserschulische Partner einbinden»: Die freiwillige Tagesschule sinnvoll gestalten, die Betreuung ins Schulgeschehen einbinden und das bestehende enge Netzwerk der Betreuungsleitungen zu den Eltern nutzen. Wir fördern die Mitwirkung der Eltern, indem wir sie in die Ausarbeitung und Umsetzung des neuen Schulprogrammes einbeziehen, sowie erweiterte Formen der Zusammenarbeit testen. Gezielt suchen wir den Kontakt zu lokalen Freizeitanbietern und Vereinen, um die Schule als Triage und Vermittlerin für Freizeitaktivitäten zu nutzen.
Schon im Schulprogramm der vergangenen vier Jahre setzten wir zwei Schwerpunkte gemäss dem folgenden Aspekt aus dem Leitbild der Schule Ausserdorf: «Gestaltung von Aussenbeziehungen: Gemeinsam mit den Eltern nehmen wir die Verantwortung für die Entwicklung der Eltern wahr. Die Zusammenarbeit mit dem ausserschulischen Umfeld ist uns wichtig.»
«Wir gehen vertieft auf die Veränderungen der Schülerschaft ein und suchen den Dialog mit Kindern und Eltern aus allen Gesellschaftsschichten.»
«Durch den Einbezug von Eltern und Schülern leiten wir Massnahmen ein, welche Respekt, Eigenverantwortung und Mitsprache fördern.»
Von den betroffenen Anspruchsgruppen und der Schulkonferenz wurden die Projektziele im weiterführenden Sinne bestätigt fürs neue Schulprogramm bis 2019.
Als Schule gehen wir die erwähnten Schwerpunkte systemisch und umfassend im Sinne der sieben Wesenselemente einer Organisation von Glasl an. Im Folgenden einige exemplarische Konkretisierungen der Wesenselemente im Hinblick auf die Projektziele. Diese Grundhaltungen, Abmachungen und Abläufe bilden einen Teil des Fundaments unserer Schule zur Erreichung der genannten Projektziele. Sie entstanden über die letzten Jahre gemeinsam als Schulteam zusammen mit den jeweiligen Anspruchsgruppen im Dialog.
Inhaltsverzeichnis
Netzwerk des Lernens erweitern - ausserschulische Partner einbinden
1 Projektdesign
1.1 Begrundung
1.2 Projektziele
1.3 RelevanzfurdielokaleSchule
1.3.1 Wertebasiertes Zusammenleben
1.3.2 Kompass des Informationsaustauschs an der Schule Ausserdorf
1.3.3 Rollenverstandnis der Schulleitung
1.4 Planungsubersicht
1.4.1 Die freiwillige Tagesschule sinnvoll gestalten
1.4.2 Die aktive Mitwirkung der Eltern fordern
1.4.3 Der Aufbau von Freizeitworkshops in Kooperation mit lokalen Vereinen
2 Projektimplementation
2.1 Kommunikation
2.2 Umsetzende Handlungen und Aktivitaten
2.2.1 Inhaltliche Relevanz und Zwischenstand
2.2.1.1 Die freiwillige Tagesschule sinnvoll gestalten
2.2.1.2 Die aktive Mitwirkung der Eltern fordern
2.2.1.3 Der Aufbau von Freizeitworkshops in Kooperation mit lokalen Vereinen
2.2.2 Strukturen fur gemeinsame Entscheidungen
2.2.3 Personale Motivation und Kompetenz
2.2.3.1 Motivationsunterstutzende Change-Management Strategien im Schulbetrieb
3 Projektevaluation
3.1 Theorie und personliche Haltung
3.2 Exemplarische Evaluationsplanung eines Teilprojektes
3.2.1 Angewandte Evaluationsmethode
3.2.2 Ziele Indikatoren Datenquelle & Vorgehen Auswertung Erste Resultate
3.2.3 Aufgezeigtes Hauptproblem durch erste Evaluationsresultate
4 Reflexion und personlicher Ruckblick
4.1 Kritische Reflexion des Projekts
4.2 PersonlicherRuckblick
4.2.1 DasProjektmanagement
4.2.2 Gesamtruckschau auf den CAS
5 Verweisangaben
5.1 Literatur
5.1.1 Sammelbande
5.1.2 Monografien
5.2 Grafiken
6 Anhange
6.1 Anhang A
6.2 Anhang B
6.3 Anhang C
6.4 AnhangD
6.5 Anhang E
1 Projektdesign
1.1 Begrundung
Kinder starten in der Van Ostadeschool in Den Haag (Niederlande) jeden Schultag gemeinsam mit ihren Eltern. Das bedeutet, von sehr vielen Schulern und Schulerinnen bleibt ein Elternteil wahrend etwa dreissig Minuten im Unterricht, unterstutzt das Kind bei Auftragen oder spricht mit der Lehrperson. Die uber neunzig Prozent Schulkinder mit muslimischem Migrationshintergrund holen wahrend der Primar- schulzeit im Landesvergleich zwei Jahre auf, denn sie starten mit Ruckstand. Begrundet durch den bil- dungsfernen, sozial schlechtgestellten und fremdsprachigen Lebensstart. Flankiert wird der gemeinsame Tagesstart in den Schulunterricht durch Elternweiterbildungen mit personlicher, mundlicher Einladung, sowie dem Einbezug der Eltern in die Planung des Schulprogrammes und eine enge Vernetzung der Schule mit ausserschulischen Partnern, wie beispielsweise der Polizei oder Sozialarbeit. - Dies war der Ausloser fur meine Entscheidung, dass auch an unserer Schule ein mittelfristiges Projekt «Netzwerk des Lernens erweitern - ausserschulische Partner einbindenw erfolgsversprechend sein konnte.
Der OECD-Bericht Trends Shaping Education bestatigt die zunehmende Ungleichheit der Schulkinder beim Eintritt in die Primarschule. In der Mehrheit der europaischen Lander steigt die Zahl der Kinder aus Familien mit unterdurchschnittlichem Einkommen. Gleichzeit entsteht eine sich vergrossernde Diskre- panz zwischen armen und reichen Leuten. Selbstredend, dass dementsprechend viele Schuler und Schulerinnen aus hochqualifiziertem Elternhaus stammen, jedoch auch ein signifikanter Teil aus bildungsfer- nen und soziookonomisch schlecht gestelltem familiarem Hintergrund (vgl. OECD, 2010, S. 39-56). Details dazu im Anhang A ((Inequality on the rise, based on OECD, 2010).
Den Zusammenhang von sozialer Herkunft und Leistungsentwicklung im Kanton Zurich erforschte eine Langsschnittstudie (vgl. Bayard, 2014, S. 34-36) und kam zum Resultat, dass die Kinder aus sozial be- nachteiligter Herkunft mit weniger Vorwissen in die Schule eintreten und diesen Ruckstand bis zur sechsten Primarklasse aufholen konnen, denn in der Jugendzeit bleiben die Leistungsunterschiede kon- stant. In der Studienzusammenfassung (2014) wird deshalb gefolgert: «Das Ausmass und die Qualitat familiarer Unterstutzung und Forderung sind demnach vor allem im Vorfeld des Ubertritts in die Sekun- darstufe I bedeutsam (S. 34).» Interessanterweise ist die Unterstutzung jedoch nicht nurauf die Sprache bezogen, sondern auf die Lebenswelt der Schulkinder einer breiteren Bevolkerungsschicht, denn «lm Vergleich zur sozialen Herkunft wirken sich die Sprachkenntnisse aber weniger stark auf die Leistungsentwicklung aus» (S. 35).
Als Schule Ausserdorf in Winterthur mit einem Sozialindex von uber 112.4 (VSA, Sozialindex zur Berech- nung der VZE 2015/16) bedeuten die geschilderten Forschungsergebnisse, dass Handlungsbedarf im Bereich der Chancengleichheit aller Schulkinder besteht. Dabei geht es nicht um ein idealistisches Stre- ben zur Verbesserung der Welt, sondern es betrifft den Kernauftrag der Schule.
John Hatties Metastudie beschreibt im Zusammenhang mit dem Elternhaus die starksten Effekte (> 0.4 = wirkt gut) bezuglich der Schulerleistung (Klaus Zierer fasst diese themenorientiert zusammen und formuliert eine Interpretation, 2014, S. 44-50):
-Selbsteinschatzung des eigenen Leistungsniveaus 1.44
-Erkenntnisstufen nach Piaget 1.28
-Soziookonomischer Status des Elternhauses 0.52
Der Autor sieht als Konsequenzen, dass die Lehrpersonen versuchen, die Sprache der Eltern zu sprechen und diese gleichzeitig in die Verantwortung nehmen - eine intensive Kooperation ist unerlasslich. Ge- genuber den Schuler und Schulerinnen mit benachteiligter Herkunft sollen die Lehrpersonen beitragen, dass die Selbsteinschatzung mit der Selbstwirksamkeitsuberzeugung in Einklang kommt, damit das Ver- trauen gestarkt wird. Konkret: Der Unterricht soil dort anknupfen, wo das Ausgangsniveau des Schulkin- des liegt.
Hille und Muller (2009) formulieren im Zusammenhang mit lernpadagogischen Zugangen zur Unter- richtsentwicklung treffend: «Lernverstandnis: Lernende konstruieren sich die Welt. Sie lernen - vor ih- rem biografischen Hintergrund - selbst und standigw (S. 42).
Wenn aber die Personlichkeit des Schulkindes mit seinen inneren Uberzeugungen so leistungsrelevant ist, dann lohnt es sich, dort Energie zu investieren, wo die Kinder diesbezuglich ausserhalb des Schulbe- triebes am meisten beeinflusst werden: Durch die Eltern, in den Betreuungseinrichtungen und wahrend der Freizeitaktivitaten.
1.2 Projektziele
Durch die Erreichung der drei Projektziele wollen wir als Schule Einfluss nehmen im Sinne des Titels «Netzwerk des Lernens erweitern - ausserschulische Partner einbindenw:
-Die freiwillige Tagesschule sinnvoll gestalten, die Betreuung ins Schulgeschehen einbinden und das bestehende enge Netzwerk der Betreuungsleitungen zu den Eltern nutzen.
-Wir fordern die Mitwirkung der Eltern, indem wir sie in die Ausarbeitung und Umsetzung des neuen Schulprogrammes einbeziehen, sowie erweiterte Formen der Zusammenarbeit testen.
-Gezielt suchen wir den Kontakt zu lokalen Freizeitanbietern und Vereinen, um die Schule als Triage und Vermittlerin fur Freizeitaktivitaten zu nutzen.
1.3 Relevanz fur die lokale Schule
Schon im Schulprogramm der vergangenen vier Jahre setzten wir zwei Schwerpunkte gemass des fol- genden Aspekts aus dem Leitbild der Schule Ausserdorf (2011):
-«Gestaltung von Aussenbeziehungen: Gemeinsam mit den Eltern nehmen wir die Verantwortung fur die Entwicklung der Eltern wahr. Die Zusammenarbeit mit dem ausserschulischen Umfeld ist uns wichtig (S. 2).»
-«Wir gehen vertieft auf die Veranderungen der Schulerschaft ein und suchen den Dialog mit Kindern und Eltern aus alien Gesellschaftsschichten.w
-«Durch den Einbezug von Eltern und Schulern leiten wir Massnahmen ein, welche Respekt, Ei- genverantwortung und Mitsprache fordern.w
(Schulprogramm Schule Ausserdorf, 2011, S. 1)
Von den betroffenen Anspruchsgruppen und der Schulkonferenz wurden die Projektziele im weiterfuh- renden Sinne bestatigt furs neue Schulprogramm bis 2019.
Als Schule gehen wir die erwahnten Schwerpunkte systemisch und umfassend im Sinne der sieben We- senselemente einer Organisation von Glasl (2008, Abbildung 1) an. Im Folgenden einige exemplarische Konkretisierungen der Wesenselemente im Hinblick auf die Projektziele. Diese Grundhaltungen, Ab- machungen und Ablaufe bilden einen Teil des Fundaments unserer Schule zur Erreichung der genann- ten Projektziele. Sie entstanden uber die letzten Jahre gemeinsam als Schulteam zusammen mit den jeweiligen Anspruchsgruppen im Dialog.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1 - Die sieben Wesenselemente einer Organisation (Glasl, 2008, CAS SPG 04)
1.3.1 Wertebasiertes Zusammenleben
Basierend auf den Ansatz des losungsorientierten Arbeitens mit Kindern nach Insoo Kim Berg (2013), leben wir als Schulkonferenz im Unterricht, auf dem Schulareal und in den Betreuungsstatten nach Wer- ten (Abbildung 2) - dies anstelle von Regeln oder Verboten. Alle Eltern kennen die Wertesatze ebenfalls und wurden wahrend eines Besuchsmorgens informiert und interaktiv eingefuhrt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2 - Werte & Normen der Schule Ausserdorf(Betriebsreglement Ausserdorf, 2014)
1.3.2 Kompass des Informationsaustauschs an der Schule Ausserdorf
Zur Losungsfindung in herausfordernden Situationen mit Schulkindern informieren wir gegenseitig aktiv und suchen bei Bedarf den direkten Kontakt zu Personen aus dem ausserschulischen Umfeld der Kinder (vgl. Abbildung 3). Dabei stutzen wir uns auf Omer & von Schlippe (2015), welche davon ausgehen, dass die Schule unter anderem durch gemeinsame Prasenz gegenuber den Kindern und einer aktiven Vernetzung untereinander zu einer neuen Form von Autoritat gelangen, welche auf die Kraft der Beziehungen zueinander baut.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3 - Kompass des Informationsaustauschs (Betriebsreglement Ausserdorf, 2014)
1.3.3 Rollenverstandnis der Schulleitung
Klassenlehrpersonen schatzen es, wenn sie Zeit fur ihren Unterricht und dessen Gestaltung haben. Zu- satzliche Schulveranstaltungen sollten aus ihrer Sicht praxisbezogen und direkt anwendbar sein, sprich relevant. Aus der Perspektive des gesamten Schulteams - Betreuungsleitung, Heilpadagoginnen, Logo- padinnen, Schulsozialarbeiterin, Sonderpadagogische Assistenz etc. - bedeutet Relevanz jedoch umfas- senderes, analog zu den prufenden Fragen (Eikenbusch, 2012) was wirksame Schule ist: «Wahrten die Erfolge wirklich langfristig (langer als funf Jahre)? Wurden sie von mehr als der Halfte der Beteiligten mitgetragen und gelebt [...]? Haben sie den Kern von Schule - das Lernen und die Entwicklung der Schu- lerlnnen - erfasst (und nicht nur die Ausserlichkeiten)» (S. 30)?
Trotz partizipatorischer, geteilter Fuhrung bleibt die Schulleitung zustandig fur nachhaltige und lan- gerfristig relevante Aspekte der Schule. Diese Diskrepanz widerspiegelt sich passend in diesen beiden Aussagen was wirksame Schulleitung ausmacht (vgl. auch 2.1 Kommunikation):
«Fuhrung ist nicht Sache einer Einzelperson, sondern ergibt sich aus einem sozialen Beziehungs- und Interaktionsprozess, dessen Wirksamkeit durch das Engagement und die Beteiligung aller betroffenen Akteure bedingt ist» (Gather Thurler, 2014, S. 8).
«Der Schulleitung obliegt die Verantwortung die Organisation auf die Zukunft hin auszurichten, die Richtung vorzugeben, die zur Mitarbeit anregt und das Kollegium, die Schulerinnen und Schuler und die Eltern zu Beteiligten macht» (Schratz, 2010, S. 72).
1.4 Planungsubersicht
1.4.1 Die freiwillige Tagesschule sinnvoll gestalten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.4.2 Die aktive Mitwirkung der Eltern fordern
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.4.3 Der Aufbau von Freizeitworkshops in Kooperation mit lokalen Vereinen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2 Projektimplementation
2.1 Kommunikation
Aufgrund der Grosse und Komplexitat des Gesamtprojektes «Netzwerk des Lernens erweitern - ausser- schulische Partner einbindenw fand die Kommunikation gegenuber unseren 60 Mitarbeitenden an der Schule Ausserdorf Winterthur gezielt und nach Bedarf statt. Die Phasen lassen sich so darstellen:
a. Mehrfacher Gedanken- und Informationsaustausch zu den Projektzielen mit der Co- Schulleitung. Abgleich mit den Schwerpunkten des laufenden Schulprogrammes und Bedurf- nissen der Gesamtschule.
b. Kommunikation der geplanten Grobziele in der schulinternen Projektsteuerungsgruppe (inkl. Schulpflege) anhand einer vereinfachten Grafik (vgl. Anhang B).
c. Quartalsaustausch der Schulleitungen mit dem Elternratsprasidenten. Neustrukturierung der Zusammenarbeit (Abbildung 6).
d. Quartalsaustausch mit den drei Betreuungsleitungen der freiwilligen Tagesschule Ausserdorf. Information und Diskussion des Teilprojektes «Die freiwillige Tagesschule sinnvoll gestaltenw (vgl. 1.4.1). Gemeinsame Fokussierung auf die uberschneidende Thematik der Hausaufgaben. Klarendes Austauschgesprach zwischen Schulleitung, Betreuungsleitungen und vorgesetzter Person aus dem Schuldepartement und Beisitz der verantwortlichen Schulpflegerinnen. Vor- handene Problempunkte wurden verstanden und angenommen, sowie zusammen Losungsan- satze und Verantwortlichkeiten zugeteilt.
e. Koordination mit der Projektgruppe «Starkung der Kindergartenstufe» des Schulkreises mit dem Auftrag, Umsetzungsmoglichkeiten bezuglich des dritten Ziels des Teilprojektes «Die aktive Mitwirkung der Eltern fordernw (vgl. 1.4.2) zu diskutieren und prufen.
f. Kontaktaufnahme und Erfahrungsaustausch der Elternratsdelegierten mit den Klassenlehrpersonen zur Auslotung einer konkreten und vertieften Zusammenarbeit (vgl. zweites Ziel, 1.4.2).
g. Information des Sommerfestkomitees (Elternratsmitglieder, Lehrpersonen, Schulleitung) uber das Teilprojekt «Der Aufbau von Freizeitworkshops in Kooperation mit lokalen Vereinenw (vgl. 1.4.3) und Umsetzungsansatze des zweiten Ziels planen.
h. Formulierung des Gesamtelternrates wahrend der Schulprogrammplanung 2019, dass sich das Gremium Freizeitworkshops wunscht und diese aktiv als Eltern umsetzen mochte. Installation einer Konzeptgruppe fur eine Pionierphase im neuen Schuljahr.
i. Gezielte Aufnahme des IST-Zustandes bezuglich Hausaufgaben in den Betreuungsinstitutionen, sowie der schulinternen Aufgabenstunde mittels Interviews und eines Beobachtungsbogens. Kommunikation der Ergebnisse und des weiteren Vorgehens. Die Schulkonferenz nimmt das Thema ins neue Schulprogramm 2019 (vgl. Anhang C)
j. Der Eltern- und Schulerrat wird in die ersten drei Prozessschritte der Schulprogrammerarbei- tung 2019 gleichberechtigt involviert (vgl. erstes Ziel, 1.4.2).
Im Fokus dieser Kommunikationsschritte standen das Gesprach, die Diskussion, das Sammeln von Be- durfnissen und das ausloten des aktuellen Zustandes. Trotzdem fuhrten diese Phasen gleichzeitig auch zu Tatigkeiten oder sogar Entscheiden. Das Projekt verlauft also nicht linear von Planung zu Kommunikation und schliesslich der Umsetzung. Dies entspricht der Grundannahme, dass Wissen und entsprechen- des Handeln spiralformig aufgebaut werden, wobei das gegenseitige Erklaren, Miterleben und Reflektie- ren zentral sind (vgl. Nonaka & Takeuchi, 1997). In meiner Rolle als Leitung und Changeagent sehe ich mich vor allem als Koordinationsstelle im Sinne eines dialogischen Schulentwicklungsverstandnisses.
Bezeichnend hierfur steht der auf Nonaka (1997) hinweisende Begriff «middle up down», dessen Er- kennungsmerkmal so beschrieben werden konnte (Zala-Mezo, Strauss & Werder, 2015): «Nicht durch Kontrolle und Regeln sollten Koharenz und Konstanz geschaffen werden, sondern durch klare und intensive Kommunikation» (S. 32).
Insofern ist die Kommunikation das Bindeglied oder der Dreh-und Angelpunkt zwischen den konkreten Bereichen des Transfermodells von Jager (2004): Inhalt - Person - Struktur (Abbildung 4). Das nachste Kapitel schildert ausgewahlte Umsetzungsaktivitaten detaillierter unter Bezugnahme auf das Jagermo- dell.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4 - Transfermodell nach Jager 2004 (CAS SEI 05)
2.2 Umsetzende Handlungen und Aktivitaten
Als Gruppe des CAS Schulentwicklung International, trugen wir Faktoren zum Thema Schulentwicklung zwischen Erfolg und Frustration zusammen. Ein Kernpunkt kristallisierte sich heraus: Trotz guter und genauer Planung, muss man als Schulleitung und Steuergruppe achtsam bleiben, ob der Bedarf fur Akti- onen immer noch notwendig ist, ob genug Zeit zur Handlung und Verinnerlichung besteht und ob aus- reichend treibende Krafte vorhanden sind beziehungsweise der Ruckhalt im Team gewahrleistet ist (vgl. SEI 05 Modul 5 Fotoprotokoll, 2014). Fatzer (2001) stellt diese Gruppenerkenntnis anschaulich mittels der sieben Phasen der Veranderung dar (Abbildung 5), welche Grossteils mit Emotionen verbunden sind und deshalb haufig nur durch Achtsamkeit, Zuhoren und Hinschauen erkannt werden konnen. - Mit dem Bewusstsein als Changeagent, dass nicht nur die Akzeptanz der Veranderung moglich ist, sondern auch ein Ausstieg aus dem Prozess.
Dementsprechend gehen wir auch als Schule Ausserdorf spiralformig Schritt fur Schritt vor und in diesem Bericht werden nur ausgewahlte Umsetzungsschwerpunkte geschildert, welche bis anhin getatigt wurden. Zum einen aufgrund des nicht unbeschrankten Umfangs dieser schriftlichen Reflexion und zum andern, weil einige Teilziele noch nicht umgesetzt wurden (vgl. 1.4. Planungsubersicht).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5 - Die sieben Phasen der Veranderung nach Fatzer (CAS SEI 05)
2.2.1 Inhaltliche Relevanz und Zwischenstand
In den vorangegangenen Kapiteln 1.3 und 1.4 wurde ausfuhrlich beschrieben, warum und inwiefern die drei Teilprojekte fur die Schule Ausserdorf relevant und bedeutsam sind. Zumindest im jetzigen Zeit- punkt der Umsetzung bestatigen die betroffenen Anspruchsgruppen, dass sie die Ziele verstanden ha- ben und die Inhalte mittragen wollen. Nachstehend konzentriere ich mich darum auf den Stand der ex- pliziten Umsetzung im Vergleich zur Planungsubersicht (vgl. 1.4).
Inwiefern die Projektziele tatsachlich erreicht sind, wie dies feststellbar sein konnte und worin der sicht- bare Mehrwert oder Nutzen liegt, wird im Kapitel 3 «Projektevaluation» diskutiert.
2.2.1.1 Die freiwillige Tagesschule sinnvoll gestalten
- Alle Umsetzungspunkte wurden nach Plan durchgefuhrt.
- Zusatzlich unterstutzend wirkte die neue, offene Betreuungsvorgesetzte des stadtischen Schuldepartements, die Willens scheint, die Vorschlage aufzunehmen. Hemmend dem Gegen- uber stehen die massiven Sparmassnahmen Winterthurs, welche Innovation oder Zusatzres- sourcen momentan nicht erlauben.
2.2.1.2 Die aktive Mitwirkung der Eltern fordern
- Die ersten beiden Umsetzungspunkte konnten mehrheitlich nach Wunsch durchgefuhrt werden. Das gesamte Elternratsgremium hat mittels der Worldcafe-Methode Wunsche, Anliegen und Ideen zuhanden des neuen Schulprogrammes 2019 gesammelt und mehrere Delegierte vertraten diese wiederum wahrend der ersten beiden Schulprogrammschritte, sowie im Zwi- schenschritt in der Projektsteuerungsgruppe (vgl. Prozessablauf Anhang C). Diverse Eltern en- gagierten sich stark in ihren Klassen und brachten ihre Berufe und ihr Wissen direkt in den Un- terricht. Die Struktur und Aufgabenteilung von Schule und Elternrat wurden im Betriebsregle- ment verankert (Abbildung 6) und alien Beteiligten mundlich direkt kommuniziert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6 - Zusammenarbeit mit dem Elternrat (Betriebsreglement Ausserdorf, 2014)
- Die Installation von Eltern oder Grosseltern im Startquartal im Kindergarten erwies sich tat- sachlich als grosse Hurde und wurde von der schulkreisweiten Projektgruppe durch professio- nelle Assistenzen ersetzt. Damit ist der Bedarf jedoch nicht gedeckt und es ist den Schulleitun- gen uberlassen, in ihren Kindergarten auch andere Personen einzubeziehen, z.B. Eltern. Die Einzelgesprache mit den Kindergartnerinnen sind auf den Fruhsommerterminiert.
2.2.1.3 Der Aufbau von Freizeitworkshops in Kooperation mit lokalen Vereinen
- Seit einem halben Jahr ist die Konzeptgruppe fur den Aufbau von Freizeitworkshops installiert und plant mit einzelnen Eltern der Schule einige Pilotworkshops auf das neue Schuljahr 2015/16. Die Betreuungsleitungen haben Befurchtungen geaussert, dass sich die Workshops mit den betreuungseigenen Aktivitaten uberschneiden konnten oder als Konkurrenz verstan- den werden. Die Konzeptgruppe nimmt eine Betreuungsleitung mit in die Planungsgruppe und sucht nach losungsorientierten Wegen, wie die Pilotphase sinnvoll organisiert werden kann.
- Das Sommerfest befindet sich in der Planungsschlussphase und mindestens sechs lokale Ver- eine sind vor und /oder wahrend des Festes involviert.
2.2.2 Strukturen fur gemeinsame Entscheidungen
Im Kernbestreben des Projektes, ausserschulische Partner in das Netzwerk des Lernens einzubinden, erweisen sich die strukturellen Fragen als am schwierigsten zu beantworten. Alle Schlusselpersonen der drei Projektteile sind weder von der Schule bezahlt, noch uns unterstellt oder regelmassig anwesend.
- Wie konnen die Schlusselpersonen eng in Prozesse und Entscheidungen eingebunden werden?
- Die Betreuungsleitungen gehoren zwar zur Schulkonferenz, doch haben diese nach wie vor kei- ne zusatzlichen Ressourcen fur eine intensivere Zusammenarbeit. Gemeinsame Elterngesprache und Projekte gehen zu Lasten der eigentlichen Betreuungszeit. Wie lange bleiben die Schlusselpersonen motiviert?
- Der Elternrat trifft sich als Gremium viermal jahrlich, der Vorstand ebenfalls. Reicht diese An- zahl, um eine echte Mitwirkung der Eltern im Netzwerk des Lernens zu erreichen?
- Eltern, welche Freizeitworkshops anbieten und organisieren, tun dies unentgeltlich. Wie konnen sie mit den Vereinen Synergien finden und zu einer Art «Starthelfer» werden, dass die Kinder schlussendlich die lokalen Vereinsangebote nutzen?
Wie im Kapitel 2.1. (Kommunikation) erlautert, sehe ich mich als Koordinationsstelle fur spiralformig laufende Projektprozesse (vgl. Begriff «middle up down»). Deshalb bildet der (zu) seltene, aber regel- massige, mundliche Kontakt zu alien Schlusselpersonen die eigentliche Fuhrungsstruktur des Gesamt- projekts. Diese motivierten Projektpartner mochte ich als Beteiligte erhalten und ihr Expertenwissen schatzen und nutzen. So braucht es keine ubergeordnete Fuhrungsstruktur, sondern die Leitung bleibt hierarchisch flach und flexibel.
Gleichzeitig braucht es ein verbindliches Strukturelement, welches das Projekt unabhangig von ein- zelnen Schlusselpersonen macht und gegen innen und aussen zeitliche und teilweise auch finanzielle Mittel rechtfertigt. Das Schulprogramm 2019 scheint hierfur der richtige Ort zu sein. Auch die Fachstel- lenleiterin Elternmitwirkung und die Prasidentin der kantonalen Elternmitwirkungsorganisation Mulle & Kohler-Steinhauser (2014) formulieren die Anhorung und Involvierung der Eltern in die Schulprogram- merarbeitung als zentral. Sie sehen es gar als ideales Gefass fur echte und wertschatzende Mitwirkung der Eltern im Rahmen der schulischen Jahresprogramme (vgl. S. 10-11). Also weg von elternratlichen Zusatzprojekten, hin zur lernunterstutzenden Zusammenarbeit von Eltern und Schule, welche effektiv und gewinnbringend sein soil.
2.2.3 Personale Motivation und Kompetenz
In einem langerfristigen Projekt mit losen Organisationsstrukturen und geringer sofortiger Relevanz fur den Unterrichtsalltag besteht nur ein Weg zum Erfolg: Kompetente, interessierte, selbstandige und mo- tivierte Schlusselpersonen an den Verantwortungspositionen. Wie in der Planungsubersicht (vgl. 1.4.) unter den fordernden Faktoren beschrieben, erfullen die angesprochenen Personen die Voraussetzun- gen in einem hohen Mass und machen die Projektarbeit uberhaupt erst moglich. Im Verlauf des Prozes- ses zeigten sich auch Stolpersteine:
-Eine Betreuungsleitung kam in Konflikt mit mehreren Klassenlehrpersonen, weil beide Parteien die Kompetenzhoheit bei den Hausaufgaben fur sich in Anspruch nahmen, insbesondere in der Art, wie diese zu erfullen seien. Diese Reibung erzeugte auch Warme im ubertragenen Sinn, indem das Thema Hausaufgaben als wichtig und dringlich erachtet wurde und somit ins Schulprogramm 2019 einfloss.
-Der Elternratsprasident ubernahm beruflich in diesem Jahr mehr Verantwortung und hat weni- ger Zeitressourcen fur die Aufgabe als Elternratsprasident. Darunter leidet vor allem der Umset- zungspunkt, die Elternbildungskurse mit dem Unterricht oder auch schulinternen Weiterbildun- gen zu verknupfen. Dieser langfristige Planungsaufwand ist im Moment nicht zu leisten. Eine Starkung des Prasidenten konnte darin liegen, dem Vorstand mehr Kompetenz zu geben, so dass ein Mitglied fur diesen Planungsaspekt zustandig ist. Diesbezugliche Gesprache im Vorstand fin- den in den nachsten Monaten statt.
2.2.3.1 Motivationsunterstutzende Change-Management Strategien im Schulbetrieb
Generell stelle ich in den sieben Jahren als Leitungsperson der Schule Ausserdorf fest, dass die Motivation der Mitarbeitenden einer grossen Schule am hochsten ist, wenn berufliche Autonomie und aussere Sicherheit im Einklang sind. Personlichkeiten in padagogischen Berufen sehen sich traditionellerweise als selbstandige, kreative und intrinsisch motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen - dies ist auch real meistens so. Um diese positive Energie zu fordern, gestalten wir den Schulprogrammprozess aus- serst demokratisch, partizipatorisch und mit grosstmoglichem Spielraum. Auch das Jahresprogramm mit den konkreten Umsetzungsaktivitaten, Strukturen und dem in dieser Arbeit beschriebenen Projekt sind durch das Schulteam gewahlt und angenommen. Dies entspricht der Change-Management Strategic «white print», welche den Personen Raum lasst fur Spontanes und sich absichert durch Selbst-Management, sprich die erwahnte intrinsische Motivation (vgl. Caluwe & Vermaak, 2004, S. 15). Gleichzeitig braucht es im Sinne von Schratz (2010, vgl. 1.3.3) eine Schulleitung mit Weitsicht, welche den Handlungsrahmen definiert und den offen und autonom agierenden Mitarbeitenden verlasslich gegenubertritt. Die Schulleitung soil in ihrer Rolle Planungssicherheit geben, vorausschauend handeln und gute aussere Strukturen aushandeln gegenuber der Schulpflege, der Stadt oder dem Volksschul- amt. Die Strategic der Schulleitung ist in diesem Faile «blue print»: analytisch, rational, planvoll, vorausschauend, berechenbar (vgl. Caluwe & Vermaak, 2004, S. 9-18). Auch Dubs fordert diese Fuh- rungseigenschaften fur Schulleitende in seinem mundlichen Referat am Schulleitungssymposium in Zug (2013) vehement ein.
Aus meiner Sicht erganzen sich die beiden eigentlich gegensatzlichen Change-Management Strategien auf gute Weise, weil die Mitarbeitenden der Schule im operativen Bereich frei bleiben, denn sie wissen, dass die Schulleitung den Gesamtbetrieb im Auge hat und langfristig plant.
3 Projektevaluation
3.1 Theorie und personliche Haltung
Auch in diesem Prozessschritt ausserst sich das Dilemma von «blue print» versus «white print» (vgl. Caluwe & Vermaak, 2004) und des Managementansatzes von Dubs (2013) kontra dialogischer Schul- entwicklung «middle up down» (Zala-Mezo, Strauss & Werder, 2015). - Fachstellen und Schulleitungen suchen Fakten, fordern Kontrolle und wunschen Reflexion. Lehrpersonen schatzen Spontanes, agieren gerne autonom und empfinden administrate aufwandige Evaluationen oft als unnotig.
Nichts desto trotz wirkt es durchaus plausibel, Projekte und Schulaktivitaten zu reflektieren, auszuwer- ten und evaluieren. Besonders die Frage nach der Wirkung scheint zentral: 1st die Massnahme (Input & Output) tatsachlich die Ursache fur das Ergebnis (Outcome)? Als Schule konnen und wollen wir in der Regel valide Methoden zur Ermittlung der Nettowirkung nicht anwenden. Eine Ausnahme bildet die externe Schulevaluation mit ihrem Angebot der Fokusevaluation im Zusammenhang mit der Reflexion CAS SEI Netzwerk des Lernens erweitern des vierjahrlichen Schulprogrammes. Dort konnen die zwolf Schritte der «Evaluationsuhr» (Abbildung 7, Leuthard nach Kriterien von IQES, 2014) ihre Anwendung finden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7 - Evaluationsuhr nach IQES Kriterien (Leuthard CAS SEI 05)
Personlich sehe ich in der Regel drei sinnvolle Evaluationsmethoden im operativen Schulalltag:
- Eine einfache quantitative Datenerhebung mittels geschlossener Fragen oder Skalen zu einem Schulalltagsthema, kann eine sachliche Grundlage fur eine Einstiegsdiskussion geben. Diese Fak- ten geben einen ersten Hinweis auf offene Fragen: 1st das Thema wichtig? Interessiert es eine grosse Zahl der Mitarbeitenden? Wie dringend empfinden die Personen eine Losungssuche?
- Ein quasi experimentelles Evaluationsdesign in Form einer Pioniergruppe und einer vergleich- baren, vorhandenen Gruppe ist praxisnah und auch im Changeprozess sinnvoll. Einige Lehrpersonen probieren mit ihren Klassen etwas Neues aus und berichten im Plenum nach zwei Monaten uber Erfolge und Probleme. Eine einfache Methode als Antwort auf weiterfuhrende Fragen: Bringt das Neue etwas? Wenn ja, was genau? Wie intensiv ist die Umsetzung? Welche Ressourcen sind notwendig?
- Anhand von standardisierten Online-Umfrageplattformen (IQES oder Surveymonkey) beant- worten die von einem Anlass oder Projekt betroffenen Personen elektronisch wenige, klare Fragen zuhanden der Projektleitung. Vorteile: So wird eine breite Meinung effizient abgeholt und die Entscheidung im weiteren Umgang mit den Resultaten liegt bei der Projektgruppe.
3.2 Exemplarische EvaluationsplanungeinesTeilprojektes
«Die freiwillige Tagesschule sinnvoll gestaltenw ist gemass Planungsubersicht (1.4.1) das einzige abge- schlossene Teilprojekt und eignet sich deshalb zur exemplarischen Darstellung der Evaluationsplanung mit einigen ersten Resultaten.
3.2.1 Angewandte Evaluationsmethode
Bei der Erhebung handelt es sich um komplexe Daten mit einfacher Analyse. Die Erfolgs- und Verhal- tensanalyse anhand des Outputs (sichtbare und geplante Angebote, Anlasse, Leistungen) und des Outcomes (veranderte Effekte, Zielerreichung) sollen interpretierbare Resultate liefern. Ziel ist die Steige- rung des Outputs und Outcomes gegenuber dem Zustand im Schuljahr 2013/14. Messinstrumente sind die vorhandenen Protokolle und teilweise kurze IQES-Umfragen. Die geplante Vorgehensweise sieht so aus: Zwischenanalyse durch eine IQES-Umfrage 2016 und 2017 uber die Erreichung der formulierten Indikatoren mittels geschlossener Fragen bei Klassenlehrpersonen und den Betreuungsleitungen im Vergleich mit dem Zustand 2013 (anhand von bestehenden Fakten, Interviewdaten, Stimmungen und Outputs).
3.2.2 Ziele Indikatoren Datenquelle & Vorgehen Auswertung -> Erste Resultate
Wie im Untertitel ersichtlich erfolgt die Darstellung des Evaluationsprozesses farblich gekennzeichnet diagrammartig:
1. Die Kommunikation zwischen Betreuung und Schule fordern.
Gemass dem internen Informations-Kompass (Abbildung 3) pflegen die Betreuungsleitungen regelmassigen Austausch mit Lehrpersonen, Eltern, Schulleitung und involvierten Fachstellen.
Teilnahme der Betreuungsleitungen: Interdisziplinaren Fachteam auf Einladung / Allen acht Schulkonferenzen / Quartalsaustausch mit Schulleitungen
Prasenzanalyse anhand der Sitzungsprotokolle
Die bisherige Prasenz im Schuljahr ist bei der Betreuung Eulach vollstandig. Durch die Doppelleitung und Schwangerschaft der Leitung Linde gab es Absen- zen, doch die Entwicklung verlauft positiv.
2. Bei komplexen Elterngesprachen, mit gemeinsamen Anliegen, die Betreuungsleitungen einbezie- hen.
Die Betreuungsleitungen nehmen an alien Schulischen Standortgesprachen ab der Forderstufe 3 teil, sofern uberschneidende Themen zur Diskussion stehen.
Die Betreuungsleitung hat Kenntnis von Massnahmen und ubernimmt Teilverantwortun- gen in Absprache mit Fachstellen und alien Beteiligten, festgehalten im Standardprotokoll.
Sichtung aller Standortgesprachsprotokolle Ende Schuljahr 2015 und 2016. Kriterium: Haben sich die Ubernahme von Verantwortung und die gemeinsamen Massnahmen von Schule und Betreuung erhoht gegenuber 2013-14?
In diesem Schuljahr hat sich die Teilnahme an SSG's stark erhoht und ver- mehrt hore und lese ich von tollen Erfolgen aufgrund gemeinsamer Verantwor- tungsubernahme (vgl. Omer & von Schlippe, 2015, Kapitel 1.3.2).
3. Projekte und Anlasse verknupfen und gemeinsam organisieren.
Die folgenden Anlasse sind gemeinsam gestaltet und inhaltlich verbunden: Gemeinsamer El- terninformationsabend / Samichlausevent / Projektwoche / Sommerfestaktivitaten Elterninformationsabend: durchgefuhrt / Samichlausevent: Doppelt so hohe Teilnahme von Personen, welche nicht regular in der Betreuung sind / Ubernahme eines Workshops wahrend der Projektwoche / Leitung eines Aktivitatsstandes am Sommerfest und bei alien Vorberei- tungsanlassen vertreten.
Outputfakten analysieren Elternabend, Samichlaus und Projektwoche sind mit angestrebtem Outcome erreicht und das Projekt Sommerfest verlauft planmassig.
4. Die Betreuungsleitungen klaren ihre Rolle, Verantwortlichkeiten und Ansprechpersonen mit dem Departement Schule und Sport unter Moderation der SL.
An einem Gesprach mit der Vorgesetzten aus dem DSS, der zustandigen Schulpflegerin, alien Betreuungsleitungen und den beiden Schulleitern formulieren wir, was unsere Ziele sind, wo wir stehen in der Zusammenarbeit und welche Klarungen und Ressourcen aus unserer Sicht notwen- dig sind.
Die Anliegen sind verstandlich formuliert und die Verantwortungstragerinnen der Schul- pflege und des Departements vertreten die Bedurfnisse gegenuber ihren Kontaktstellen.
Inputvergleich: Haben sich die durch KSP und DSS investierten Ressourcen in die Zusammenarbeit von Betreuungsleitung und Schule gesteigert?
IQES-Umfrage (geschlossene Fragen & Skalen): Hat sich die Zusammenarbeit subjektiv aus individueller Sicht der Klassenlehrpersonen und den Betreuungsleitungen verbessert und auch gelohnt?
Sehr erfreuliche Reaktionen der Verantwortungstragerinnen und Unterstut- zung des Anliegens durch formulierte Legislaturziele der Zentralschulpflege. Res- sourcenerhohung ist denkbar. Die neue Leitung DSS ist offen und kooperativ (vgl. Gesprachsfotoprotokoll Anhang E).
3.2.3 Aufgezeigtes Hauptproblem durch erste Evaluationsresultate
Die intensivere Zusammenarbeit aller Beteiligten im Teilprojekt «Die freiwillige Tagesschule sinnvoll gestalten» ist nicht im regularen Zeitbudget des Berufsauftrages einkalkuliert.
Folgende Losungsansatze sind realistisch mittelfristig in Aussicht:
- Schulleitung: Pensenerhohung aufgrund des Berufsauftrages LP um 25%. Dies wird auf August 2015 bereits Realitat.
- Betreuungsleitung: Ressourcen durch neue DSS-Leitung und erhohten Druck durch politische Legislaturziele sind denkbar. Durch meinen Einsitz im Lenkungsausschuss der Zentralschulpflege zu den Bildungslegislaturzielen der Stadt Winterthur, kann ich diesbezuglich Einfluss nehmen.
- Klassenlehrpersonen: Der Berufsauftrag mit einer Zeiterfassung ab 2017 macht eine offene Diskussion und Prioritatensetzung mit den Klassenlehrpersonen moglich.
4 Reflexion und personlicher Ruckblick
4.1 Kritische Reflexion des Projekts
Uberzeugend finde ich den Projektansatz nach wie vor.
Bei den praxisnahen Aspekten ziehen die Mitarbeitenden gut mit, zum Beispiel beim Uberdenken der Hausaufgaben zusammen mit den Schulkindern und Eltern. Gerade diese Thematik war dem Team seit einigen Jahren ein eher diffuses Anliegen. Im Rahmen der neuen Zusammenarbeit mit der Betreuungs- leitung wurde das Problem fassbarer und dementsprechend auch dringlicher. Dem Gegenuber weckte die Idee, Grosseltern und Eltern in den Unterricht regelmassig einzubeziehen erstauntes Interesse, doch umsetzen mochte es bis anhin niemand. - Das kurze Muster bestatigt meinen Gesamteindruck.
Tatsachlich ist das Projekt uberall dort ein Erfolg und nahezu reibungslos implementiert, wo die ge- meinsamen Haltungen als Basis vorhanden waren und Ansatze davon schon vorher bestanden hatten. Im CAS-Modul nannten wir diese Feststellung «low hanging fruits». Das meint, Schulentwicklung dort anzusetzen, wo die symbolischen Knospen sichtbar sind und die Umsetzung greifbar scheint. Um ei- nen echten Transfer eines vollig neuen Themas in die eigene Schule zu vollziehen, braucht es einen grossen Teil des Schulteams mit den gleichen Erfahrungen, demselben Knowhow, der gleichen Leiden- schaft. - Eine von zwei Schulleitungen, die durch internationale Schulbesuche fasziniert ist, reicht fur einen Transfer von Ideen mit erforderlichen Paradigmenwechseln nicht aus!
4.2 Personlicher Ruckblick
4.2.1 Das Projektmanagement
Analog zur Projektreflexion empfand ich die Leitung des Projekts im Gleichschritt zum Ablauf des CAS- Lehrgangs oft kunstlich und nicht ganz passend zum naturlichen Tempo in der eigenen Schule. Wie in den Kapiteln (2.1. & 2.2) zur Kommunikation und den einleitenden Gedanken zu den umsetzenden Akti- vitaten erlautert, sind Achtsamkeit, passendes Timing und die Offenheit gegenuber Anderungen oder Anpassungen entscheidend. Gerade diese Elemente waren kaum umzusetzen, da der Projektablauf durch externe Rahmenbedingungen strukturiert war.
Gleichzeitig musste ich in diesem Projekt lernen, wirklich offen fur kritische Meinungen zu sein und flexibel zu reagieren, da mir bewusst war, dass Teile des Projekts auch auf andere fremd oder kunstlich wirken konnten. Parallel zur breit angelegten Schulprogrammerarbeitung mit kaum Rahmenbedingungen (vgl. «white print», 2.2.3.1) sprang ich oft uber meinen eigenen Schatten («blue print» in der Schulleitungsrolle und auch als Mensch) und war am Ende positiv erstaunt, wie ungefahrlich Frei- raum ist und wie gut sich ein grosses Team gegenseitig auf gesunde Weise ausnivelliert in einer Art von Schwarmintelligenz.
4.2.2 Gesamtruckschau auf den CAS
Das Kennenlernen von einzelnen Schulen und ganzen Schulsystemen in den Niederlanden, in Lichtenstein und auch teils aus Estland war horizonterweiternd, inspirierend und anregend fur eigene Schulin- novationen. Erstaunlich zu sehen, wie unterschiedlich eine lehrreiche Schule gestaltet werden kann und dies in stark variierenden Umfeldern.
Der Lehrgang gab mir Mut und Lust, die Schule in den nachsten Jahren anhand von Neuerungen wie dem Berufsauftrag fur Lehrpersonen, der Kompetenzorientierung, der Inklusion und dem Lehrplan 21 zu uberdenken und aktiv zu gestalten - immer mit dem Kind im Fokus.
5 Verweisangaben
5.1 Literatur
5.1.1 Sammelbande
- Eikenbusch, Gerhard/ Kuhlke, Rainer/ Schonenberger, Rolf (2012): Resumees von sieben Schul- leiterinnen aus Deutschland, Osterreich und der Schweiz. In: Daschner, Peter (Hrsg.) (2012). In: journal fur schulentwicklung, 16 (2012) 3, S. 29-36.
- Hille, Katrin / Muller, Andreas (2009): Menschen sind lernfahig - aber unbelehrbar: Lernpadago- gische Zugange zur Unterrichtsentwicklung. In: Rolff, Hans-Gunter / Rhinow, Elisabeth / Rohrich, Theresa (Hrsg.) (2009): Unterrichtsentwicklung - Eine Kernaufgabe der Schule. Die Rolle der Schulleitung fur besseres Lernen. Koln: Wolters Kluwer Deutschland GmbH, S. 41-42.
5.1.2 Monografien
- Bayard, Sybille (2014): Nach neun Jahren Schule. Entwicklung der schulischen Leistungen von Schulerinnen und Schulern im Kanton Zurich wahrend der obligatorischen Schulzeit. Zurich: Bil- dungsdirektion Kanton Zurich
- Caluwe, Leon de / Vermaak, Hans (2004): Change Paradigms: An Overview. Organization Development Journal, 22 (2004) 4, S. 9-18.
- Fatzer, Gerhard (2001): Lernende Organisation und Dialog als Grundkonzepte der Personalentwicklung. Hohengehren: Schnieder Verlag
- Gather Thurler, Monica (2015): Zur Philosophic und Empirie der Fuhrung. In: journal fur schulentwicklung, 18 (2014) 2, S. 7-14.
- Glasl, Friedrich: 7 Basisprozesse der Organisationsentwicklung. Trigon Seminarunterlagen. PHZH Zurich: Unterrichtsunterlagen FBO 15
- Jager, Michael (2004): Transfer in Schulentwicklungsprojekten. Wiesbaden: VS Verlag fur Sozi- alwissenschaften
- Kim Berg, Insoo / Steiner, Therese (2013): Handbuch losungsorientiertes Arbeiten mit Kindern. 6., unveranderte Auflage. Heidelberg: Carl Auer Verlag
- Kohler-Steinhauser, Gabriela / Mulle, Maya (2014): So gelingt die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der Schule. Sechs Kriterien fur eine erfolgreiche Elternmitwirkung. In: ZLV-Magazin, (2014) 4, S. 10-11.
- Nonaka, Ikujiro / Takeuchi, Hirotaka (1997): Die Organisation des Wissens. Wie japanische Un- ternehmen eine brachliegende Ressource nutzbar machen. Frankfurt/Main: Campus Verlag GmbH
- OECD (2010): Trends shaping education 2010. OECD: Centre for Educational Research and Innovation
- Omer, Haim / von Schlippe, Arist (2015): Starke statt Macht. Neue Autoritat in Familie, Schule und Gemeinde. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG
- Schratz, Michael / Hartmann, Martin / Schley, Wilfried (2010): Schule wirksam leiten. Analyse innovativer Fuhrung in der Praxis. Munster: Waxmann Verlage GmbH
- Schulleitungssymposium (2013): Fachtagung zu Schulqualitat, Schulentwicklung, Schulmanage- ment. Herausforderungen und Chancen fur Schule und padagogische Fuhrung. Referat von Rolf Dubs. Zug
- Volksschulamt Kanton Zurich (2015): Sozialindex 2015_16 VZE-1. Zurich: Bildungsdirektion Kanton Zurich
- Zala-Mezo, Eniko / Strauss, Nina-Cathrin / Werder, Bettina Diethelm (2015): Prinzip „middle up down": jenseits von „top down" oder „bottom up". In: journal fur schulentwicklung, 19 (2015) 1, S. 29-36.
- Zierer, Klaus (2014): Hattie fur gestresste Lehrer. Kernbotschaften und Handlungsempfehlungen aus John Hatties ^Visible Learning" und ^Visible Learning for Teachers". Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren
Schulinterne Dokumente der Schule Ausserdorf
- Brauchli, Hansjurg (2014): Betriebsreglement der Schule Ausserdorf. Winterthur: Schule Ausserdorf
- Spiess, Roger (2011): Leitbild. Winterthur: Schule Ausserdorf
- Spiess, Roger (2011): Schulprogramm 2011 - 2015. Winterthur: Schule Ausserdorf
5.2 Grafiken
1 Die sieben Wesenselemente einer Organisation (Glasl, 2008, CAS SPG 04)
2 Werte & Normen der Schule Ausserdorf (Betriebsreglement Ausserdorf, 2014, S. 9)
3 Kompass des Informationsaustauschs (Betriebsreglement Ausserdorf, 2014, S. 19)
4 Transfermodell nach Jager 2004 (CAS SEI 05, Modul 4)
5 Die sieben Phasen der Veranderung nach Fatzer 1993 (CAS SEI 05, Modul 5)
6 Zusammenarbeit mit dem Elternrat (Betriebsreglement Ausserdorf, 2014, S. 15)
7 Evaluationsuhr nach IQES Kriterien (Leuthard CAS SEI 05)
6.2 Anhang B
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6.3 AnhangC
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6.4 Anhang D
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6.5 Anhang E
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Projekts "Netzwerk des Lernens erweitern - ausserschulische Partner einbinden"?
Das Projekt konzentriert sich auf die Erweiterung des Lernnetzwerks der Schule durch die Einbindung ausserschulischer Partner, um die Chancengleichheit der Schulkinder zu verbessern und ihre Entwicklung zu fördern. Es beinhaltet die sinnvolle Gestaltung der freiwilligen Tagesschule, die Förderung der Elternmitwirkung und den Aufbau von Freizeitworkshops in Kooperation mit lokalen Vereinen.
Welche Projektziele werden in diesem Projekt verfolgt?
Die drei Hauptziele sind: 1. Die sinnvolle Gestaltung der freiwilligen Tagesschule und die Einbindung der Betreuung ins Schulgeschehen. 2. Die Förderung der aktiven Mitwirkung der Eltern durch die Einbeziehung in die Ausarbeitung und Umsetzung des neuen Schulprogrammes. 3. Die gezielte Kontaktaufnahme zu lokalen Freizeitanbietern und Vereinen, um die Schule als Vermittlerin für Freizeitaktivitäten zu nutzen.
Welche Relevanz hat das Projekt für die lokale Schule?
Das Projekt ist relevant, da es auf den Schwerpunkten des Schulprogramms basiert, die Gestaltung von Aussenbeziehungen, die Auseinandersetzung mit den Veränderungen der Schülerschaft und die Förderung von Respekt, Eigenverantwortung und Mitsprache beinhalten.
Welche Massnahmen zur Kommunikation werden im Rahmen der Projektimplementation ergriffen?
Die Kommunikation erfolgt gezielt und bedarfsgerecht gegenüber den Mitarbeitenden der Schule. Die Phasen umfassen den Austausch mit der Co-Schulleitung, die Information der Projektsteuerungsgruppe, den Quartalsaustausch mit dem Elternratspräsidenten und den Betreuungsleitungen, die Koordination mit der Projektgruppe "Stärkung der Kindergartenstufe", die Kontaktaufnahme der Elternratsdelegierten mit den Klassenlehrpersonen und die Information des Sommerfestkomitees.
Welche Herausforderungen gibt es bei der Umsetzung des Projekts?
Zu den Herausforderungen gehören die strukturellen Fragen der Einbindung ausserschulischer Partner, die nicht direkt der Schule unterstellt sind, die Gewährleistung ausreichender Ressourcen für die Betreuungsleitungen, die Sicherstellung einer echten Mitwirkung der Eltern und die Findung von Synergien zwischen Eltern, Vereinen und der Schule.
Welche Evaluationsmethoden werden zur Beurteilung des Projekts verwendet?
Es werden verschiedene Evaluationsmethoden angewendet, darunter einfache quantitative Datenerhebungen, quasi-experimentelle Designs in Form von Pioniergruppen und standardisierte Online-Umfrageplattformen.
Welches Hauptproblem wurde durch die ersten Evaluationsresultate aufgezeigt?
Das Hauptproblem ist, dass die intensivere Zusammenarbeit aller Beteiligten im Teilprojekt "Die freiwillige Tagesschule sinnvoll gestalten" nicht im regulären Zeitbudget des Berufsauftrages einkalkuliert ist.
Was sind die Schlussfolgerungen aus der kritischen Reflexion des Projekts?
Das Projekt ist dort erfolgreich, wo gemeinsame Haltungen als Basis vorhanden waren und Ansätze davon schon vorher bestanden hatten. Für einen echten Transfer eines völlig neuen Themas braucht es einen grossen Teil des Schulteams mit den gleichen Erfahrungen, demselben Know-how und der gleichen Leidenschaft.
- Quote paper
- Roger Spiess (Author), 2015, Netzwerk des Lernens erweitern und ausserschulische Partner einbinden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1301074