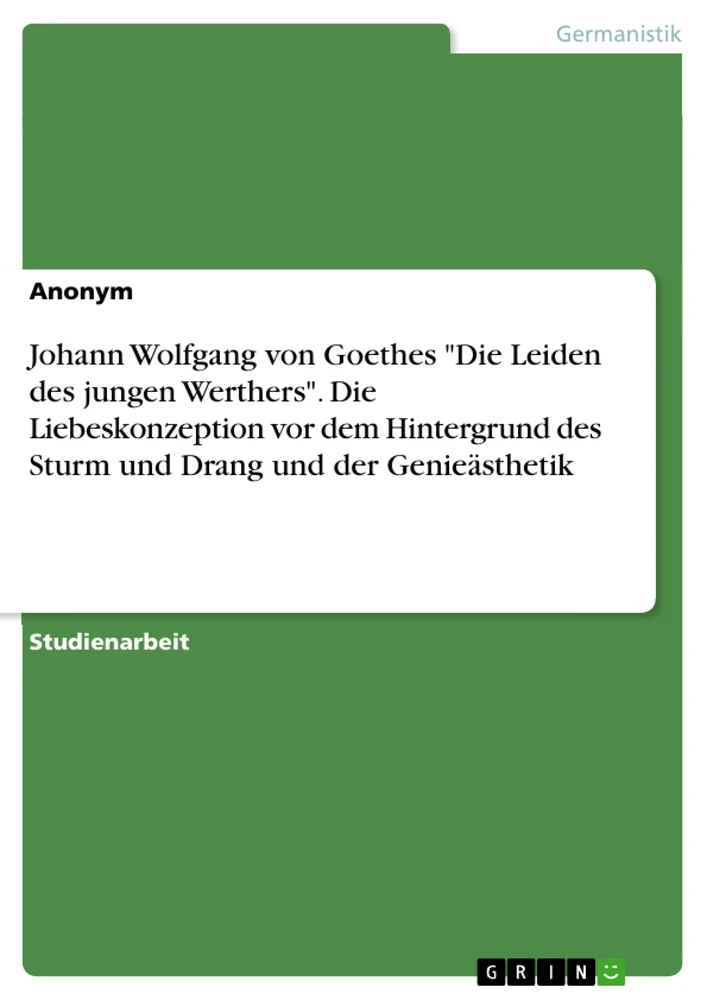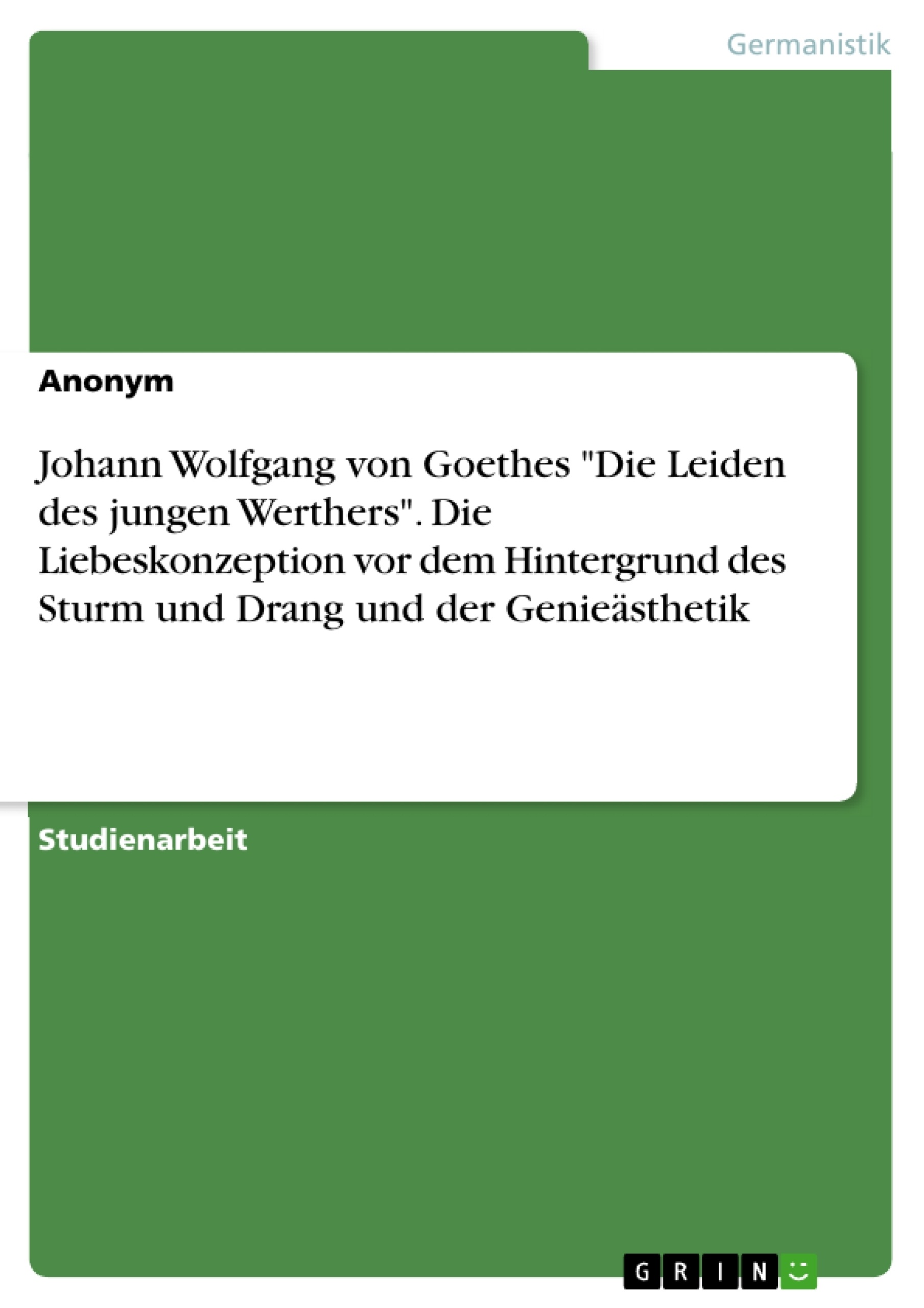Das Interesse der vorliegenden Arbeit liegt in der Frage, inwieweit die Liebesauffassung, die Johann Wolfgang von Goethes Werther vertritt, der des Geniekonzepts entspricht, oder anders formuliert: Liebt Goethes Werther genialisch? Goethes erster Roman "Die Leiden des jungen Werthers" hatte bereits kurz nach Erscheinen einen Erfolg, wie ihn nur wenige Romane für sich beanspruchen können. Die unglückliche Liebe des Werther zur verlobten Lotte, die Verzweiflung des Liebenden und der Selbstmord haben die Gemüter der zeitgenössischen Leser, insbesondere der jungen, heftig bewegt.
Am Thema allein liegt dies allerdings nicht, denn das Motiv der unglücklichen Liebe begleitet die europäische Literatur seit ihren Anfängen. Was Werther als unglücklichen Liebenden besonders macht, sind verschiedene Komponenten: Die Konzeption seiner Liebe ebenso wie die Tatsache, dass es sich um einen Briefroman handelt, die Einsamkeit des melancholischen Genies, die Auflehnung gegen die Regeln der Gesellschaft und die Intimität, mit der die Gefühle Werthers beschrieben werden, gehören sicher dazu.
Goethe hat mit seinem Roman und mit seiner Figur des Werther offenbar den Nerv der Zeit getroffen. Die Romanhandlung geht teilweise zurück auf eigene Erlebnisse, wie die Liebe zur verheirateten Charlotte Buff, auf den Selbstmord des Karl Wilhelm Jerusalem , über den sich Goethe informierte. Sie entspricht aber auch den aktuellen Tendenzen der jungen Autoren, die im Sturm und Drang eine literarische Strömung prägten, die sich gegen das Diktat der Aufklärung auflehnte und den Gefühlen ebenso wie der neuen Genieästhetik verpflichtet war.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen
- 2.1 Die Epoche des Sturm und Drang
- 2.2 Genieästhetik und Liebeskonzeption im Kontext des Sturm und Drang
- 3. Liebe und Genie in den Leiden des jungen Werthers
- 3.1. Unerreichbarkeit durch Tod: Werthers erste Liebe
- 3.2 Unerreichbarkeit als Voraussetzung und Verhängnis: Werthers Liebe zu Lotte
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Goethes Roman "Die Leiden des jungen Werthers" im Kontext der Epoche des Sturm und Drang und der Genieästhetik. Das Hauptanliegen ist es, die Liebeskonzeption in Goethes Roman vor diesem Hintergrund zu analysieren und zu beleuchten, inwieweit Werthers Liebesauffassung dem Konzept des Genies entspricht.
- Emanzipation des Individuums und der Gefühle
- Genieästhetik und ihre Bedeutung für die Liebeskonzeption
- Die Rolle der Liebe im Kontext der Auflehnung gegen die gesellschaftlichen Normen
- Die Autonomie der Liebe als Ausdruck des individuellen Ichs
- Die metaphysische Überhöhung der Liebe im Sturm und Drang
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Goethes "Die Leiden des jungen Werthers" vor und beleuchtet die Relevanz des Romans im Kontext der Epoche des Sturm und Drang. Kapitel 2 führt den Leser in den theoretischen Rahmen ein, der die Epoche des Sturm und Drang sowie die Genieästhetik umfasst. Kapitel 3 analysiert die Liebeskonzeption in Goethes Roman, indem es Werthers erste Liebe und seine Liebe zu Lotte in den Fokus nimmt. Es werden die Ursachen für die Unerreichbarkeit der Liebe sowie die Folgen der unerfüllten Liebe untersucht.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Sturm und Drang, Genieästhetik, Liebeskonzeption, Individualität, Autonomie, Liebe, Gefühle, Gesellschaft, Unerreichbarkeit, Tod, "Die Leiden des jungen Werthers", Goethe.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Johann Wolfgang von Goethes "Die Leiden des jungen Werthers". Die Liebeskonzeption vor dem Hintergrund des Sturm und Drang und der Genieästhetik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1301047