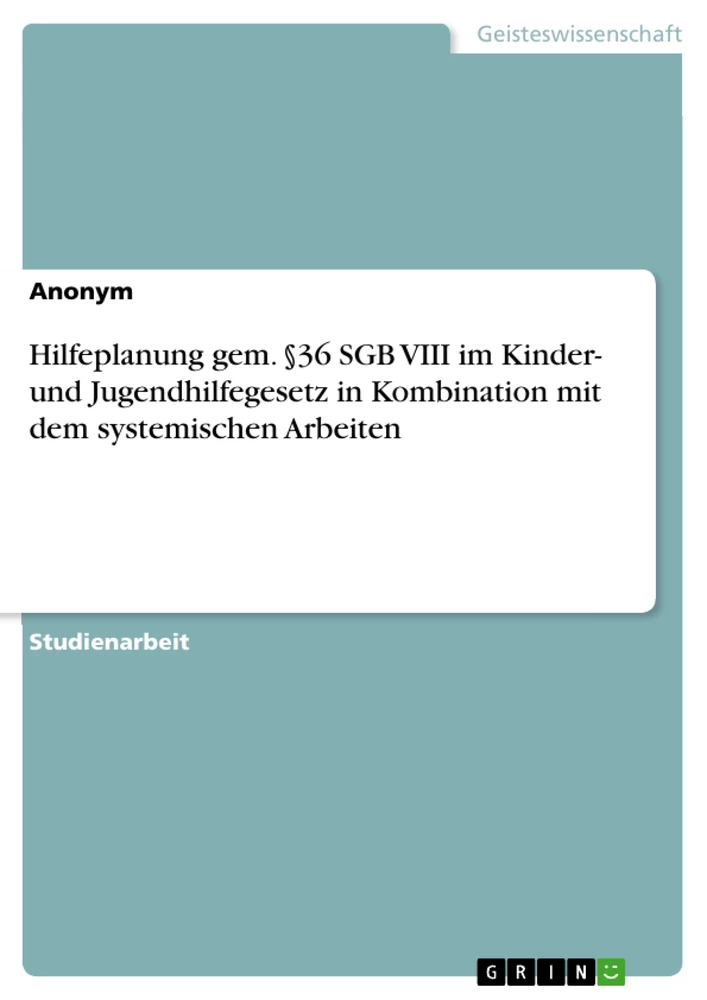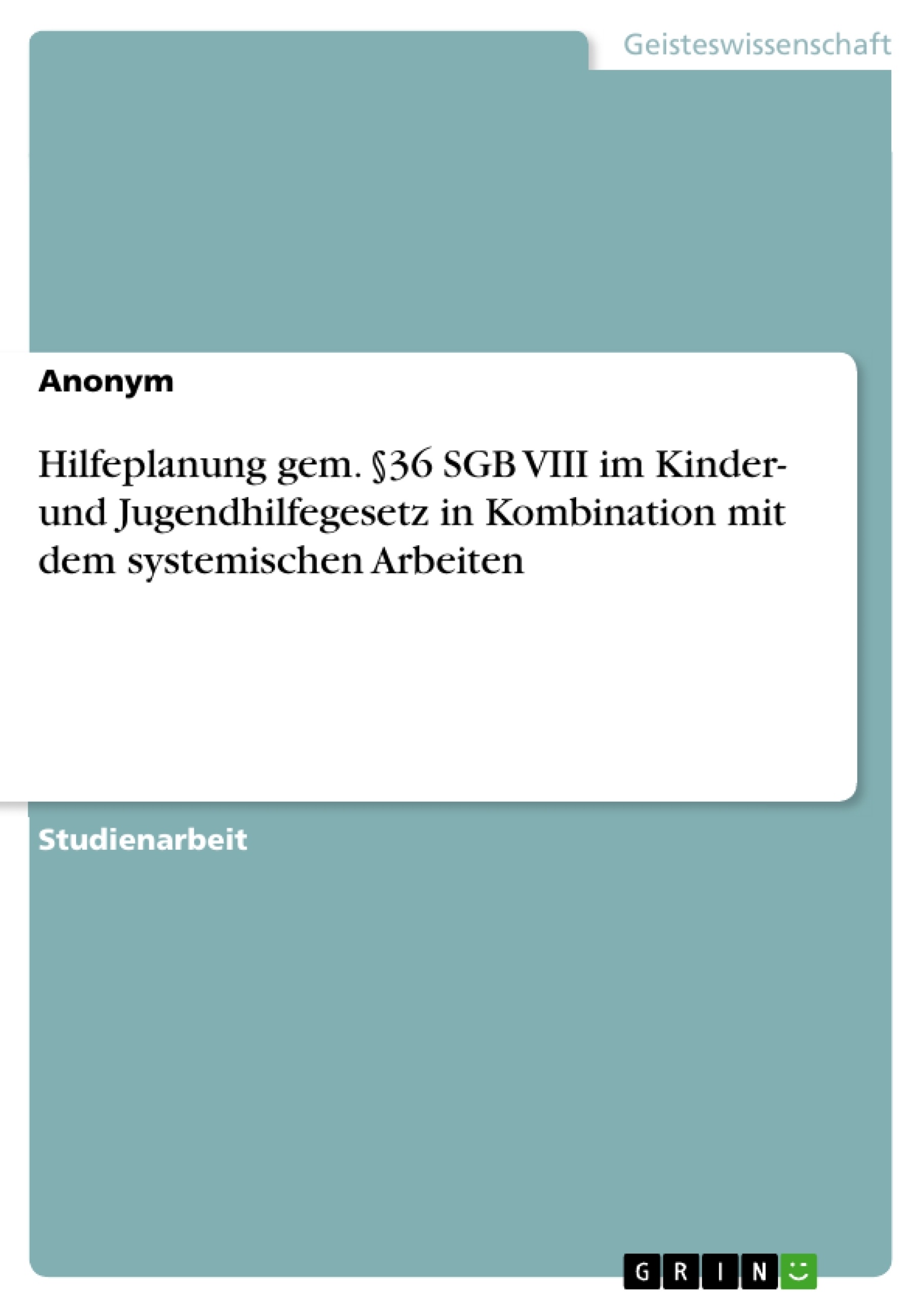Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit thematisiert den Hilfeplan nach §36 SGB VIII, der im Kinder- und Jugendhilfegesetz verankert ist. Die Fragestellung beschäftigt sich damit, wie der Hilfeplan mit dem systemischen Arbeiten kombinier- und umsetzbar ist.
Das KJHG ist 1991in Kraft getreten und hat dort die Hilfen zur Erziehung (HzE) und den Hilfeplan definiert. Die Voraussetzungen und Rahmenbedingen haben sich seitdem enorm ausgeweitet und ausdifferenziert. Fast eine Million junger Menschen werden durch HzE begleitet und erfahren in einer wichtigen Phase ihres Lebens Unterstützung. Die Tendenz zur Inanspruchnahme der Hilfe ist ansteigend. Wabnitz (2014) führt mehrere Faktoren als mögliche Gründe für den Zuwachs an Hilfen zur Erziehung an. Zum einen sind es die Pluralisierungen der Familienformen und heiklen Lebenslagen von Familien, geprägt durch Trennungen, Arbeitslosigkeit, Wohnraumproblemen oder ähnlichem. Auf der anderen Seite sind es gesellschaftliche und politische „Diskurse“, wie der des „achtsameren Staats“ oder der ausgeübte Druck auf die Fachkräfte, die Hilfe zu Erziehung veranlassen. Menschen sind keine Maschinen und alle haben ihre persönlichen Hintergründe, deswegen ist der Hilfeplan „so schwierig umzusetzen“.
Der erste Abschnitt legt den Fokus auf den §36 Mitwirkung, Hilfeplan SGB VIII. Dafür werden die Voraussetzungen des Inkrafttretens und die Inhaltlichen Schwerpunkte vorgestellt. Außerdem wird aufgezeigt, in welchen Bereichen der Hilfeplan seine Anwendung findet. Um einen Überblick über die Grundbegriffe zu verschaffen, werden diese anschließend definiert. Im zweiten Abschnitt erfolgt eine Auseinandersetzung mit den individuellen Qualitätsmerkmalen, wie die Partizipation oder die Ressourcen- und Sozialraumorientierung eines Hilfeplans. Diese Merkmale sind der Grundstein, um den Hilfeplan mit dem systemischen Arbeiten in Verbindung zu setzen. Der dritte Abschnitt stellt den Hilfeplan als einen pädagogischen Prozess dar und beinhaltet die vier Phasen, die in jedem Prozess durchlaufen werden. Der vierte Abschnitt zeigt die Schnittmenge zwischen Hilfeplan und systemischer Arbeit auf und nimmt dabei Bezug auf die vorangegangenen Abschnitte. Das Fazit ergibt sich aus einer zusammenfassenden Betrachtung der wichtigsten Ergebnisse dieser Hausarbeit sowie einem Ausblick für zukünftig mögliche und notwendige Entwicklungen des Hilfeplans.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hilfen zur Erziehung
- Rechtliche Grundlagen
- Grundbegriffe
- Qualitätsmerkmale
- Partizipation
- Ressourcenorientierung
- Zielorientierung
- Fallverstehen / Sozialpädagogischen Diagnostik
- Zusammenwirken der Fachkräfte
- Hilfeplanprozess
- Phase 1: Falleingangsphase
- Phase 2: Hilfeplanung als kooperativer Prozess
- Phase 3: Überprüfung – Beobachtung und Steuerung des Hilfeprozesses
- Phase 4: Beendigung und Auswertung
- Bezug zum systemischen Arbeiten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Hilfeplanung nach §36 SGB VIII im Kontext der Jugendhilfe und beleuchtet insbesondere die Verbindung zum systemischen Arbeiten. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Grundlagen und Qualitätsmerkmale des Hilfeplans, beschreibt den Hilfeplanprozess in seinen einzelnen Phasen und zeigt die Schnittmenge zwischen Hilfeplanung und systemischem Arbeiten auf.
- Rechtliche Grundlagen der Hilfeplanung im KJHG
- Qualitätsmerkmale des Hilfeplans: Partizipation, Ressourcenorientierung, Zielorientierung
- Phasen des Hilfeplanprozesses
- Verbindung zwischen Hilfeplan und systemischem Arbeiten
- Relevanz und Bedeutung des Hilfeplans in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hilfeplanung nach §36 SGB VIII ein und erläutert die Fragestellung der Arbeit. Sie beleuchtet die Entwicklung und den aktuellen Stand der Hilfen zur Erziehung sowie die Relevanz der Hilfeplanung für die Unterstützung junger Menschen.
Das erste Kapitel behandelt die rechtlichen Grundlagen des Hilfeplans. Es werden die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Legitimationen des §36 SGB VIII und die verschiedenen Hilfen zur Erziehung im KJHG vorgestellt. Weiterhin werden die Begriffe Hilfeplan, Hilfeplanung und Hilfeplanverfahren definiert.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Qualitätsmerkmalen des Hilfeplans. Es werden die Bedeutung der Partizipation, der Ressourcenorientierung, der Zielorientierung, des Fallverstehens und der Zusammenarbeit der Fachkräfte im Hilfeplanprozess erläutert.
Das dritte Kapitel beschreibt den Hilfeplanprozess in seinen vier Phasen: Falleingangsphase, Hilfeplanung als kooperativer Prozess, Überprüfung und Steuerung des Hilfeprozesses sowie Beendigung und Auswertung. Die einzelnen Phasen werden näher erläutert und die Bedeutung für eine erfolgreiche Hilfeplanung hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Hilfeplan, Hilfeplanung, §36 SGB VIII, KJHG, Jugendhilfe, systemisches Arbeiten, Partizipation, Ressourcenorientierung, Zielorientierung, Hilfeplanprozess, Falleingangsphase, kooperative Hilfeplanung, Überprüfung, Steuerung, Beendigung, Auswertung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Hilfeplanung gem. §36 SGB VIII im Kinder- und Jugendhilfegesetz in Kombination mit dem systemischen Arbeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1300332