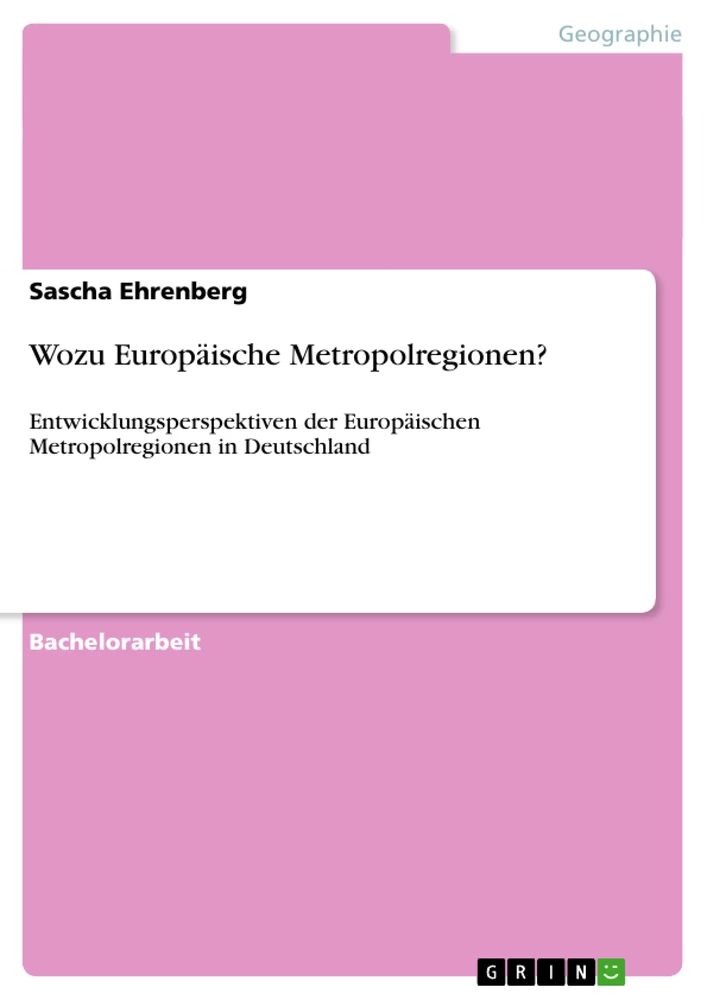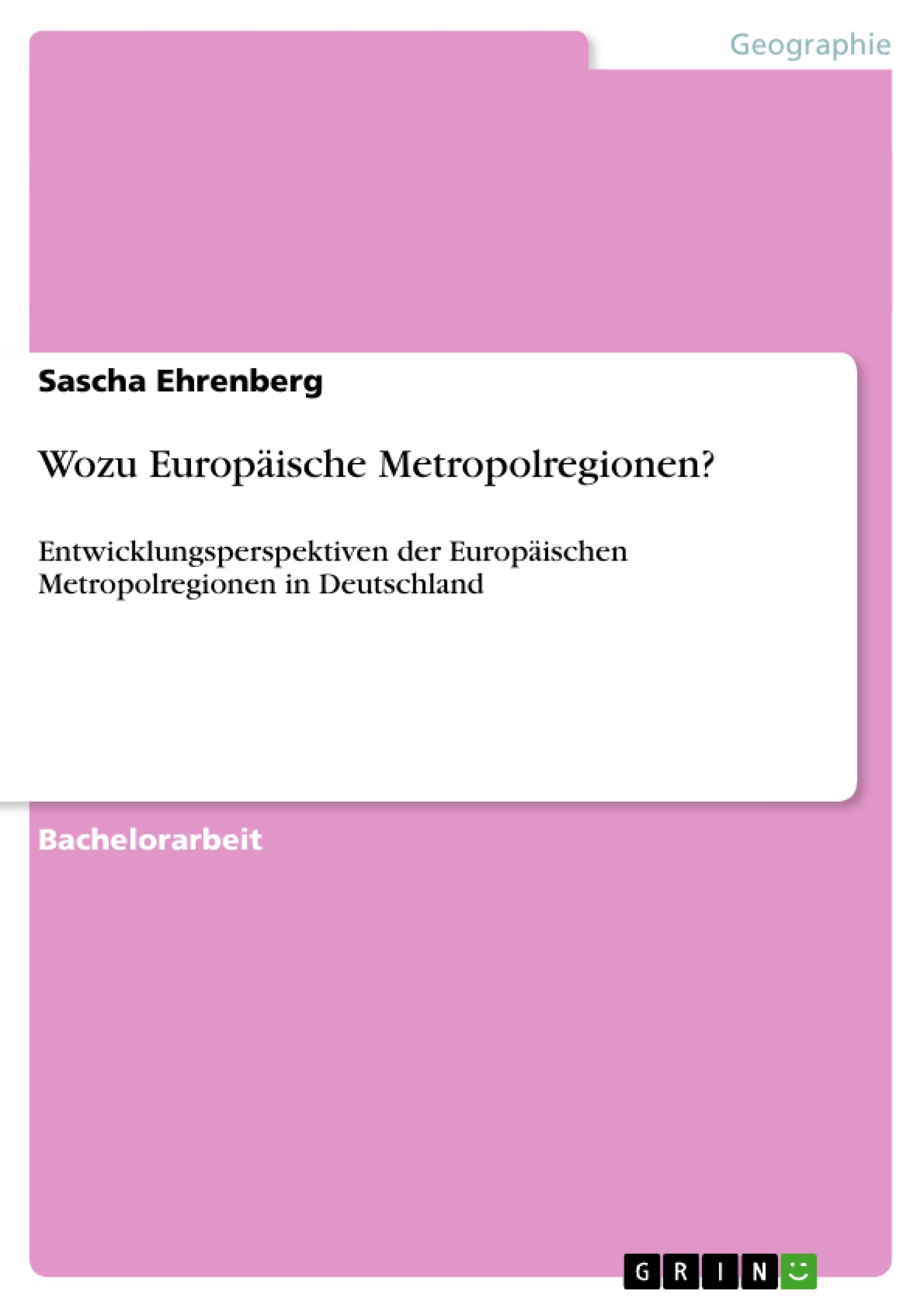1.1 Einführung und Vorstellung der Fragestellung
Die Europäische Union besteht seit dem 01. Januar 2007 aus 27 Staaten. Im Zuge dieser politisch motivierten europäischen Integration verlieren die nationalen raumordnerischen Gliederungsebenen zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig wird die Einheit „Region“ immer wichtiger, denn Europa soll ein „Europa der Regionen“ werden. Um dies zu erreichen, sieht das „Europäische Raumentwicklungskonzept“ EUREK) vor, die wirtschaftlichen Potenziale der „Regionen“ innerhalb der EU durch eine polyzentrische und ausgewogene Raumentwicklung zu stärken. (EUROPÄISCHE KOMMISSION 1999, S.67). In einem Wettbewerb der Regionen in Europa nehmen die „Europäischen Metropolregionen“ eine wichtige Position ein. Ihre Aufgabe ist es, die Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit Deutschlands auf wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Ebene zu stärken.
In Deutschland gibt es seit 2005 offiziell elf Europäische Metropolregionen. Sie scheinen im Trend zu sein, denn diese „Regionen“ erstrecken sich nicht nur auf die großen städtischen Agglomerationen und ihr Umland, wie der Name vermuten lässt, sondern auch zunehmend auf Gebiete, die man traditionell für ländlich halten würde. Doch wer nicht „dazugehört“, hat im Wettlauf um Investoren, Touristen und Unternehmen keine Chance, so zumindest scheinen viele Kommunen zu denken. In der Folge hat sich in Deutschland ein Netz von ganz unterschiedlich strukturierten Metropolregionen gebildet, welche sich teilweise sogar überschneiden.
In dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, was diese Europäischen Metropolregionen leisten können. Sind sie nur ein Marketinggag und ein hysterischer Trend, welcher außer einer ehrfurchtgebietenden Bezeichnung nichts weiter zu bieten hat, und können diese Metropolregionen überhaupt Vorteile für ihre Mitgliedskommunen bringen? Wozu können sie tatsächlich dienen? Die Grundlage der Betrachtung bildet dabei die komplizierte Struktur der Verflechtungen, sowohl innerhalb der Metropolregionen als auch zwischen diesen auf nationaler und internationaler Ebene.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Einleitung und Vorstellung der Fragestellung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 Das Konzept der Europäischen Metropolregionen
- 2.1 Definition und Entwicklung
- 2.2 Funktionen von Metropolregionen
- 2.3 Die Europäischen Metropolregionen in Deutschland
- 2.4 Die Rahmenbedingungen der Bildung von Metropolregionen
- 2.5 Die Akteure in den Metropolregionen
- 2.6 Die Metropolregionen im Konzept der zentralörtlichen Gliederung und ihre Bedeutung für die deutsche Raumplanung
- 3 Metropolräume oder Metropolregionen?
- 4 Verflechtungen der Metropolregionen in Deutschland
- 4.1 Verflechtungen auf regionaler Ebene
- 4.2 Verflechtungen auf nationaler Ebene
- 4.3 Verflechtungen auf transnationaler Ebene
- 5 Die Zukunft der Europäischen Metropolregionen: Entwicklungsperspektiven
- 5.1 Kooperation und Konkurrenz
- 5.2 Die Wissensökonomie als Zugpferd?
- 5.3 Hat das polyzentrische System der deutschen Metropolregionen Zukunft?
- 5.4 Internationalität als Chance
- 6 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung und die Entwicklungsperspektiven Europäischer Metropolregionen in Deutschland. Sie hinterfragt den Nutzen dieser Regionen für ihre Mitgliedskommunen und analysiert die komplexen Verflechtungen innerhalb und zwischen den Metropolregionen auf verschiedenen Ebenen.
- Definition und Entwicklung des Konzepts der Europäischen Metropolregionen
- Funktionen und Rolle der Metropolregionen in der deutschen Raumplanung
- Analyse der Verflechtungen zwischen den Metropolregionen auf regionaler, nationaler und transnationaler Ebene
- Bewertung der Entwicklungsperspektiven im Kontext von Kooperation, Konkurrenz und Wissensökonomie
- Diskussion des polyzentrischen Systems der deutschen Metropolregionen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor: Was leisten Europäische Metropolregionen? Sind sie ein wirklicher Vorteil für die Mitgliedskommunen oder nur ein Marketinginstrument? Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Metropolregionen im Kontext der europäischen Integration und des Wettbewerbs der Regionen. Sie fokussiert auf die komplexe Struktur der Verflechtungen innerhalb und zwischen den Metropolregionen.
2 Das Konzept der Europäischen Metropolregionen: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Metropolregion“ und beschreibt seine Entwicklung. Es erläutert die Funktionen von Metropolregionen, beleuchtet die Rahmenbedingungen ihrer Bildung und stellt die beteiligten Akteure vor. Schließlich ordnet es die Metropolregionen in das Konzept der zentralen Orte der deutschen Raumplanung ein und beleuchtet die politischen und raumplanerischen Perspektiven.
3 Metropolräume oder Metropolregionen?: Dieses Kapitel vertieft den Begriff „Region“ aus geographischer Sicht und setzt ihn in Relation zu dem Begriff „Metropolregion“. Es analysiert die unterschiedlichen Perspektiven und Definitionen, und diskutiert möglicherweise die Grenzen und Überschneidungen dieser Konzepte.
4 Verflechtungen der Metropolregionen in Deutschland: Dieses Kapitel untersucht die Verflechtungen der deutschen Metropolregionen auf regionaler, nationaler und transnationaler Ebene. Es analysiert die verschiedenen Arten von Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den Regionen und bewertet ihre Bedeutung für die Entwicklung der einzelnen Metropolregionen. Es werden wahrscheinlich konkrete Beispiele für die verschiedenen Verflechtungstypen angeführt.
5 Die Zukunft der Europäischen Metropolregionen: Entwicklungsperspektiven: Dieses Kapitel befasst sich mit den zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten der Europäischen Metropolregionen. Es analysiert die Bedeutung von Kooperation und Konkurrenz zwischen den Regionen sowie die Rolle der Wissensökonomie. Weiterhin wird das polyzentrische System der deutschen Metropolregionen kritisch bewertet und das Potenzial der Internationalisierung diskutiert. Hier werden Prognosen und Szenarien für die zukünftige Entwicklung der Metropolregionen aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Europäische Metropolregionen, Raumentwicklung, regionale Verflechtungen, Wissensökonomie, polyzentrisches System, deutsche Raumplanung, Kooperation, Konkurrenz, Regionale Wettbewerbsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Europäische Metropolregionen in Deutschland
Was ist der Gegenstand des Dokuments?
Das Dokument analysiert die Bedeutung und zukünftige Entwicklung europäischer Metropolregionen in Deutschland. Es untersucht ihren Nutzen für die Mitgliedskommunen und die komplexen Verflechtungen innerhalb und zwischen den Regionen auf verschiedenen Ebenen (regional, national, transnational).
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Definition und Entwicklung des Konzepts der Europäischen Metropolregionen; Funktionen und Rolle der Metropolregionen in der deutschen Raumplanung; Analyse der Verflechtungen zwischen den Metropolregionen; Bewertung der Entwicklungsperspektiven im Kontext von Kooperation, Konkurrenz und Wissensökonomie; Diskussion des polyzentrischen Systems der deutschen Metropolregionen.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in Kapitel unterteilt: Einleitung, das Konzept der Europäischen Metropolregionen, Metropolräume oder Metropolregionen?, Verflechtungen der Metropolregionen in Deutschland, Die Zukunft der Europäischen Metropolregionen: Entwicklungsperspektiven, und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird zusammengefasst, zudem enthält das Dokument ein Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Schlüsselwörter.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Nutzen europäischer Metropolregionen und ihrer Bedeutung im Kontext europäischer Integration und regionalen Wettbewerbs dar. Der Fokus liegt auf den komplexen Verflechtungen innerhalb und zwischen den Metropolregionen.
Was wird im Kapitel "Das Konzept der Europäischen Metropolregionen" behandelt?
Dieses Kapitel definiert den Begriff "Metropolregion", beschreibt seine Entwicklung, erläutert die Funktionen, die Rahmenbedingungen ihrer Bildung, stellt die Akteure vor und ordnet die Metropolregionen in das Konzept der zentralen Orte der deutschen Raumplanung ein.
Was ist der Inhalt des Kapitels "Metropolräume oder Metropolregionen?"?
Dieses Kapitel vergleicht die Begriffe "Metropolraum" und "Metropolregion" aus geographischer Sicht, analysiert unterschiedliche Perspektiven und Definitionen und diskutiert mögliche Grenzen und Überschneidungen der Konzepte.
Worüber informiert das Kapitel "Verflechtungen der Metropolregionen in Deutschland"?
Dieses Kapitel untersucht die Verflechtungen auf regionaler, nationaler und transnationaler Ebene, analysiert die Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den Regionen und bewertet deren Bedeutung für die Entwicklung der einzelnen Metropolregionen anhand konkreter Beispiele.
Welche Aspekte werden im Kapitel "Die Zukunft der Europäischen Metropolregionen: Entwicklungsperspektiven" behandelt?
Dieses Kapitel befasst sich mit zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten, analysiert die Bedeutung von Kooperation und Konkurrenz, die Rolle der Wissensökonomie, bewertet kritisch das polyzentrische System und diskutiert das Potenzial der Internationalisierung. Es enthält Prognosen und Szenarien für die zukünftige Entwicklung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Dokument?
Relevante Schlüsselwörter sind: Europäische Metropolregionen, Raumentwicklung, regionale Verflechtungen, Wissensökonomie, polyzentrisches System, deutsche Raumplanung, Kooperation, Konkurrenz, regionale Wettbewerbsfähigkeit.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Das Dokument ist relevant für Wissenschaftler, Studenten, Planer und alle, die sich mit Raumentwicklung, Regionalwissenschaft und der Entwicklung europäischer Metropolregionen befassen.
- Quote paper
- B.A. Sascha Ehrenberg (Author), 2007, Wozu Europäische Metropolregionen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129976