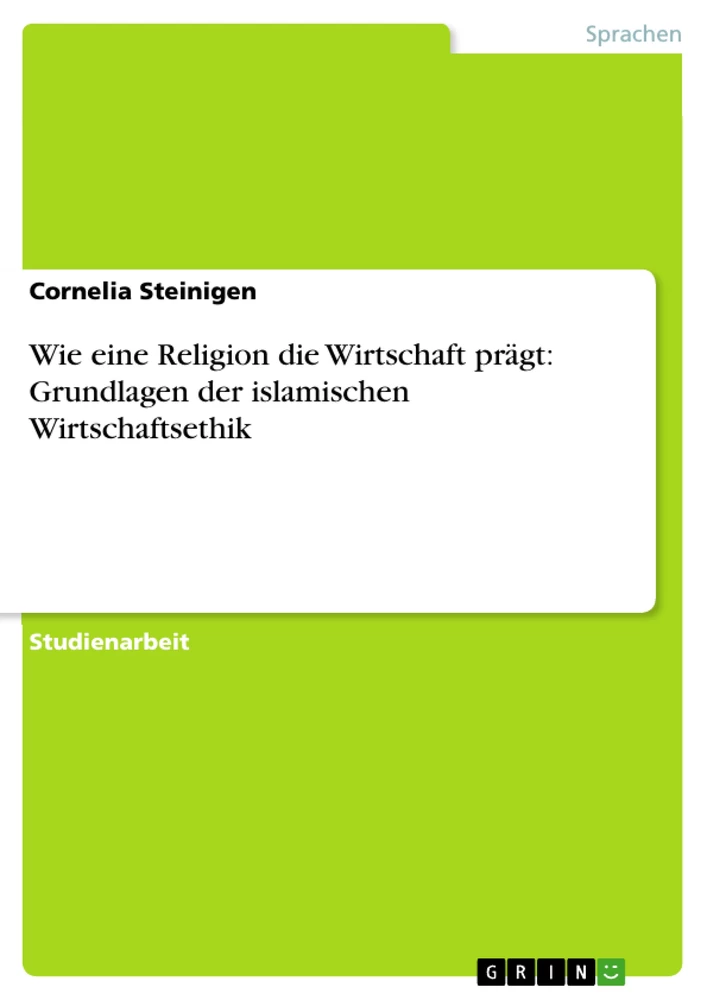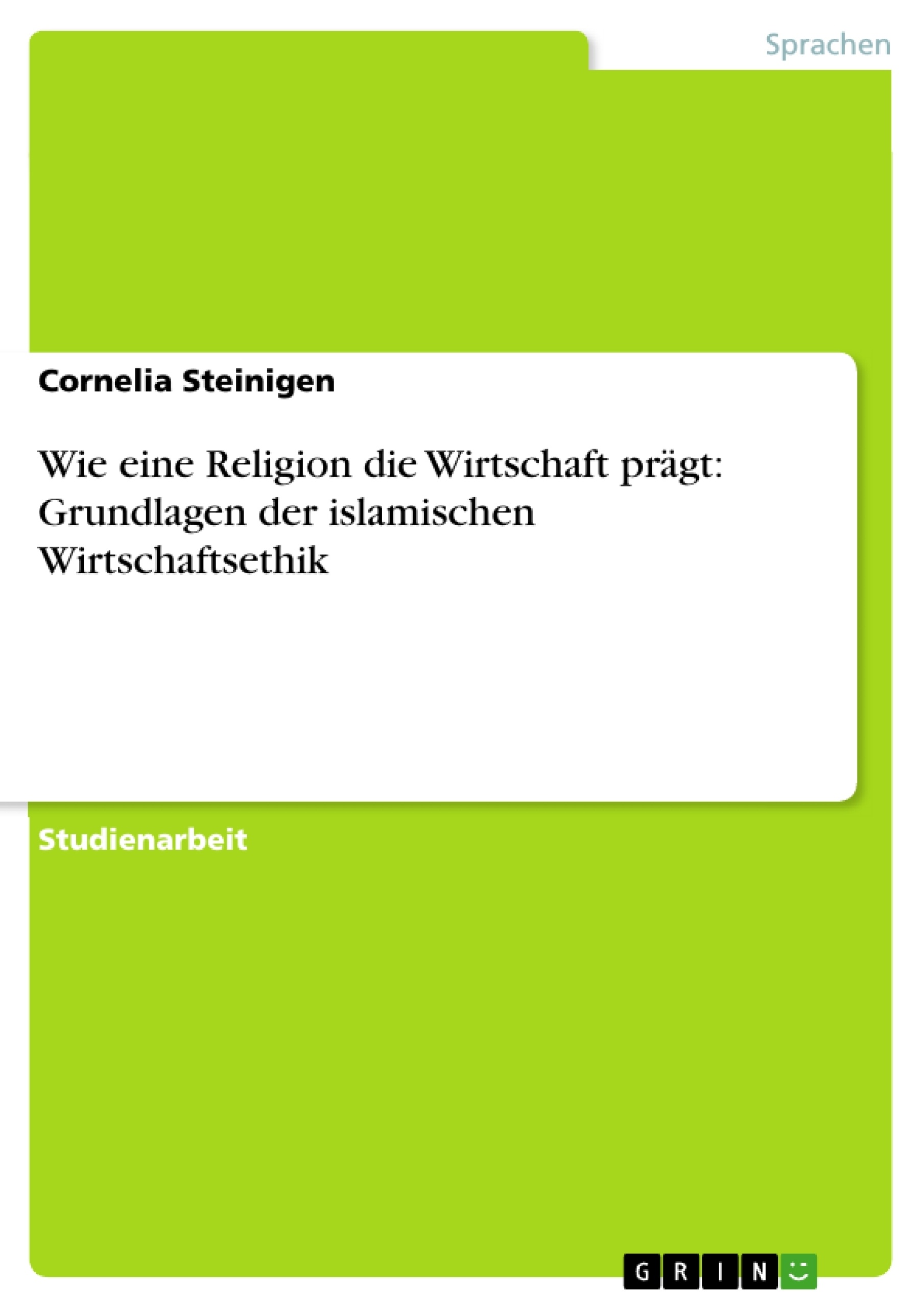Der Islam ist mittlerweile die am schnellsten wachsende Religion der Welt - bereits jeder fünfte Mensch auf der Erde ist Muslim. Obwohl der Islam große Bedeutung hat, ist das Wissen über das islamische Wirtschafts- und Gesellschaftsverständnis bisher nur wenig verbreitet. Vielmehr wird heute der politische Islam überbetont, wobei nicht berücksichtigt wird, dass die Sozial- und Wirtschaftsauffassung ein wichtiger Faktor in der politischen Orientierung islamisch geprägter Länder ist und hilft ihre gegenwärtige geopolitische Konstellation zu verstehen. Seit den 1970er Jahren gibt es eine Reislamisierungstendenz in vielen islamischen Ländern, die Wirtschaft und Gesellschaft wieder stärker in den normativen Rahmen der Religion einbinden will. Dies steht der westlichen Säkularisierungstendenz entgegen, für die der Islam fremd- bzw. andersartig erscheint. Allerdings sind heutige Zielvorstellungen bzw. Interpretationen der islamischen Wirtschafts- und Sozialordnung auch innerhalb der islamischen Welt nicht einheitlich, da sich z. B. lokale Sonderformen herausgebildet haben und die in den religiösen Quellen vorgegebenen wirtschaftsethischen Anweisungen kaum präzisiert sind.
Mit der vorliegenden Arbeit sollen einzelne Aspekte der islamischen Wirtschaftsethik, wie z. B. das Menschen- und Weltbild und die Einstellung zu Eigentum, näher beleuchtet werden. Eine große Partie wird den beiden charakteristischsten Merkmalen der islamischen Wirtschaftsordnung, der Zakāt und dem Zins- bzw. Wucherverbot, gewidmet sein. Zum Schluss soll der Blick auf das Islamic Banking gelenkt werden, ein Beispiel, wie in der Praxis mit dem islamischen Zinsverbot umgegangen wird, das offensichtlich gerade in der aktuellen Wirtschaftskrise seine Bewährung findet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Religion und Wirtschaft
- Islamische Wirtschaftsethik
- Grundlagen
- Welt- und Menschenbild
- Eigentum
- Arbeitsethik
- Erlaubte und verbotene Tätigkeiten
- Die konstituierenden Merkmale der islamischen Wirtschaftsordnung: Zakāt und Ribā-Verbot
- Zakāt
- Definition und Ursprung
- Berechnung und Eintreibung
- Wer erhält Zakāt?
- Bedeutung
- Ribā-Verbot
- Definition und Ursprung
- Zakāt
- Zusammenfassung
- Quellen
- Bibliographie
- Zeitschriften
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der islamischen Wirtschaftsethik und untersucht, wie die Religion die Wirtschaft prägt. Sie analysiert die Grundlagen der islamischen Wirtschaftsethik, einschließlich des Welt- und Menschenbildes, der Einstellung zu Eigentum und der Arbeitsethik. Ein besonderer Fokus liegt auf den beiden charakteristischen Merkmalen der islamischen Wirtschaftsordnung: der Zakāt-Steuer und dem Zinsverbot. Die Arbeit beleuchtet die Definition, den Ursprung und die Bedeutung dieser beiden Elemente und zeigt, wie sie in der Praxis umgesetzt werden.
- Grundlagen der islamischen Wirtschaftsethik
- Welt- und Menschenbild im Islam
- Eigentum und Arbeitsethik im Islam
- Zakāt-Steuer und ihre Bedeutung
- Zinsverbot und seine Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz der islamischen Wirtschaftsethik in der heutigen Zeit. Sie beleuchtet die wachsende Bedeutung des Islam weltweit und die zunehmende Reislamisierungstendenz in vielen islamischen Ländern. Die Einleitung stellt außerdem die Zielsetzung der Arbeit vor und gibt einen Überblick über die behandelten Themen.
Das Kapitel "Religion und Wirtschaft" untersucht die wechselseitige Beziehung zwischen Religion und Wirtschaft. Es wird argumentiert, dass Religion eine wichtige Quelle für Wertvorstellungen und Verhaltensnormen ist, die sich auch in der Wirtschaft widerspiegeln. Das Kapitel beleuchtet auch die ambivalenten Auswirkungen von Religion auf die Wirtschaft und zeigt, dass sie sowohl konstruierend als auch zerstörend wirken kann.
Das Kapitel "Islamische Wirtschaftsethik" befasst sich mit den Grundlagen der islamischen Wirtschaftsethik. Es erläutert die Rolle der Scharia als Grundlage des islamischen Rechts und die Bedeutung des Korans und der Sunna als primäre Rechtsquellen. Das Kapitel beleuchtet auch die sekundären Rechtsquellen, wie den Analogieschluss und die Übereinkunft, und zeigt, wie diese zur Anwendung klassischer Regeln in der modernen Welt beitragen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die islamische Wirtschaftsethik, die Scharia, Zakāt, Ribā-Verbot, Welt- und Menschenbild, Eigentum, Arbeitsethik, Reislamisierung, Islamic Banking und die Bedeutung der Religion für die Wirtschaft.
- Quote paper
- Cornelia Steinigen (Author), 2009, Wie eine Religion die Wirtschaft prägt: Grundlagen der islamischen Wirtschaftsethik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129857