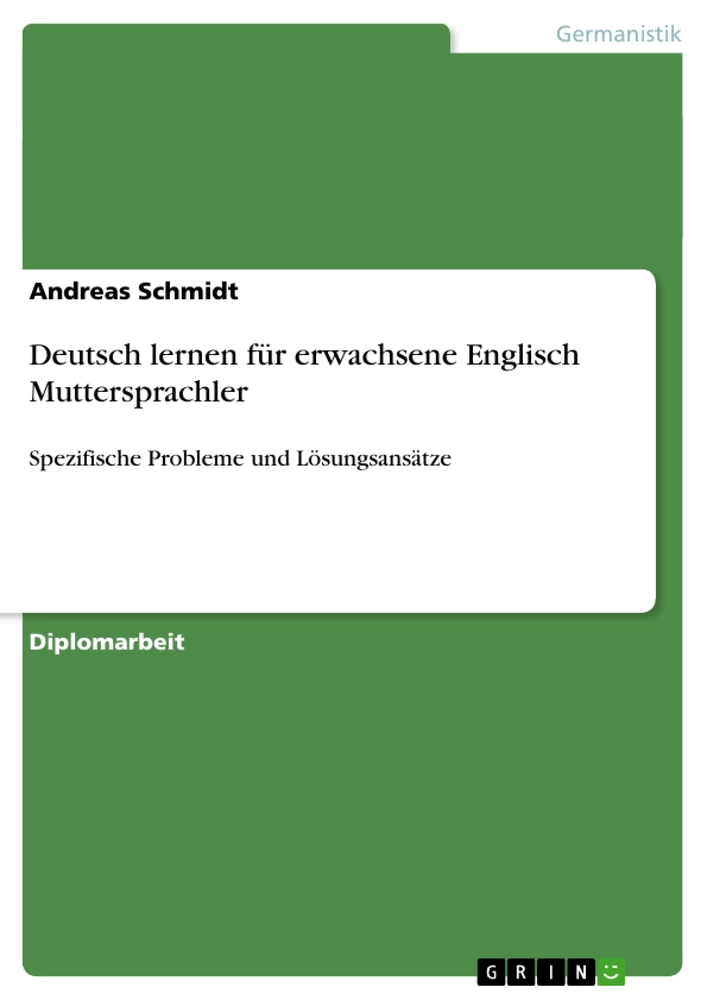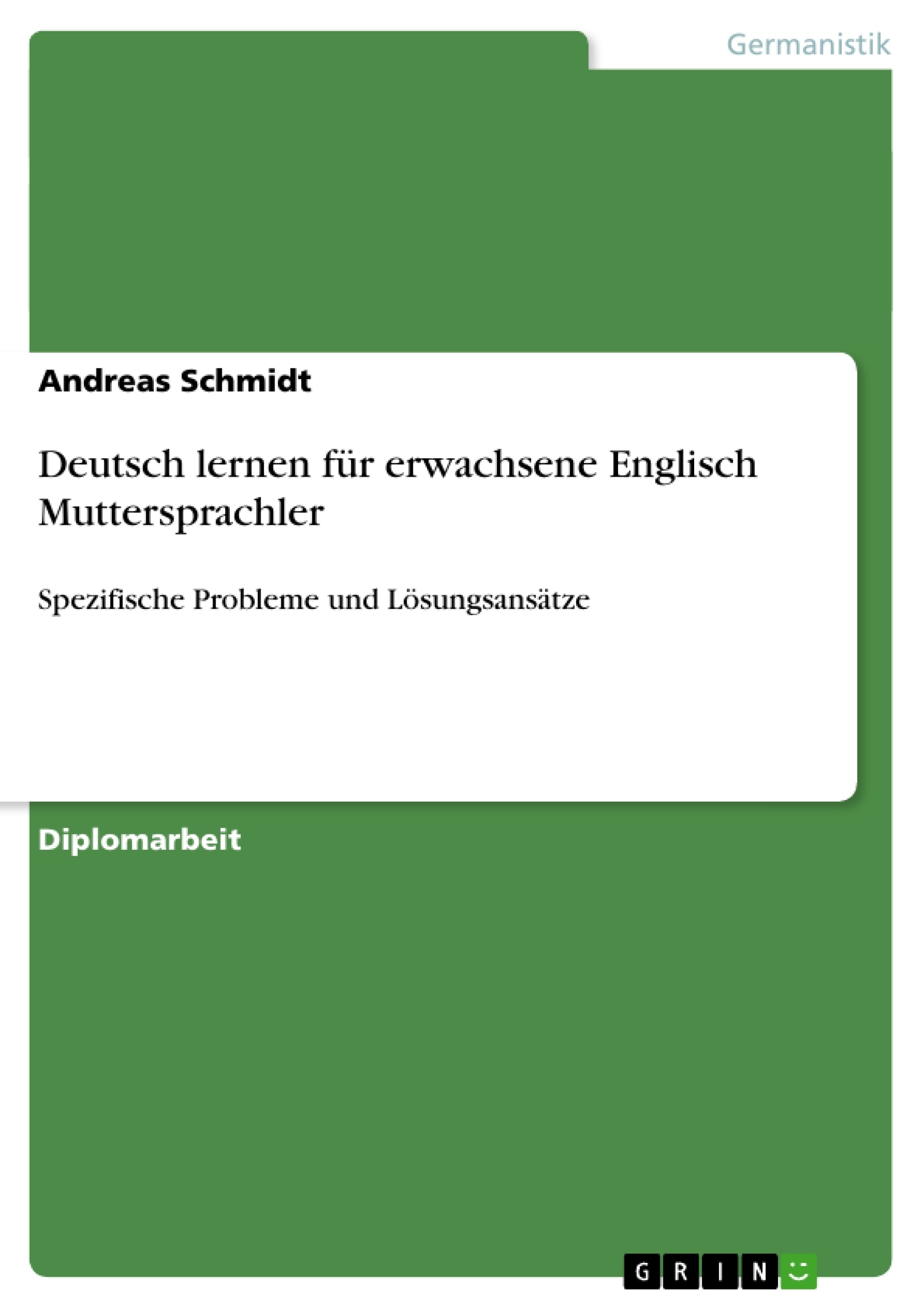Im Jahr 2005/2006 war ich als Austauschlehrer für deutsche Sprache an der University of Wisconsin - La Crosse in den USA. Im Rahmen dieser Tätigkeit konnte ich praxisnah Erfahrungen mit Studenten sammeln, die Deutsch als Fremdsprache lernen wollten. Die Begeisterung für das Vermitteln von Sprachkenntnissen hat mich motiviert diesen Gegenstand zum Thema einer wissenschaftlichen Untersuchung im Rahmen meiner Zulassungsarbeit zu machen. Dabei sollten insbesondere, in Anlehnung an die gemachten Erfahrungen, junge Erwachsene betrachtet werden. Charakteristisch sollte sein, dass die zu betrachteten Personen englische Muttersprachler sind und sich, im Gegensatz zu Schülern, freiwillig mit der Fremdsprache auseinander setzen.
Bei der Literaturrecherche war auffallend, dass vor allem Schüler im Fokus der Betrachtung standen wohingegen Erwachsene vernachlässigt wurden. Die vorliegende Arbeit fußt auf der Annahme, dass sich die Auseinandersetzung mit einer Fremdsprache für Erwachsene, welche diese freiwillig lernen anders verhalten könnte, als für Kinder, welche eine Sprache in der Schule lernen müssen. Daraus ergab sich die Fragestellung welche Probleme der oben beschrieben Zielgruppe beim Fremdsprachenlernen auftreten.
Ziel der Arbeit war es also die spezifischen Probleme englischer erwachsener Muttersprachler beim Lernen von Deutsch als Fremdsprache zu untersuchen und daraus Empfehlungen abzuleiten. Dafür wurde im Rahmen dieser Arbeit zunächst eine theoretische Grundlage geschaffen. Es wurden Theorien des Zweitsprachenerwerbs und Fehlertypen untersucht. Anschließend erfolgte ein Vergleich der Sprachsysteme des Englischen und Deutschen. Darauf aufbauend wurden Texte der beschriebenen Zielgruppe auf gemachte Fehler überprüft und diese ausgewertet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Warum Deutsch lernen?
- 1.1 Warum Deutsch als Fremdsprache?
- 1.2 Warum Deutsch für Erwachsene?
- 2. Theorien des Zweitsprachenerwerbs
- 2.1 Definition Spracherwerb
- 2.2 Spracherwerb versus Sprachen lernen
- 2.3 Theorien und Hypothesen
- 2.3.1 Kontrastivhypothese
- 2.3.2 Identitätshypothese
- 2.3.3 Interlanguage-Hypothese
- 2.3.4 Monitortheorie
- 2.3.5 Ergänzungstheorie
- 2.3.6 Second Language Acquisition Support System
- 2.3.7 Pidginisierungshypothese
- 2.3.8 Theory of Social Factors
- 3. Fehlertypen
- 3.1 Omission of Morphemes
- 3.2 Double marking
- 3.3 Regularizing
- 3.4 Archiforms
- 3.5 Random Alternation
- 3.6 Misordering
- 3.7 Weitere Unterscheidungen von Fehlern nach
- 3.7.1 Chomsky (1965)
- 3.7.2 Gleason (1951) und Long (1961)
- 3.7.3 Politzer und Ramires (1973)
- 3.7.4 Burt und Kiparsky (1972)
- 3.7.5 Corder (1974)
- 3.7.6 Knapp-Potthoff (1987)
- 3.7.7 Lennon (1991)
- 4. Vergleich der Sprachsysteme des Englischen und Deutschen
- 4.1 Unterschiede in der Infrastruktur beider Sprachen
- 4.2 Die Morphologie des deutschen und englischen Verbs
- 4.3 Die Infinitivkonstruktion im Deutschen und Englischen
- 4.4 False Friends - Falsche Freunde
- 4.5 Groß- und Kleinschreibung im Deutschen und Englischen
- 4.6 Zeichensetzung
- 5. Untersuchte Texte
- 5.1 Beschreibung der Textproduzenten
- 5.2 Beschreibung der Texte
- 5.3 Fehlerkategorien der untersuchten Texte
- 5.4 Numerische Darstellung der Ergebnisse
- 5.5 Schlussfolgerungen und Kommentare
- 5.6 Fazit
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Schwierigkeiten beim Erlernen der deutschen Sprache durch englischsprachige Lerner. Ziel ist es, häufige Fehlertypen zu identifizieren und diese im Kontext von Theorien des Zweitsprachenerwerbs zu analysieren. Der Vergleich der deutschen und englischen Sprachstrukturen soll dabei helfen, die Ursachen der Fehler zu verstehen.
- Analyse von Fehlertypen im Deutschen als Zweitsprache
- Vergleich der deutschen und englischen Sprachstrukturen
- Anwendung von Theorien des Zweitsprachenerwerbs
- Identifizierung von Ursachen für häufige Fehler
- Bewertung der Ergebnisse im Hinblick auf den Sprachunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Deutschlernens ein und begründet die Relevanz der Untersuchung. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die methodischen Vorgehensweisen.
1. Warum Deutsch lernen?: Dieses Kapitel behandelt die Motivationen für das Erlernen der deutschen Sprache, sowohl als Fremdsprache im Allgemeinen als auch speziell für Erwachsene. Es beleuchtet die Bedeutung Deutschlands in der Wirtschaft und Kultur als Anreiz für den Spracherwerb.
2. Theorien des Zweitsprachenerwerbs: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über verschiedene Theorien und Hypothesen zum Zweitsprachenerwerb. Es werden verschiedene Ansätze vorgestellt und miteinander verglichen, wie die Kontrastivhypothese, die Interlanguage-Hypothese und die Monitortheorie. Der Fokus liegt auf dem Verständnis, wie Lerner eine neue Sprache erwerben und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
3. Fehlertypen: Dieses Kapitel beschreibt detailliert verschiedene Fehlertypen, die von Lernenden des Deutschen gemacht werden. Es klassifiziert die Fehler nach verschiedenen Kriterien und analysiert deren Ursachen. Die verschiedenen Klassifizierungssysteme von Chomsky, Gleason, Long, Politzer, Ramirez, Burt, Kiparsky, Corder, Knapp-Potthoff und Lennon werden vorgestellt und verglichen.
4. Vergleich der Sprachsysteme des Englischen und Deutschen: Dieser Abschnitt vergleicht die Strukturen des Deutschen und Englischen, um die Schwierigkeiten für englischsprachige Lerner zu verdeutlichen. Die Analyse umfasst Morphologie, Syntax und Unterschiede im Wortschatz ("False Friends"), sowie Groß- und Kleinschreibung und Zeichensetzung. Die Unterschiede werden detailliert erläutert und mit Beispielen illustriert.
5. Untersuchte Texte: In diesem Kapitel werden die im Rahmen der Studie untersuchten Texte beschrieben. Es beinhaltet Informationen zu den Autoren der Texte, eine detaillierte Charakterisierung der Texte selbst, eine Kategorisierung der gefundenen Fehler und eine numerische Darstellung der Ergebnisse. Die Schlussfolgerungen und Kommentare geben Aufschluss über die Interpretation der Daten.
Schlüsselwörter
Zweitsprachenerwerb, Deutsch als Fremdsprache, Fehleranalyse, Kontrastivhypothese, Interlanguage, Morphologie, Syntax, Englisch-Deutsch-Vergleich, Sprachsystemvergleich, Lernstrategien
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Fehlern im Deutschlernen Englischsprachiger
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Schwierigkeiten beim Erlernen der deutschen Sprache durch englischsprachige Lerner. Sie identifiziert häufige Fehlertypen und analysiert diese im Kontext von Theorien des Zweitsprachenerwerbs. Ein Vergleich der deutschen und englischen Sprachstrukturen soll die Ursachen der Fehler erklären.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Analyse von Fehlertypen im Deutschen als Zweitsprache, Vergleich der deutschen und englischen Sprachstrukturen, Anwendung von Theorien des Zweitsprachenerwerbs (z.B. Kontrastivhypothese, Interlanguage-Hypothese, Monitortheorie), Identifizierung der Ursachen häufiger Fehler und die Bewertung der Ergebnisse im Hinblick auf den Sprachunterricht.
Welche Theorien des Zweitsprachenerwerbs werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Theorien und Hypothesen zum Zweitsprachenerwerb, darunter die Kontrastivhypothese, die Identitätshypothese, die Interlanguage-Hypothese, die Monitortheorie, die Ergänzungstheorie, das Second Language Acquisition Support System, die Pidginisierungshypothese und die Theory of Social Factors. Diese werden vorgestellt und miteinander verglichen.
Welche Fehlertypen werden analysiert?
Die Arbeit beschreibt detailliert verschiedene Fehlertypen, die von Lernenden des Deutschen gemacht werden, wie z.B. Auslassung von Morphemen (Omission of Morphemes), Doppelmarkierung (Double marking), Regularisierung (Regularizing), Archiform, zufällige Alternierung (Random Alternation), Fehlstellung (Misordering). Die verschiedenen Klassifizierungssysteme von Chomsky, Gleason, Long, Politzer und Ramirez, Burt und Kiparsky, Corder, Knapp-Potthoff und Lennon werden vorgestellt und verglichen.
Wie werden die Sprachsysteme von Deutsch und Englisch verglichen?
Der Vergleich der Sprachsysteme umfasst Unterschiede in der Infrastruktur beider Sprachen, die Morphologie des deutschen und englischen Verbs, die Infinitivkonstruktion, "False Friends" (falsche Freunde), Groß- und Kleinschreibung und Zeichensetzung. Die Unterschiede werden detailliert erläutert und mit Beispielen illustriert.
Welche Texte wurden untersucht?
Die Arbeit beschreibt die im Rahmen der Studie untersuchten Texte, einschließlich Informationen zu den Textproduzenten, einer detaillierten Charakterisierung der Texte, einer Kategorisierung der gefundenen Fehler und einer numerischen Darstellung der Ergebnisse. Schlussfolgerungen und Kommentare zur Interpretation der Daten werden ebenfalls gegeben.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen und Kommentare geben Aufschluss über die Interpretation der Daten aus den untersuchten Texten. Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und gibt möglicherweise Hinweise für den Deutschunterricht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zweitsprachenerwerb, Deutsch als Fremdsprache, Fehleranalyse, Kontrastivhypothese, Interlanguage, Morphologie, Syntax, Englisch-Deutsch-Vergleich, Sprachsystemvergleich, Lernstrategien.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zu den Gründen des Deutschlernens, Theorien des Zweitsprachenerwerbs, Fehlertypen, einem Vergleich der Sprachsysteme von Deutsch und Englisch, der Beschreibung der untersuchten Texte, und einer Zusammenfassung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
- Quote paper
- Andreas Schmidt (Author), 2008, Deutsch lernen für erwachsene Englisch Muttersprachler, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129675