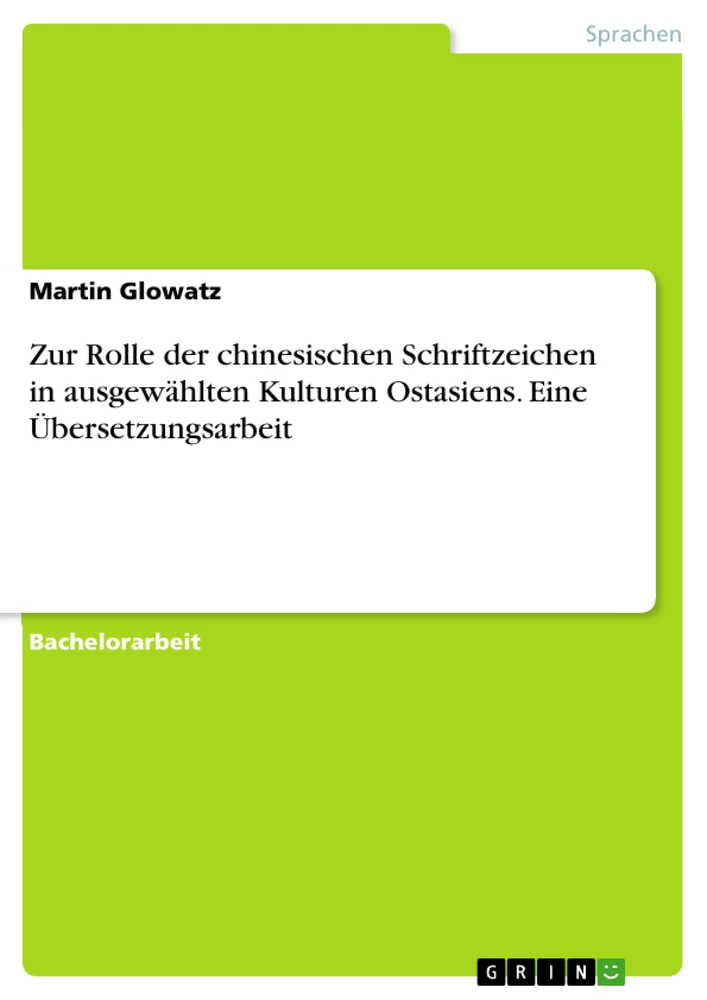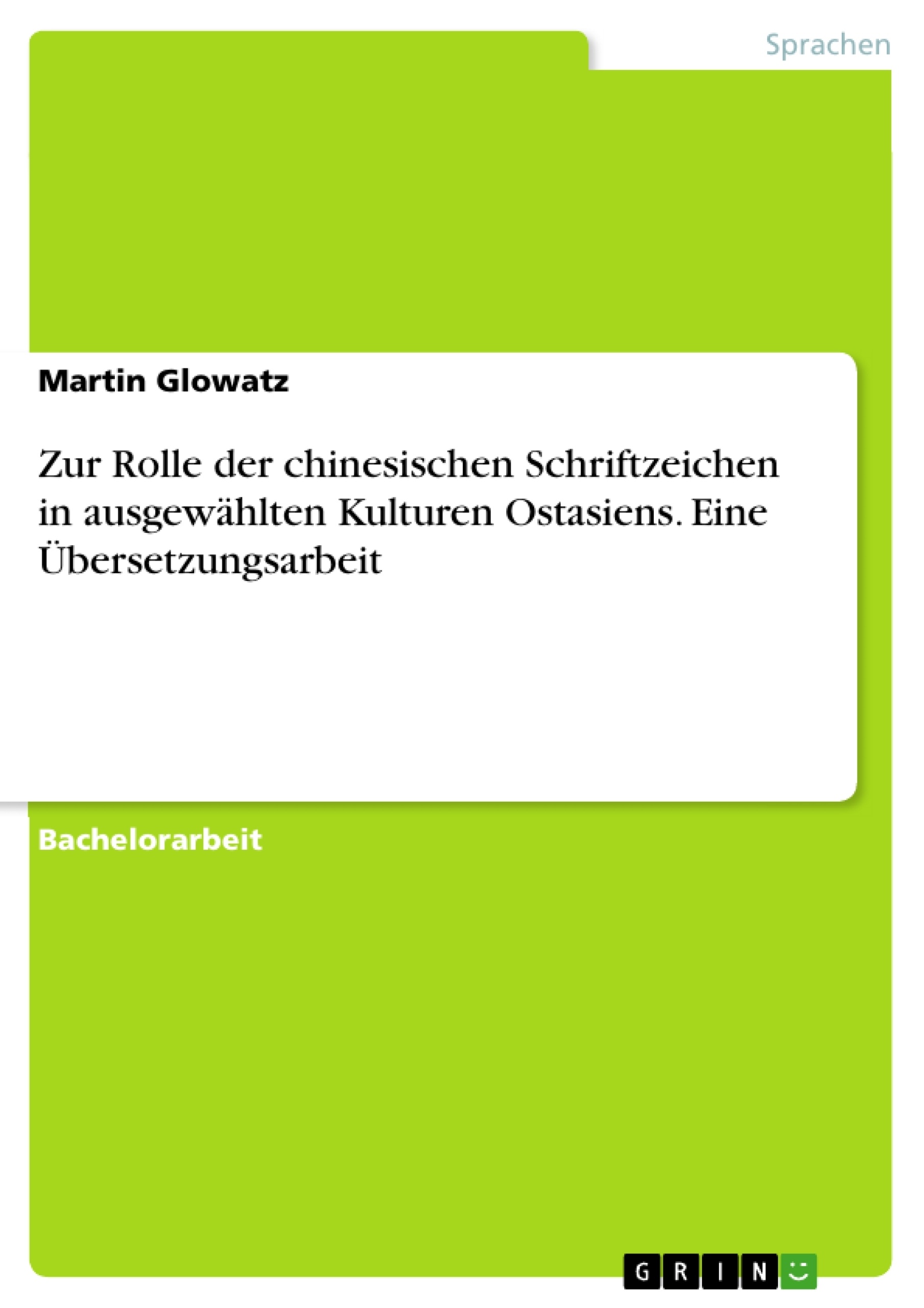Trotz ihrer Komplexität und schwierigen Erlernbarkeit sind die chinesischen Schriftzeichen noch immer in weiten Teilen Ostasiens verbreitet. So sind sie im chinesischen Kernland, auf Taiwan und in Japan in Gebrauch, doch auch in Nord- und Südkorea sowie in Vietnam wurden sie einst verwendet. Die chinesische Schrift ist untrennbar mit der Geschichte und der Kultur dieser Weltregion verbunden.
Gerade im kulturbewussten Japan ist sie Gegenstand zahlreicher Buchpublikationen. Der Kalligraf und Kalligrafiehistoriker Ishikawa Kyūyō thematisiert in seinem Werk Kanji to Ajia: Kanji kara bunmeiken no rekishi wo yomu (Die chinesischen Schriftzeichen und Asien: Aus den Zeichen heraus die Geschichte des Kulturkreises lesen) die Entstehung der Schriftzeichen im alten China und deren Verbreitung in den verschiedenen Regionen und Kulturen Ostasiens.
Diese Arbeit setzt sich mit den Inhalten des ersten Kapitels dieses Buches auseinander. Kernstück ist die deutsche Übersetzung eines Großteils dieses Kapitels. Hier wird die anfängliche Gebundenheit der an das ehemalige Kaiserreich China angrenzenden Peripheriegebiete Japan, Korea und Vietnam durch die Übernahme der Schrift sowie, damit einhergehend, der Übernahme sozialer Strukturen von der einstigen Hochkultur aufgezeigt. Ebenso wird hier die nachfolgende Ablösung und Individualisierung der einzelnen Gebiete auf Ebene der Schrift verdeutlicht. An die Übersetzung schließen sich einige Ausführungen zu deren Erstellung an, welche auch Erläuterungen zu den dabei aufgetretenen Schwierigkeiten sowie zu den gefundenen Lösungen umfassen. In der nachfolgenden Kontextualisierung sind ausgewählte Inhalte des übersetzten Abschnitts in historische, soziokulturelle sowie auch in sprachwissenschaftliche Zusammenhänge gesetzt; zudem werden weniger plausibel scheinende Aussagen des Autors kritisch hinterfragt und gegebenenfalls widerlegt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Autor und Originalwerk
- 3 Die Übersetzung aus dem Japanischen
- 4 Zur Erstellung der deutschen Übersetzung
- 5 Kontextualisierung ausgewählter Inhalte
- 5.1 Allgemeine Erläuterungen
- 5.2 Die Schriftsprache als politisches Instrument
- 5.2.1 Die Dominanz Chinas in Ostasien
- 5.2.2 Die Verwendung der chinesischen Schrift für politische Zwecke
- 5.2.3 Das Erbe der chinesischen Schrift im Vietnam
- 5.2.4 Die Rolle des Hangul
- 5.2.5 Die chinesische Schrift als Mittel zum politischen Zusammenschluss
- 5.3 Identitätskonstruktionen infolge des Schriftgebrauchs
- 5.3.1 Identität durch Geschichtsschreibung
- 5.3.2 Identität durch eine eigene Schrift
- 5.3.3 Identität durch Zugehörigkeit zu einer Gesellschaftsschicht
- 5.4 Aspekte Sprachwissenschaftlicher Disziplinen
- 5.4.1 Ishikawas Position gegenüber der Linguistik Saussures
- 5.4.2 Semiotische Betrachtungen
- 6 Fazit
- 7 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, die Sichtweise des japanischen Kalligrafen und Kalligrafiehistorikers Ishikawa Kyūyō auf die ostasiatische Welt, basierend auf der Entwicklung der chinesischen Schrift, einem deutschsprachigen Publikum zugänglich zu machen. Der Fokus liegt auf einer verständlichen deutschen Übersetzung eines Teils seines Werkes, ohne Rückgriff auf den japanischen Originaltext. Die Arbeit soll Studierenden der Ostasienwissenschaften, insbesondere der Japanologie, wertvolle Einblicke bieten.
- Die Geschichte und Verbreitung der chinesischen Schrift in Ostasien
- Die Rolle der chinesischen Schrift als politisches Instrument
- Die Konstruktion von Identität durch den Gebrauch der chinesischen Schrift
- Sprachwissenschaftliche Perspektiven auf die chinesische Schrift
- Die Übersetzungspraxis und die Herausforderungen bei der Übersetzung eines Fachtextes
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der chinesischen Schriftzeichen und deren Bedeutung für Ostasien ein. Sie beschreibt die Entstehung der Schrift im 13. Jahrhundert v. Chr. und ihre Verbreitung in verschiedenen Regionen wie China, Japan, Korea und Vietnam. Der Fokus liegt auf der Arbeit von Ishikawa Kyūyō und dessen Werk "Kanji to Ajia", welches die Grundlage dieser Arbeit bildet. Die Einleitung umreißt den Aufbau und die Ziele der vorliegenden Arbeit, die darin besteht, einen Teil von Ishikawas Werk ins Deutsche zu übersetzen und zu kontextualisieren.
2 Autor und Originalwerk: Dieses Kapitel stellt den Autor Ishikawa Kyūyō und sein Werk "Kanji to Ajia: Kanji kara bunmeiken no rekishi wo yomu" vor. Es bietet Einblicke in Ishikawas Expertise als Kalligraf und Kalligrafiehistoriker und skizziert den thematischen Schwerpunkt seines Buches – die Entstehung und Verbreitung der chinesischen Schriftzeichen in Ostasien. Es wird die Bedeutung des Werkes für das Verständnis der kulturellen und politischen Dynamiken Ostasiens hervorgehoben. Das Kapitel dient als Grundlage für die anschließende Übersetzung und Kontextualisierung.
3 Die Übersetzung aus dem Japanischen: Hier wird der Übersetzungsprozess des ausgewählten Abschnitts aus Ishikawas Buch detailliert beschrieben. Es werden die gewählten Übersetzungsstrategien erläutert und die dabei auftretenden Schwierigkeiten und Lösungsansätze dargelegt. Dieser Abschnitt gibt Einblicke in die Herausforderungen der Übersetzung eines fachsprachlichen Textes mit kulturellen und sprachlichen Besonderheiten. Die Bedeutung präziser Terminologie und die Notwendigkeit kultureller Kontextualisierung werden hervorgehoben.
4 Zur Erstellung der deutschen Übersetzung: Dieses Kapitel analysiert die methodischen Schritte der Übersetzung, die Herausforderungen bei der Wiedergabe der Nuancen der Originalsprache und die getroffenen Entscheidungen bezüglich der Terminologie und Stilistik. Es beleuchtet die Übersetzungsstrategie im Detail und erklärt die Entscheidungen zur Wahl von bestimmten Wörtern und Formulierungen in der deutschen Übersetzung. Die Schwerpunkte liegen auf der Bewältigung spezifischer sprachlicher und kultureller Hürden, um die intendierte Bedeutung des Originaltextes bestmöglich zu vermitteln.
5 Kontextualisierung ausgewählter Inhalte: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Kontextualisierung der übersetzten Textabschnitte. Es beleuchtet die Rolle der chinesischen Schrift als politisches Instrument, den Einfluss auf Identitätskonstruktionen in den verschiedenen ostasiatischen Kulturen und Aspekte sprachwissenschaftlicher Disziplinen, wie Ishikawas Bezug zu Saussure. Die verschiedenen Unterkapitel analysieren die geschichtliche Entwicklung und die vielfältigen kulturellen Implikationen des chinesischen Schriftsystems. Der Zusammenhang zwischen Schrift und politischer Macht, Identität und sprachwissenschaftlicher Theorie wird detailliert untersucht.
Schlüsselwörter
Chinesische Schriftzeichen, Ostasien, Japan, Korea, Vietnam, Ishikawa Kyūyō, Übersetzung, Kalligrafie, Identität, Politik, Sprachwissenschaft, Semiotik, Geschichtsschreibung, Kultur, Identitätskonstruktion.
Häufig gestellte Fragen zu "Kanji to Ajia" (Ishikawa Kyūyō)
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Werk des japanischen Kalligrafen und Kalligrafiehistorikers Ishikawa Kyūyō, insbesondere mit seinem Werk "Kanji to Ajia". Sie beinhaltet eine deutsche Übersetzung eines Teils des Originals, eine detaillierte Analyse des Übersetzungsprozesses, eine Kontextualisierung der ausgewählten Inhalte und eine Betrachtung der Rolle der chinesischen Schrift in Ostasien unter sprachwissenschaftlichen, politischen und identitätsbildenden Aspekten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Geschichte und Verbreitung der chinesischen Schrift in Ostasien, ihrer Funktion als politisches Instrument, der Konstruktion von Identität durch ihren Gebrauch und sprachwissenschaftlichen Perspektiven auf das chinesische Schriftsystem. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Einfluss der chinesischen Schrift auf Japan, Korea und Vietnam.
Wer ist Ishikawa Kyūyō?
Ishikawa Kyūyō ist ein japanischer Kalligraf und Kalligrafiehistoriker. Sein Werk "Kanji to Ajia" untersucht die Bedeutung der chinesischen Schrift für die ostasiatische Kultur und Geschichte. Die vorliegende Arbeit nutzt einen Auszug aus diesem Werk als Grundlage.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einleitung, die Vorstellung des Autors und seines Werkes, eine detaillierte Beschreibung des Übersetzungsprozesses, die Analyse der Übersetzung selbst, eine Kontextualisierung der ausgewählten Textabschnitte mit Fokus auf politische Instrumentalisierung, Identitätskonstruktionen und sprachwissenschaftliche Perspektiven (u.a. Bezug zu Saussure), und abschließend ein Fazit und Literaturverzeichnis. Ein Inhaltsverzeichnis ermöglicht die einfache Navigation.
Welche sprachwissenschaftlichen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht Ishikawas Position im Verhältnis zur Linguistik Saussures und betrachtet semiotische Aspekte der chinesischen Schrift. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Schrift als komplexes System mit kulturellen und politischen Implikationen.
Welche Rolle spielt die Politik?
Die Arbeit analysiert die chinesische Schrift als politisches Instrument, das zur Durchsetzung von Macht und zur Gestaltung von Identitäten in Ostasien genutzt wurde. Die Dominanz Chinas und die Verwendung der Schrift für politische Zwecke werden detailliert untersucht.
Wie wird Identität in diesem Kontext konstruiert?
Die Arbeit zeigt, wie der Gebrauch der chinesischen Schrift zur Konstruktion von Identität in den verschiedenen ostasiatischen Kulturen beitrug. Identität wird dabei durch Geschichtsschreibung, den Besitz einer eigenen Schrift und die Zugehörigkeit zu bestimmten Gesellschaftsschichten betrachtet.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich insbesondere an Studierende der Ostasienwissenschaften, besonders der Japanologie, die sich für die Geschichte der chinesischen Schrift, die Kultur Ostasiens und Übersetzungswissenschaft interessieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Chinesische Schriftzeichen, Ostasien, Japan, Korea, Vietnam, Ishikawa Kyūyō, Übersetzung, Kalligrafie, Identität, Politik, Sprachwissenschaft, Semiotik, Geschichtsschreibung, Kultur, Identitätskonstruktion.
- Quote paper
- Martin Glowatz (Author), 2020, Zur Rolle der chinesischen Schriftzeichen in ausgewählten Kulturen Ostasiens. Eine Übersetzungsarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1296554