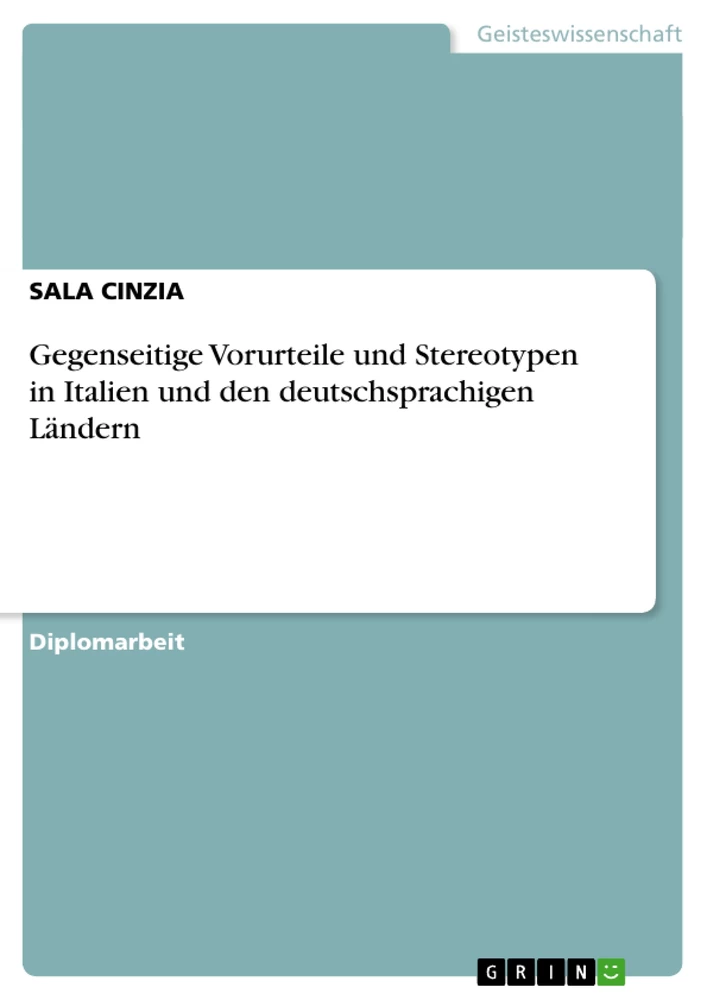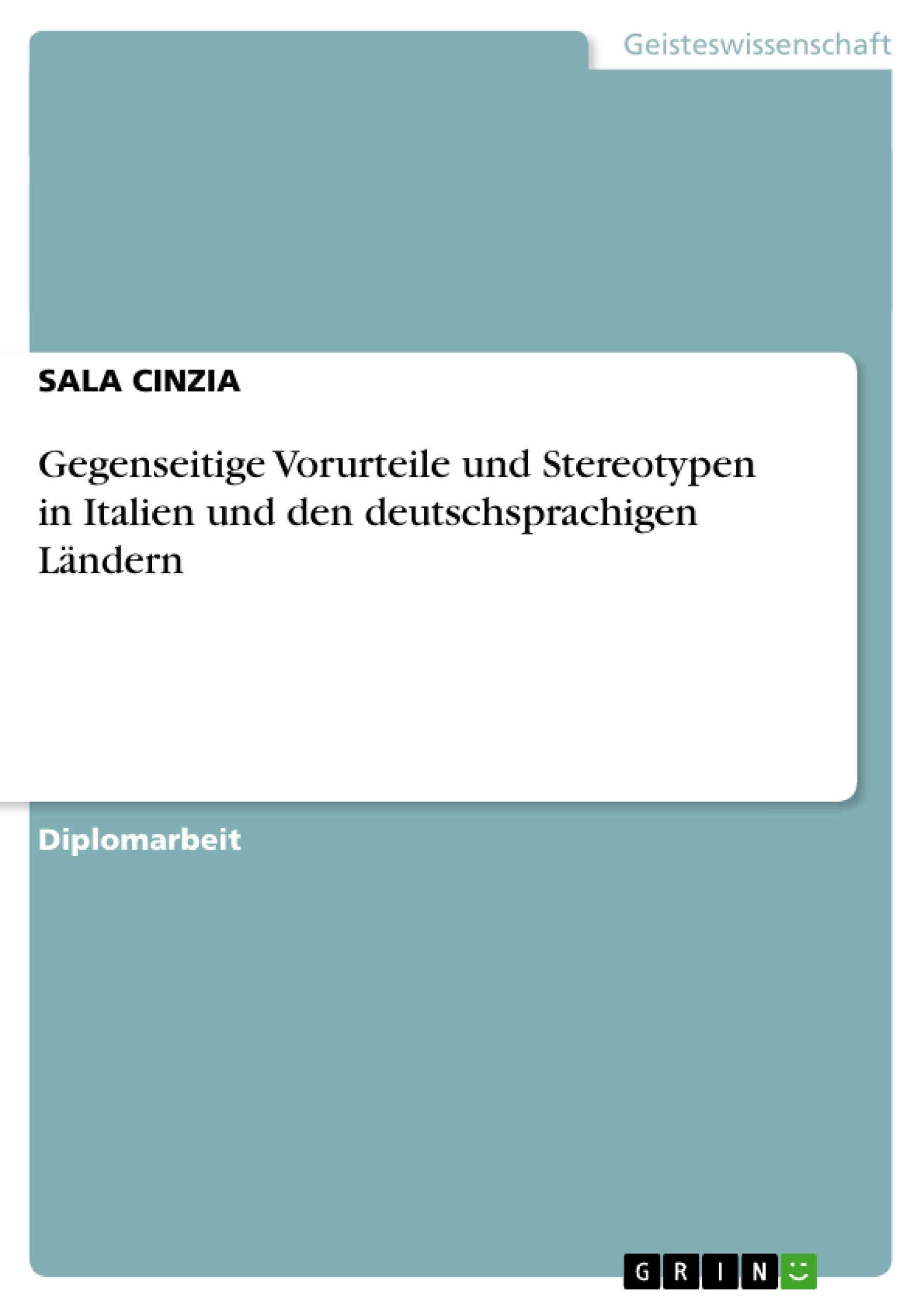Die Inspiration für meine Diplomarbeit ergab sich durch meinen Erasmusaufenthalt, als Studentin an der Universität Wien im Jahr 2007/2008. Auf diese Weise hatte ich die Möglichkeit, die kulturelle und soziale Vielfalt der deutschen Gesellschaft kennen zu lernen.
Aufgrund dieser Tatsache wurde ich mit manchen Stereotypen und Vorurteilen gegenüber den Italienern konfrontiert. Es ist anzunehmen, dass dies auf beiden Seiten zutrifft.So glaube ich, dass sowohl Deutsche bestimmte Vorurteile gegenüber den Italienern haben als auch die Italiener gegenüber den Deutschen. Dieses Thema hat mich sofort interessiert und ich habe beschlossen, es zum Thema meiner Diplomarbeit zu machen.
Deshalb habe ich mich entschlossen den Fokus meiner Arbeit auf die Länder Italien, Deutschland und Österreich zu legen.
Im ersten Kapitel werde ich die geschichtliche Dynamik der Beziehungen zwischen Deutschland und Italien rekonstruieren. Daraus wird ersichtlich, welche Faktoren für die Entwicklung des Verhältnisses zwischen den Staaten eine Rolle spielen.
Im zweiten Kapitel werde ich die heutigen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Italien erläutern, die durch gemeinsame Interessen und Ziele der beiden Nationen geprägt sind.
Des Weiteren werde ich über den Ursprung auf kultureller Ebene, hinsichtlich der Beziehungen zwischen den deutschsprachigen Ländern und Italien sprechen. Der Schriftsteller, den ich ausgewählt habe, ist Johann Wolfgang Goethe. Er gilt als bedeutendster deutscher Dichter, hatte von 1786-1788 in Italien gewohnt, wo er sich wie zu Hause fühlte.
In Kapitel Vier beleuchte ich die Frage, wie die heutige Situation der deutschsprachigen Länder und ihre Beziehungen zu Italien wahrgenommen werden.
Schließlich möchte ich die Einflüsse von Medien auf die Werte der italienischen und deutschen Gesellschaft darstellen. Durch praktische Beispiele wird gezeigt, wie Medien mit ihrer Informationsleistung und ihrem Einfluss, Stereotypen und Vorurteile aufbauen können.
Anhand von praktischen Beispielen der Medien: der Wochenzeitung „Der Spiegel“ in Deutschland, der Filmserie Fantozzi in Italien und der Werbung „Nescafè Cappuccino“ in Deutschland, wird dargestellt, wie Medien mit ihrer Informationsleistung und ihrem Einfluss Stereotypen und Vorurteile aufbauen können.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Deutschland und Italien: die Geschichte einer Beziehung
- 1.1 Die politischen Wurzeln von bekannten Stereotypen
- 1.2 Die heutigen Beziehungen: Deutschland, Österreich und Italien gemeinsam für Europa
- Kapitel 2: Politische, wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen zwischen Deutschland und Italien
- 2.1 Politische Beziehungen
- 2.2 Wirtschaftliche Beziehungen
- 2.3 Kulturelle Beziehungen
- Kapitel 3: „Italiensehnsucht” und Johann Wolfgang von Goethe
- 3.1 Das Tagebuch Die Italienische Reise
- 3.2 \"Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen”
- Kapitel 4: Gegenseitige Vorurteile in Italien und den deutschsprachigen Ländern
- 4.1 Vorurteile der Italiener gegenüber den Einwohnern deutschsprachiger Länder
- 4.2 Vorurteile der Einwohner deutschsprachiger Länder gegenüber den Italienern
- Kapitel 5: Praktische Beispiele aus den Medien
- 5.1 Funktion der Medien
- 5.2 „Der Spiegel“: Italien als Urlaubsland mit Entführungen, Erpressungen und Strassendieben
- 5.3 Internet
- 5.4 Fernsehen: Fantozzi der italienische Antiheld
- 5.5 Werbung: Herr Angelo für Nescafè Cappuccino (1993)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die gegenseitigen Vorurteile und Stereotypen zwischen Italien und deutschsprachigen Ländern. Die Autorin möchte die Hauptgründe für diese Stereotype aufzeigen und deren Entwicklung im deutsch-italienischen Verhältnis beleuchten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Positionierung beider Länder zueinander, insbesondere nach 1945.
- Die historische Entwicklung der deutsch-italienischen Beziehungen
- Gegenwärtige politische, wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen zwischen Deutschland und Italien
- Analyse von Stereotypen und Vorurteilen in beiden Richtungen
- Die Rolle der Medien bei der Verbreitung von Stereotypen
- Der Einfluss von Literatur (Goethe) auf das Bild des jeweils anderen Landes
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Deutschland und Italien: die Geschichte einer Beziehung: Dieses Kapitel untersucht die historischen Beziehungen zwischen Deutschland und Italien, um die Wurzeln gegenwärtiger Stereotypen aufzuzeigen. Es analysiert die politischen Ereignisse und Entwicklungen, die das gegenseitige Verständnis und die Wahrnehmung beider Länder beeinflusst haben. Der Fokus liegt auf der Rekonstruktion der historischen Dynamik und der Identifizierung von Schlüsselfaktoren, die das Verhältnis prägten.
Kapitel 2: Politische, wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen zwischen Deutschland und Italien: Hier werden die aktuellen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen zwischen Deutschland und Italien beleuchtet. Das Kapitel analysiert die gemeinsamen Interessen und Ziele beider Nationen, die ihre Beziehungen formen, und zeigt auf, wie diese Beziehungen durch die historische Entwicklung beeinflusst wurden. Es untersucht, wie politische Zusammenarbeit, wirtschaftlicher Austausch und kultureller Einfluss die gegenseitigen Wahrnehmungen prägen.
Kapitel 3: „Italiensehnsucht” und Johann Wolfgang von Goethe: Dieses Kapitel untersucht Goethes Italienreise und dessen literarische Darstellung Italiens. Es analysiert, wie Goethes subjektive Erfahrungen und Beobachtungen das deutsche Bild von Italien geprägt haben und ob diese Darstellung Stereotypen verstärkt oder korrigierte. Der Fokus liegt auf der Analyse von „Die Italienische Reise“ und dem Gedicht „Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen“, um den Einfluss der Literatur auf die Vorstellungswelt der Deutschen zu untersuchen.
Kapitel 4: Gegenseitige Vorurteile in Italien und den deutschsprachigen Ländern: Dieses Kapitel widmet sich explizit den Stereotypen und Vorurteilen, die Italiener gegenüber Deutschsprachigen und umgekehrt hegen. Es beleuchtet die spezifischen Vorurteile und untersucht die Ursachen und die gesellschaftliche Bedeutung dieser Phänomene. Die Analyse befasst sich sowohl mit den Wurzeln als auch den Folgen dieser Vorurteile.
Kapitel 5: Praktische Beispiele aus den Medien: In diesem Kapitel werden konkrete Beispiele aus Medien wie „Der Spiegel“, dem Internet, dem Fernsehen und der Werbung analysiert, um aufzuzeigen, wie Stereotypen und Vorurteile in der öffentlichen Kommunikation reproduziert und verstärkt werden. Es untersucht die Funktion der Medien und deren Einfluss auf die Meinungsbildung und die Entstehung von Klischees. Die ausgewählten Beispiele illustrieren die Wirkung medialer Darstellungen auf die Wahrnehmung Italiens und seiner Bevölkerung in deutschsprachigen Ländern und umgekehrt.
Schlüsselwörter
Vorurteile, Stereotype, Italien, Deutschland, Österreich, deutsch-italienische Beziehungen, Kultur, Geschichte, Politik, Wirtschaft, Medien, Goethe, „Italienische Reise“, Klischees, nationale Identität.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Deutschland und Italien - Eine Beziehung im Spiegel von Vorurteilen und Stereotypen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die gegenseitigen Vorurteile und Stereotypen zwischen Italien und deutschsprachigen Ländern. Sie beleuchtet die historischen Wurzeln dieser Stereotype und deren Entwicklung im deutsch-italienischen Verhältnis, insbesondere nach 1945. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Positionierung beider Länder zueinander und der Rolle der Medien bei der Verbreitung dieser Stereotype.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der deutsch-italienischen Beziehungen, die gegenwärtigen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Italien, eine Analyse von Stereotypen und Vorurteilen in beiden Richtungen, die Rolle der Medien bei der Verbreitung von Stereotypen sowie den Einfluss von Literatur (Goethe) auf das Bild des jeweils anderen Landes.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem einzelnen Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 untersucht die historischen Beziehungen zwischen Deutschland und Italien und die Wurzeln gegenwärtiger Stereotypen. Kapitel 2 beleuchtet die aktuellen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen zwischen beiden Ländern. Kapitel 3 analysiert Goethes Italienreise und deren Einfluss auf das deutsche Bild Italiens. Kapitel 4 widmet sich den spezifischen Vorurteilen, die Italiener gegenüber Deutschsprachigen und umgekehrt hegen. Kapitel 5 analysiert konkrete Beispiele aus verschiedenen Medien, um die Reproduktion und Verstärkung von Stereotypen in der öffentlichen Kommunikation aufzuzeigen.
Welche Rolle spielt Johann Wolfgang von Goethe in dieser Arbeit?
Goethes Italienreise und seine literarischen Darstellungen Italiens werden analysiert, um zu untersuchen, wie seine subjektiven Erfahrungen und Beobachtungen das deutsche Bild von Italien geprägt haben und ob diese Darstellung Stereotypen verstärkt oder korrigierte. "Die Italienische Reise" und das Gedicht "Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen" stehen im Fokus dieser Analyse.
Wie werden die Medien in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert konkrete Beispiele aus Medien wie "Der Spiegel", dem Internet, dem Fernsehen und der Werbung. Es wird untersucht, wie Stereotypen und Vorurteile in der öffentlichen Kommunikation reproduziert und verstärkt werden und wie die Medien die Meinungsbildung und die Entstehung von Klischees beeinflussen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Vorurteile, Stereotype, Italien, Deutschland, Österreich, deutsch-italienische Beziehungen, Kultur, Geschichte, Politik, Wirtschaft, Medien, Goethe, „Italienische Reise“, Klischees, nationale Identität.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich für die deutsch-italienischen Beziehungen, die Geschichte der gegenseitigen Wahrnehmung und die Rolle von Vorurteilen und Stereotypen in der internationalen Kommunikation interessieren. Sie eignet sich insbesondere für akademische Zwecke und die Analyse von Themen im Bereich der Kulturwissenschaften, Geschichtswissenschaften und Medienwissenschaften.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Der vollständige Text ist bei der entsprechenden Verlagsgesellschaft erhältlich. (Anmerkung: Diese Information muss vom Nutzer ergänzt werden.)
- Citar trabajo
- SALA CINZIA (Autor), 2009, Gegenseitige Vorurteile und Stereotypen in Italien und den deutschsprachigen Ländern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129630