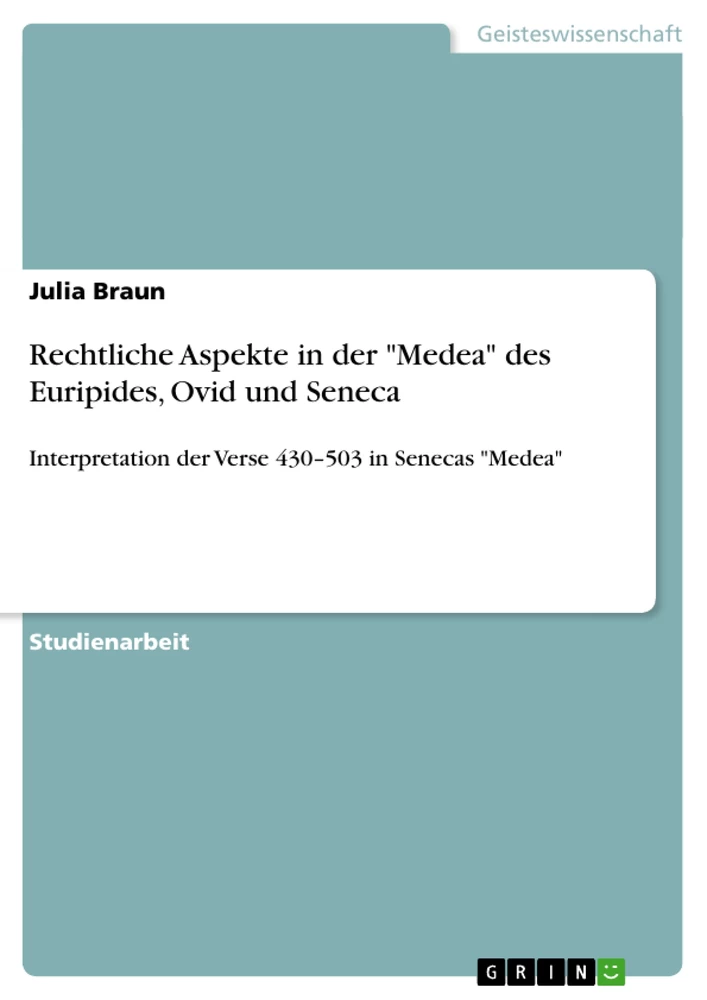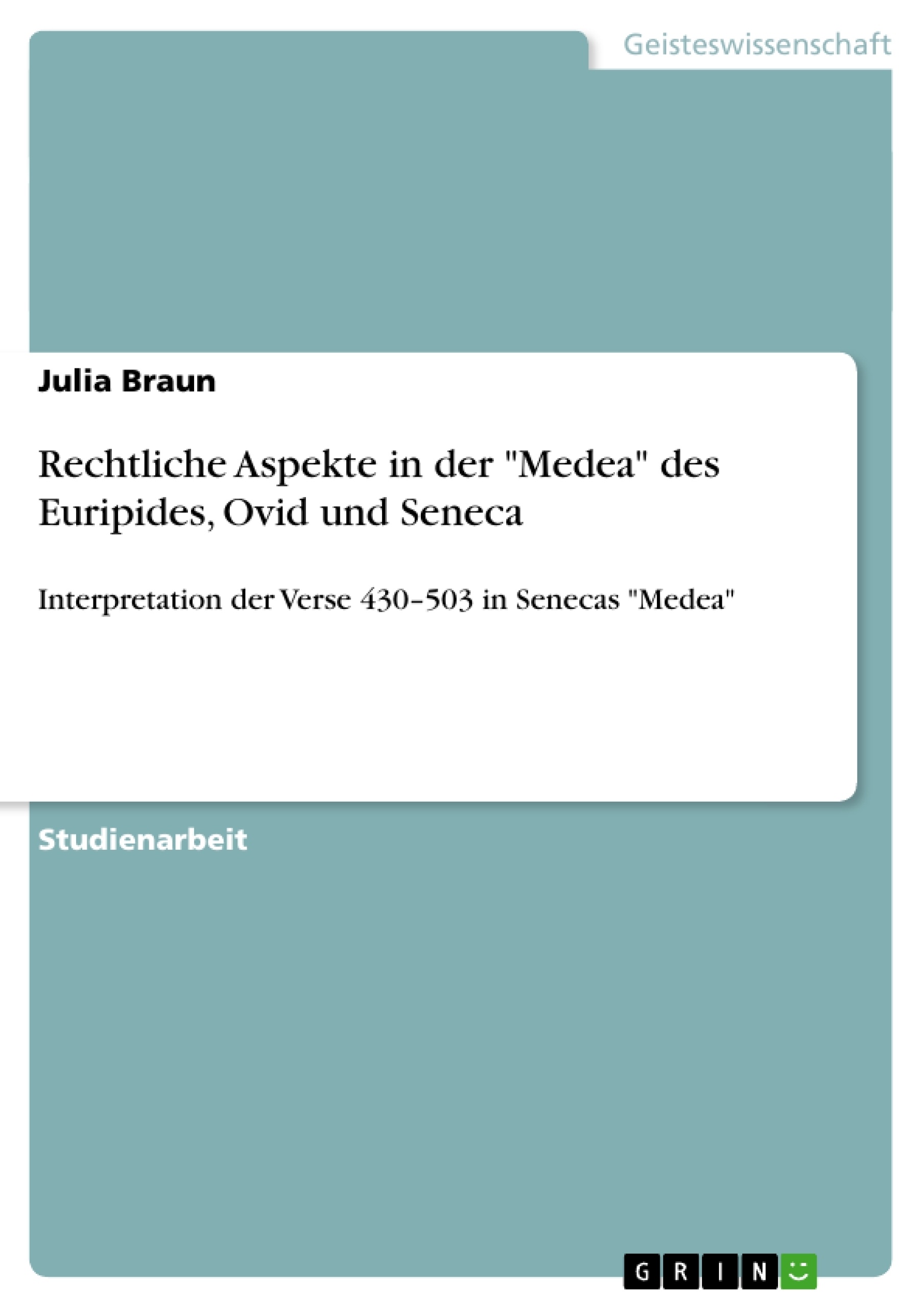In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit den rechtlichen Aspekten in der Medea des Euripides, Ovid und Seneca. Am Anfang eines neuen Kapitels werden die einzelnen Werke kurz vorgestellt werden, dann werde ich anhand ausgewählter Passagen Merkmale herausarbeiten, anhand derer aufgezeigt werden kann, welche rechtliche Einstellung der Autor seinen Protagonisten andichtete. Natürlich werden die rechtlichen Vorstellungen, die zu der Zeit der Uraufführung bzw. der Erscheinung des Werkes herrschten, dazu herangezogen.
Ich werde nicht die gesamte Medea des Seneca und des Euripides analysieren, sondern mich auf die Begegnungen und Streitgespräche Medeas mit Creo und mit Iason beschränken, da ich vor allem das „Strafrecht“ näher betrachten möchte. Der größte Teil der Arbeit aber wird zur Thematisierung der senecanischen Medea verwendet werden. Hier spielt besonders die Begegnung zwischen Medea und Iason eine gewichtige Rolle, da diese zwei Personen sich in ihrem Handeln und Denken gegenseitig am stärksten beeinflussen. Die Übersetzung der Verse 431–503 vor der eigentlichen Interpretation dient dazu, dass der Leser den Schlagabtausch zwischen Medea und Iason unmittelbar vor Augen hat, wenn er die Interpretation liest. Im Abschluss der Arbeit werde ich die vier „Medeen“ der drei Autoren vergleichen und eventuelle Beeinflussungen aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1. Die Medea des Euripides
- 2.1.1. Allgemeines zum Recht während der Entstehungszeit der Medea des Euripides
- 2.1.2. Rechtliche Aspekte in der Medea des Euripides anhand ausgewählter Passagen
- 2.2. Die Medea des Ovid
- 2.2.1. Das römische Recht
- 2.2.2. Rechtliche Aspekte im Brief der Medea in den Epistulae Heroidum
- 2.2.3. Rechtliche Aspekte in der Medea-Thematik der Metamorphoses
- 2.3. Die Medea des Seneca
- 2.3.1. Seneca und Medea
- 2.3.2. Rechtliche Aspekte in der Medea des Seneca in der Begegnung mit Creo
- 2.3.3. Übersetzung der Verse 431-503
- 2.3.4. Rechtliche Aspekte in der Medea des Seneca in der Begegnung mit Iason
- 2.1. Die Medea des Euripides
- 3. Schluss
- 3.1. Senecas „Medea“ im Vergleich mit der des Euripides und des Ovid
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die rechtlichen Aspekte in den Medea-Darstellungen von Euripides, Ovid und Seneca. Ziel ist es, anhand ausgewählter Passagen die rechtliche Einstellung der Autoren gegenüber ihren Protagonistinnen zu analysieren und diese mit den zeitgenössischen Rechts- und Moralvorstellungen zu vergleichen. Der Fokus liegt dabei auf den Begegnungen Medeas mit Creo und Iason, um Aspekte des „Strafrechts“ näher zu beleuchten. Die senecanische Medea nimmt dabei den größten Raum ein.
- Rechtliche und moralische Vorstellungen des antiken Athen und Roms
- Die Rolle der Frau und Mutter in den jeweiligen Gesellschaften
- Die Darstellung von Tötung, Rache und Gastrecht in den drei Werken
- Vergleich der Medea-Interpretationen bei Euripides, Ovid und Seneca
- Analyse der rechtlichen Implikationen von Medeas Handlungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Analyse der rechtlichen Aspekte in den Medea-Darstellungen von Euripides, Ovid und Seneca. Es wird der Fokus auf ausgewählte Passagen und die Berücksichtigung der zeitgenössischen Rechts- und Moralvorstellungen betont. Die Beschränkung auf die Begegnungen Medeas mit Creo und Iason und die besondere Bedeutung der senecanischen Medea werden hervorgehoben. Die Arbeit schließt mit einer kurzen Zusammenfassung der griechischen Medea-Sage.
2.1. Die Medea des Euripides: Dieses Kapitel beginnt mit einer kurzen Einführung in das antike Athen und die dort geltenden Rechtsvorstellungen im 5. Jahrhundert v. Chr., die eher auf moralischen Übereinkünften als auf kodifizierten Gesetzen basierten. Es werden die damaligen moralischen Auffassungen zu Themen wie Tötung, Gastrecht, Eheleben und der Stellung der Frau diskutiert. Im Anschluss wird die Analyse ausgewählter Passagen aus Euripides' Medea vorgenommen, um die rechtlichen und moralischen Aspekte der Handlung zu beleuchten. Die erste Szene des Chors wird als Beispiel für die damaligen Moralvorstellungen gegenüber Frauen herangezogen.
2.2. Die Medea des Ovid: Das Kapitel befasst sich mit der Darstellung Medeas bei Ovid, wobei sowohl das römische Recht als auch die jeweiligen literarischen Kontexte der "Epistulae Heroidum" und der "Metamorphosen" berücksichtigt werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Interpretation der rechtlichen Aspekte in den jeweiligen Textpassagen, die Medeas Handlungen und Motive beleuchten. Der Vergleich mit den rechtlichen und moralischen Vorstellungen des römischen Reiches wird im Detail ausgeführt.
2.3. Die Medea des Seneca: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Senecas Medea. Es wird Senecas Interpretation der Medea-Figur und die relevanten rechtlichen und philosophischen Aspekte seiner Zeit betrachtet. Die Begegnungen Medeas mit Creo und Iason werden im Detail analysiert, wobei die Übersetzung der Verse 431-503 zur besseren Lesbarkeit und zum Verständnis bereitgestellt wird. Die rechtlichen Implikationen von Medeas Handlungen in diesen Begegnungen werden im Hinblick auf die damalige Rechtsauffassung und Moral bewertet.
Schlüsselwörter
Medea, Euripides, Ovid, Seneca, Recht, Moral, antikes Athen, römisches Recht, Tötung, Rache, Gastrecht, Frau, Mutter, Tragödie, Interpretation, Vergleichende Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Rechtlichen Aspekte in den Medea-Darstellungen von Euripides, Ovid und Seneca
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die rechtlichen Aspekte in den Medea-Darstellungen der drei antiken Autoren Euripides, Ovid und Seneca. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der jeweiligen rechtlichen und moralischen Auffassungen der Autoren mit den zeitgenössischen Rechts- und Moralvorstellungen in Athen und Rom.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die rechtliche Einstellung der Autoren gegenüber Medea und vergleicht diese mit den zeitgenössischen Rechts- und Moralvorstellungen. Der Schwerpunkt liegt auf Medeas Begegnungen mit Creo und Iason, um Aspekte des „Strafrechts“ zu beleuchten. Die senecanische Medea wird dabei besonders ausführlich behandelt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit den rechtlichen und moralischen Vorstellungen des antiken Athen und Roms, der Rolle der Frau und Mutter in diesen Gesellschaften, der Darstellung von Tötung, Rache und Gastrecht in den drei Werken, einem Vergleich der Medea-Interpretationen bei Euripides, Ovid und Seneca sowie der Analyse der rechtlichen Implikationen von Medeas Handlungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil mit drei Unterkapiteln (Euripides', Ovids und Senecas Medea) und einen Schluss. Der Hauptteil analysiert jeweils die rechtlichen Aspekte in den ausgewählten Textpassagen und setzt diese in den Kontext der zeitgenössischen Rechts- und Moralvorstellungen. Der Schluss vergleicht die drei Medea-Darstellungen miteinander.
Was wird im Kapitel zu Euripides' Medea behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt zunächst das antike athenische Recht und die moralischen Auffassungen des 5. Jahrhunderts v. Chr. Anschließend wird eine Analyse ausgewählter Passagen aus Euripides' Medea vorgenommen, um die rechtlichen und moralischen Aspekte der Handlung zu beleuchten. Die erste Szene des Chors dient als Beispiel für die damaligen Moralvorstellungen gegenüber Frauen.
Was wird im Kapitel zu Ovids Medea behandelt?
Dieses Kapitel untersucht Ovids Darstellung Medeas, wobei sowohl das römische Recht als auch die literarischen Kontexte der "Epistulae Heroidum" und der "Metamorphosen" berücksichtigt werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Interpretation der rechtlichen Aspekte in den jeweiligen Textpassagen und deren Vergleich mit den rechtlichen und moralischen Vorstellungen des römischen Reiches.
Was wird im Kapitel zu Senecas Medea behandelt?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf Senecas Medea und betrachtet seine Interpretation der Medea-Figur sowie die relevanten rechtlichen und philosophischen Aspekte seiner Zeit. Die Begegnungen Medeas mit Creo und Iason werden detailliert analysiert, inklusive einer Übersetzung der Verse 431-503. Die rechtlichen Implikationen von Medeas Handlungen werden im Hinblick auf die damalige Rechtsauffassung und Moral bewertet.
Was wird im Schlusskapitel behandelt?
Das Schlusskapitel vergleicht Senecas „Medea“ mit den Darstellungen bei Euripides und Ovid.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Medea, Euripides, Ovid, Seneca, Recht, Moral, antikes Athen, römisches Recht, Tötung, Rache, Gastrecht, Frau, Mutter, Tragödie, Interpretation, Vergleichende Literaturwissenschaft.
- Quote paper
- Julia Braun (Author), 2009, Rechtliche Aspekte in der "Medea" des Euripides, Ovid und Seneca, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129618