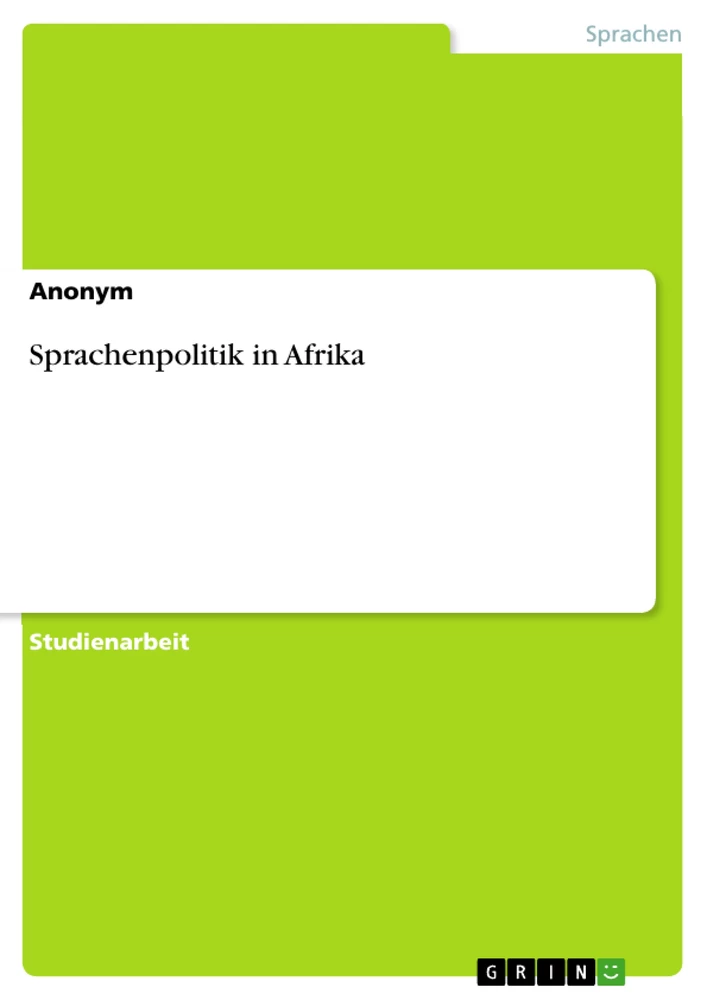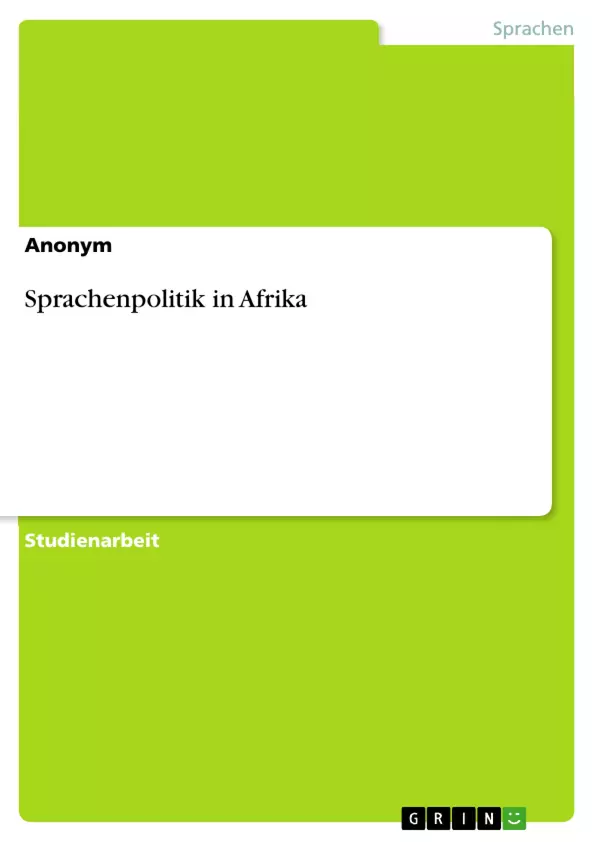1. Einleitung
Mit etwa 967 Millionen Einwohnern leben auf dem afrikanischen Kontinent ungefähr 14,4 % der Weltbevölkerung. Es ist kaum vorstellbar, dass dort knapp 35 % aller menschlichen Sprachen gesprochen werden. Wissenschaftler schätzen die Zahl der in Afrika gesprochenen Sprachen, die gegenseitig nicht verständlich sind, auf über 1.500 (vgl. Gerhardt 271+272).
„Sprache ist eines der wichtigsten Identifikationsmerkmale, sowohl fürs Indivi-duum als auch fürs Kollektiv“ (Brüll). Die Sprache dient aber nicht nur der Identifikation, sondern vor allem auch der Kommunikation. Die Kommunikation ist in den Staaten Afrikas besonders problematisch. So sprechen Afrikaner und Afrikanerinnen im Privatleben in ihrer Muttersprache. Sobald sie mit Menschen kommunizieren müssen, die eine andere einheimische Sprache sprechen, verwenden sie eine Verkehrssprache. Zur Verständigung in den Schulen, der Politik, der Wirtschaft, der Justiz und in der Verwaltung muss die Bevölkerung normalerweise, zumindest in sehr vielen afrikanischen Staaten, die importierte Sprache der einstigen Kolonialherren beherrschen. Allerdings versteht und spricht in der Regel nur eine geringe Prozentzahl der afrikanischen Bevölkerung die importierte Sprache (vgl. Brenzinger Matthi-as).
Eine Aufgabe Afrikas liegt darin, die Probleme zu lösen, die der Sprachenpluralismus mit sich bringt. Hierfür braucht der Kontinent eine optimale Sprachenpolitik. Darunter versteht man politische Maßnahmen und Regelungen, die hauptsächlich in Ländern oder Organisationen getroffen werden müssen, in denen mehrere Sprachen gesprochen oder angewandt werden. Diese Regeln beeinflussen die Stellung, die Entwicklung und die Verwendung der Sprachen in dem jeweiligen Land oder der betroffenen Organisation (vgl. Wikipedia).
In der folgenden Arbeit soll die Sprachenpolitik in Afrika vorgestellt werden. Hierbei wird auf endoglossische und exoglossische Nationen eingegangen, die anhand einiger Beispiele genauer dargestellt werden sollen. Außerdem geht die Arbeit auf die Vor- und Nachteile des Sprachenpluralismus, auf die Probleme der Bildungspolitik und auf den kenianischen Schriftsteller Ngũgĩ wa Thiong'o ein. Zusammenfassend wird der Staat Südafrika in Hinblick auf die Sprachenpolitik vorgestellt. Zuerst werden die Bezeichnungen offizielle Sprache, Nationalsprache und Verkehrs-sprache definiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Offizielle Sprachen, Nationalsprachen und Verkehrssprachen in Afrika
- Endoglossische und exoglossische Nationen
- Endoglossische Nationen
- Staaten mit aktiver endoglossischer Politik – erklärt am Beispiel des Staates Somalia
- Staaten ohne aktive endoglossische Politik – erklärt am Beispiel des Staates Botsuana
- Exoglossische Nationen
- Exoglossische Nationen mit der offiziellen Sprache Englisch - erklärt am Beispiel des Staates Sambia
- Exoglossische Nationen mit der offiziellen Sprache Französisch - erklärt am Beispiel des Staates Togo
- Endoglossische Nationen
- Die Sprachenpolitik nach der Kolonialzeit – endoglossisch oder exoglossisch
- Vor- und Nachteile des Sprachenpluralismus in Afrika
- Sprachenpluralismus als Konfliktpotential?
- Sprachenpluralismus und Bildungspolitik
- Die Sprachenpolitik und ihre Auswirkungen auf die Literatur am Beispiel des kenianischen Schriftstellers Ngũgĩ wa Thiong'o - die Erfahrungen einer deutschen Austauschstudentin
- Sprachenpolitik in Südafrika als zusammenfassendes Beispiel
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Sprachenpolitik in Afrika, beleuchtet die Herausforderungen des Sprachenpluralismus und analysiert verschiedene nationale Strategien. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der komplexen Interaktion zwischen Sprache, Politik und Gesellschaft in Afrika zu vermitteln.
- Definition und Unterscheidung offizieller Sprachen, Nationalsprachen und Verkehrssprachen in Afrika
- Analyse endoglossischer und exoglossischer Nationen anhand konkreter Beispiele
- Bewertung der Vor- und Nachteile des Sprachenpluralismus und dessen Potential für Konflikte
- Der Einfluss der Sprachenpolitik auf die Bildungspolitik und die Literatur
- Die Sprachenpolitik Südafrikas als Fallbeispiel
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Sprachenpolitik in Afrika ein und beschreibt die große sprachliche Vielfalt des Kontinents mit über 1500 gegenseitig unverständlichen Sprachen. Sie betont die Bedeutung der Sprache für Identität und Kommunikation und hebt die Herausforderungen des Sprachenpluralismus und die Notwendigkeit einer effektiven Sprachenpolitik hervor. Die Arbeit skizziert ihren weiteren Verlauf, der sich mit endoglossischen und exoglossischen Nationen, den Vor- und Nachteilen des Sprachenpluralismus, der Bildungspolitik und der Literatur sowie der Sprachenpolitik Südafrikas auseinandersetzt.
Offizielle Sprachen, Nationalsprachen und Verkehrssprachen in Afrika: Dieses Kapitel differenziert zwischen offiziellen Sprachen (gesetzlich festgelegt und in Politik, Justiz etc. verwendet), Nationalsprachen (einheimische, oft politisch neutrale Sprachen) und Verkehrssprachen (Lingua franca zur Verständigung verschiedener Muttersprachen). Es verdeutlicht die oft unterschiedliche Bedeutung dieser Begriffe im afrikanischen Kontext im Gegensatz zur Situation in Ländern wie Deutschland, wo oft eine Überschneidung besteht. Das Kapitel betont die meist kolonial geprägte Realität vieler afrikanischer Staaten, in denen die offiziellen Sprachen oft den Sprachen der ehemaligen Kolonialmächte entsprechen.
Endoglossische und exoglossische Nationen: Dieses Kapitel beschreibt endoglossische Nationen, die eine einheimische Sprache als offizielle Sprache verwenden (mit oder ohne aktive Förderung dieser Sprache), und exoglossische Nationen, die eine importierte Sprache (meist europäisch) als offizielle Sprache bevorzugen. Es analysiert die unterschiedlichen Strategien anhand von Beispielen wie Somalia (aktive endoglossische Politik) und möglicherweise Botsuana (ohne aktive endoglossische Politik), sowie Sambia und Togo als Beispiele für exoglossische Nationen mit Englisch bzw. Französisch als Amtssprache. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Ansätzen zur Sprachpolitik und ihren jeweiligen Auswirkungen.
Schlüsselwörter
Sprachenpolitik, Afrika, Sprachenpluralismus, Endoglossie, Exoglossie, Offizielle Sprache, Nationalsprache, Verkehrssprache, Kolonialismus, Bildungspolitik, Literatur, Ngũgĩ wa Thiong'o, Südafrika.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Sprachenpolitik in Afrika
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der Sprachenpolitik in Afrika. Sie analysiert die Herausforderungen des Sprachenpluralismus und untersucht verschiedene nationale Strategien zur Sprachregelung. Der Fokus liegt auf dem komplexen Zusammenspiel von Sprache, Politik und Gesellschaft auf dem afrikanischen Kontinent.
Welche Sprachen werden in Afrika unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen offiziellen Sprachen (gesetzlich festgelegt und in der Verwaltung verwendet), Nationalsprachen (einheimische Sprachen, oft politisch neutral) und Verkehrssprachen (Lingua franca zur Verständigung verschiedener Gruppen). Es wird hervorgehoben, dass diese Begriffe im afrikanischen Kontext anders gewichtet sein können als beispielsweise in Deutschland.
Was sind endoglossische und exoglossische Nationen?
Endoglossische Nationen verwenden eine einheimische Sprache als offizielle Sprache, gegebenenfalls mit aktiver Förderung. Exoglossische Nationen bevorzugen eine importierte Sprache (meist europäisch) als Amtssprache. Die Arbeit analysiert diese Strategien anhand von Beispielen wie Somalia (aktive endoglossische Politik), Botsuana (ohne aktive endoglossische Politik), Sambia (Englisch als Amtssprache) und Togo (Französisch als Amtssprache).
Welche Auswirkungen hat der Sprachenpluralismus?
Die Arbeit untersucht die Vor- und Nachteile des Sprachenpluralismus in Afrika und beleuchtet das Potential für Konflikte. Sie analysiert den Einfluss der Sprachenpolitik auf die Bildungspolitik und die Literatur, unter anderem am Beispiel des kenianischen Schriftstellers Ngũgĩ wa Thiong'o und den Erfahrungen einer deutschen Austauschstudentin.
Welche Rolle spielt die Kolonialgeschichte?
Die Kolonialgeschichte spielt eine entscheidende Rolle. Viele afrikanische Staaten haben ihre Amtssprachen von den ehemaligen Kolonialmächten übernommen. Die Arbeit untersucht, wie sich diese koloniale Vergangenheit auf die aktuelle Sprachenpolitik auswirkt.
Wie wird die Sprachenpolitik Südafrikas dargestellt?
Die Sprachenpolitik Südafrikas dient als zusammenfassendes Beispiel, um die komplexen Herausforderungen und Lösungsansätze im Umgang mit Sprachenpluralismus zu veranschaulichen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu den verschiedenen Sprachtypen in Afrika, zu endoglossischen und exoglossischen Nationen, zu den Vor- und Nachteilen des Sprachenpluralismus, zum Einfluss auf die Bildungspolitik und Literatur, einem Fallbeispiel Südafrika und einem Schluss.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Sprachenpolitik, Afrika, Sprachenpluralismus, Endoglossie, Exoglossie, Offizielle Sprache, Nationalsprache, Verkehrssprache, Kolonialismus, Bildungspolitik, Literatur, Ngũgĩ wa Thiong'o, Südafrika.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der komplexen Interaktion zwischen Sprache, Politik und Gesellschaft in Afrika zu vermitteln und die Herausforderungen des Sprachenpluralismus zu beleuchten.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2009, Sprachenpolitik in Afrika, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129357