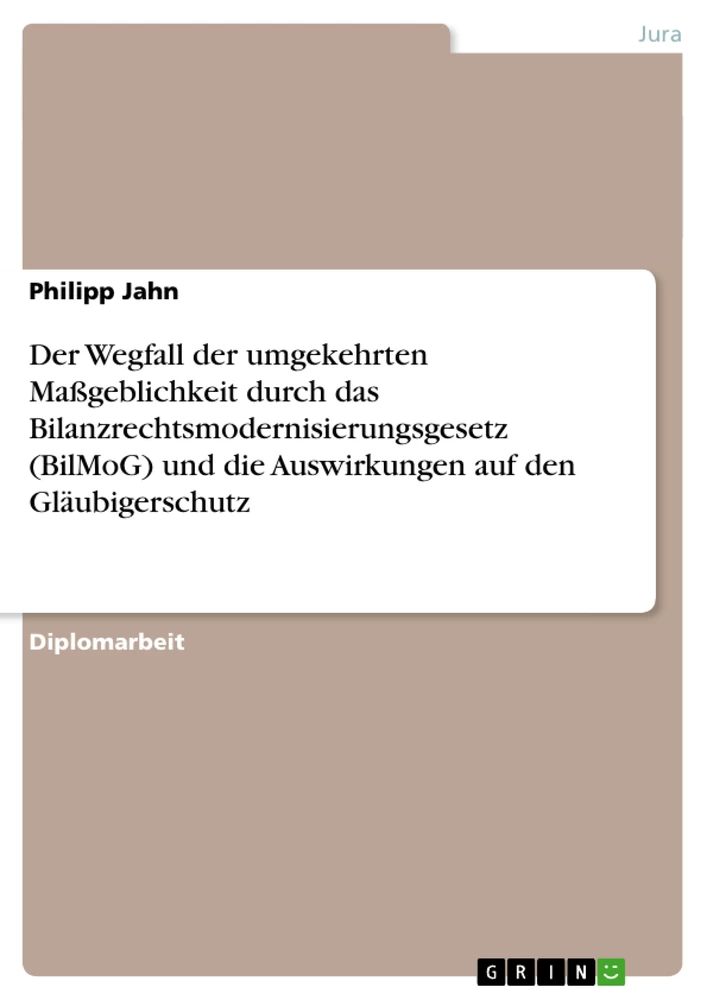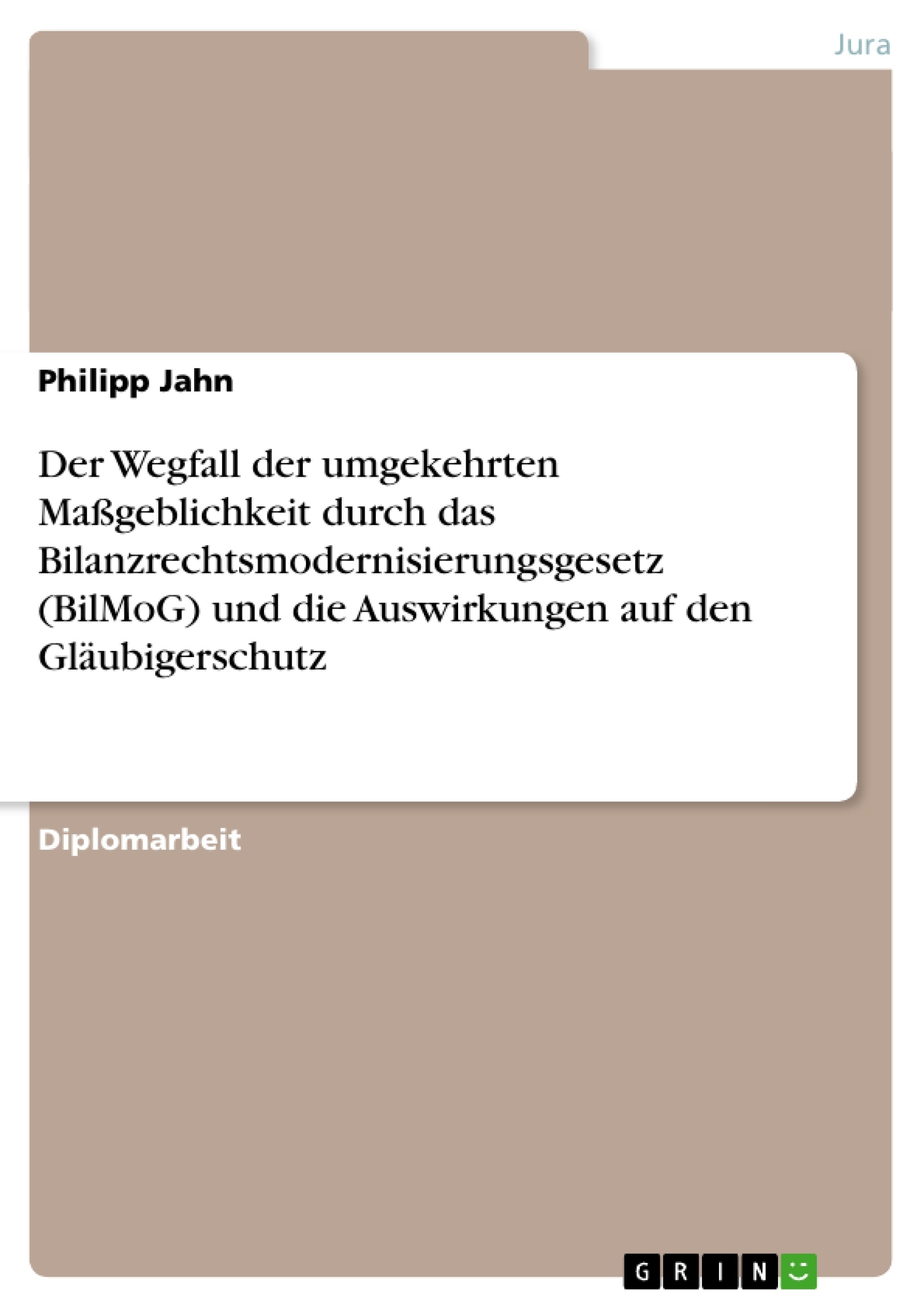Am 8. November 2007 wurde vom Bundesministerium der Justiz der Referentenentwurf des Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG) vorgestellt. Am 21. Mai 2008 folgte der Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Das BilMoG wird als die größte Bilanzrechtsreform seit dem Bilanzrichtliniengesetz (BiRiLiG) 1985 bezeichnet.
Es umfasst 12 Artikel, wodurch 31 Bundesgesetze und Rechtsverordnungen geändert werden. Das HGB-Bilanzrecht soll zu einer dauerhaften und im Verhältnis zu den internationalen Rechnungslegungsstandards, International Financial Reporting Standards (IFRS), vollwertigen, aber kostengünstigeren und einfacheren Alternative weiter entwickelt werden.
Es soll vor allem kleinen und mittelgroßen Unternehmen die Möglichkeit zur Nutzung eines modernen Bilanzrechts eröffnen, ohne direkt auf die IFRS übergehen zu müssen.
Der handelsrechtliche Jahresabschluss soll in seiner Informationsfunktion gestärkt werden und an internationaler Akzeptanz gewinnen. Der Gläubigerschutz des HGB und die Informationsfunktion der IFRS stehen danach auf einer Ebene.
Neben der Streichung von Wahlrechten werden dazu auch bewährte Grundprinzipien des Bilanzrechts durchbrochen bzw. aufgegeben.
Eines davon ist die Aufgabe des Grundsatzes der sog. umgekehrten Maßgeblichkeit, die als ein „ungeheuerlicher Übergriff des Steuerrechts auf die Institution der Handelsbilanz“ bezeichnet wird. Die Abkopplung der Handelsbilanz von der Steuerbilanz kann als „echter Befreiungsschlag“ gesehen werden.
Deren Abschaffung wurde von der Wirtschaftsprüferkammer, dem Institut der Wirtschaftsprüfer und dem Arbeitskreis Bilanzrecht der Hochschullehrer Rechtswissenschaft ausdrücklich begrüßt.
Die materielle Maßgeblichkeit sowie das System der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sollen als Eckpfeiler der handelsrechtlichen Rechnungslegung bestehen bleiben, um die Steuerneutralität weiterhin zu wahren.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz und seine rechtliche Umsetzung
- II. Grundlagen
- 1. Buchführungspflicht
- 2. System der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
- 3. Aufgaben von Handelsbilanz und Steuerbilanz
- III. Erfüllung der Gläubigerschutzfunktion im Handelsrecht
- 1. Definition des Gläubigerschutzes
- 2. Ansprüche des Handelsrechts zur Realisierung des Gläubigerschutzes
- B. Umsetzung der materiellen Maßgeblichkeit und der umgekehrten Maßgeblichkeit nach geltendem Recht
- I. Materielle Maßgeblichkeit
- 1. Definition
- 2. Umsetzung der materiellen Maßgeblichkeit
- II. Umgekehrte Maßgeblichkeit
- 1. Definition
- 2. Umsetzung der umgekehrten Maßgeblichkeit
- 3. Auswirkungen der umgekehrten Maßgeblichkeit
- a) Auswirkung auf den handelsrechtlichen Jahresabschluss
- b) Auswirkung auf die Ausschüttungsbemessungsfunktion
- c) Auswirkung auf die Akzeptanz des handelsrechtlichen Jahresabschlusses
- d) Auswirkung auf internationale Richtlinien
- I. Materielle Maßgeblichkeit
- C. Der Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz und die Auswirkungen auf den Gläubigerschutz
- I. Materielle Maßgeblichkeit nach Inkrafttreten des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes
- II. Umgekehrte Maßgeblichkeit nach Inkrafttreten des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes
- 1. Aufhebung mit Übergangsregelung
- 2. Beispiel zur Übergangsregelung
- 3. Auswirkungen des Wegfalls der umgekehrten Maßgeblichkeit
- a) Sonderposten mit Rücklageanteil
- al) Definition
- a2) Sonderposten mit Rücklageanteil nach dem Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit
- a3) Rücklage im Rahmen des Investitionsabzugsbetrages nach § 7g EStG
- a3.1) Regelung
- a3.2) Beispiel und Anwendung nach dem Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit
- a3.3) Auswirkungen auf den Gläubigerschutz
- a4) Rücklage für die Übertragung stiller Reserven nach § 6b EStG
- a4.1) Regelung
- a4.2) Beispiel und Anwendung nach dem Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit
- a4.3) Auswirkungen auf den Gläubigerschutz
- a5) Rücklage für im Voraus erhaltene Zuschüsse nach R 6.5 ESTR
- a5.1) Regelung
- a5.2) Anwendung nach dem Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit
- a5.3) Auswirkungen auf den Gläubigerschutz
- a6) Rücklage für die Übertragung stiller Reserven bei Ersatzbeschaffung nach R 6.6 EStR
- a6.1) Regelung
- a6.2) Beispiel und Anwendung nach dem Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit
- a6.3) Auswirkungen auf den Gläubigerschutz
- a7) Rücklage bei der Gewinnerhöhung durch Vereinigung von Forderungen und Verbindlichkeiten nach § 6 UmwStG
- a7.1) Regelung
- a7.2) Anwendung nach dem Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit
- a7.3) Auswirkungen auf den Gläubigerschutz
- b) Latente Steuern
- b1) Begriff und Regelung
- b2) Anwendung nach dem Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit
- b3) Auswirkungen auf den Gläubigerschutz
- a) Sonderposten mit Rücklageanteil
- D. Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
- Verzeichnis von Online-Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) und den Auswirkungen auf den Gläubigerschutz. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Grundlagen und die Umsetzung der materiellen und umgekehrten Maßgeblichkeit im Handelsrecht. Sie untersucht die Auswirkungen des Wegfalls der umgekehrten Maßgeblichkeit auf verschiedene Bereiche des Jahresabschlusses, insbesondere auf Sonderposten mit Rücklageanteil, latente Steuern und den Gläubigerschutz.
- Rechtliche Grundlagen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes
- Umsetzung der materiellen und umgekehrten Maßgeblichkeit im Handelsrecht
- Auswirkungen des Wegfalls der umgekehrten Maßgeblichkeit auf den Jahresabschluss
- Gläubigerschutz im Handelsrecht
- Analyse der Auswirkungen auf den Gläubigerschutz durch den Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und erläutert die Relevanz des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes für den Gläubigerschutz. Sie stellt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit dar.
Das zweite Kapitel behandelt die rechtlichen Grundlagen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes und seine Umsetzung. Es werden die Buchführungspflicht, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die Aufgaben von Handelsbilanz und Steuerbilanz erläutert. Außerdem wird die Bedeutung des Gläubigerschutzes im Handelsrecht dargestellt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Umsetzung der materiellen und umgekehrten Maßgeblichkeit nach geltendem Recht. Es werden die Definitionen und die Umsetzung beider Prinzipien im Jahresabschluss erläutert. Außerdem werden die Auswirkungen der umgekehrten Maßgeblichkeit auf den handelsrechtlichen Jahresabschluss, die Ausschüttungsbemessungsfunktion, die Akzeptanz des Jahresabschlusses und internationale Richtlinien dargestellt.
Das vierte Kapitel analysiert den Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz und die Auswirkungen auf den Gläubigerschutz. Es werden die Auswirkungen des Wegfalls auf verschiedene Bereiche des Jahresabschlusses, insbesondere auf Sonderposten mit Rücklageanteil und latente Steuern, untersucht. Außerdem werden die Auswirkungen auf den Gläubigerschutz im Detail betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), die umgekehrte Maßgeblichkeit, die materielle Maßgeblichkeit, den Gläubigerschutz, den handelsrechtlichen Jahresabschluss, Sonderposten mit Rücklageanteil, latente Steuern, die Ausschüttungsbemessungsfunktion und die Akzeptanz des Jahresabschlusses. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen des Wegfalls der umgekehrten Maßgeblichkeit auf diese Bereiche und untersucht die Folgen für den Gläubigerschutz.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Wegfall der "umgekehrten Maßgeblichkeit"?
Durch das BilMoG wurde die Pflicht abgeschafft, steuerliche Wahlrechte in der Handelsbilanz genauso auszuüben wie in der Steuerbilanz. Dies führt zu einer stärkeren Abkopplung der Handelsbilanz von der Steuerbilanz.
Wie wirkt sich das BilMoG auf den Gläubigerschutz aus?
Die Reform stärkt die Informationsfunktion des Jahresabschlusses. Kritisch geprüft wird jedoch, ob durch den Wegfall steuerlicher Bindungen die Ausschüttungsbemessungsfunktion und damit die Haftungsmasse für Gläubiger beeinflusst wird.
Was sind latente Steuern im Kontext des BilMoG?
Durch die Abkopplung von Handels- und Steuerbilanz entstehen Differenzen in den Wertansätzen. Latente Steuern dienen dazu, diese künftigen Steuerbe- oder -entlastungen im handelsrechtlichen Abschluss darzustellen.
Was passiert mit den "Sonderposten mit Rücklageanteil"?
Diese rein steuerrechtlichen Posten dürfen nach dem Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit nicht mehr in der Handelsbilanz ausgewiesen werden, was die Klarheit und internationale Vergleichbarkeit des Abschlusses erhöht.
Warum wurde das BilMoG eingeführt?
Ziel war es, das HGB-Bilanzrecht zu einer vollwertigen, aber kostengünstigeren Alternative zu den internationalen IFRS-Standards weiterzuentwickeln, insbesondere für mittelständische Unternehmen.
- Quote paper
- Philipp Jahn (Author), 2009, Der Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) und die Auswirkungen auf den Gläubigerschutz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/129114