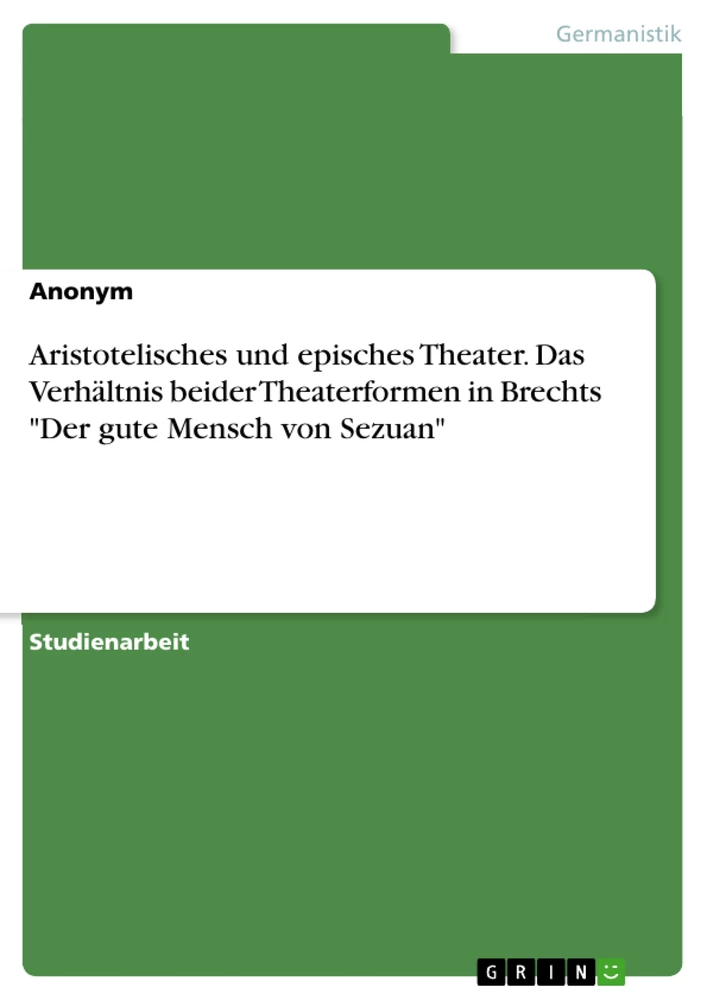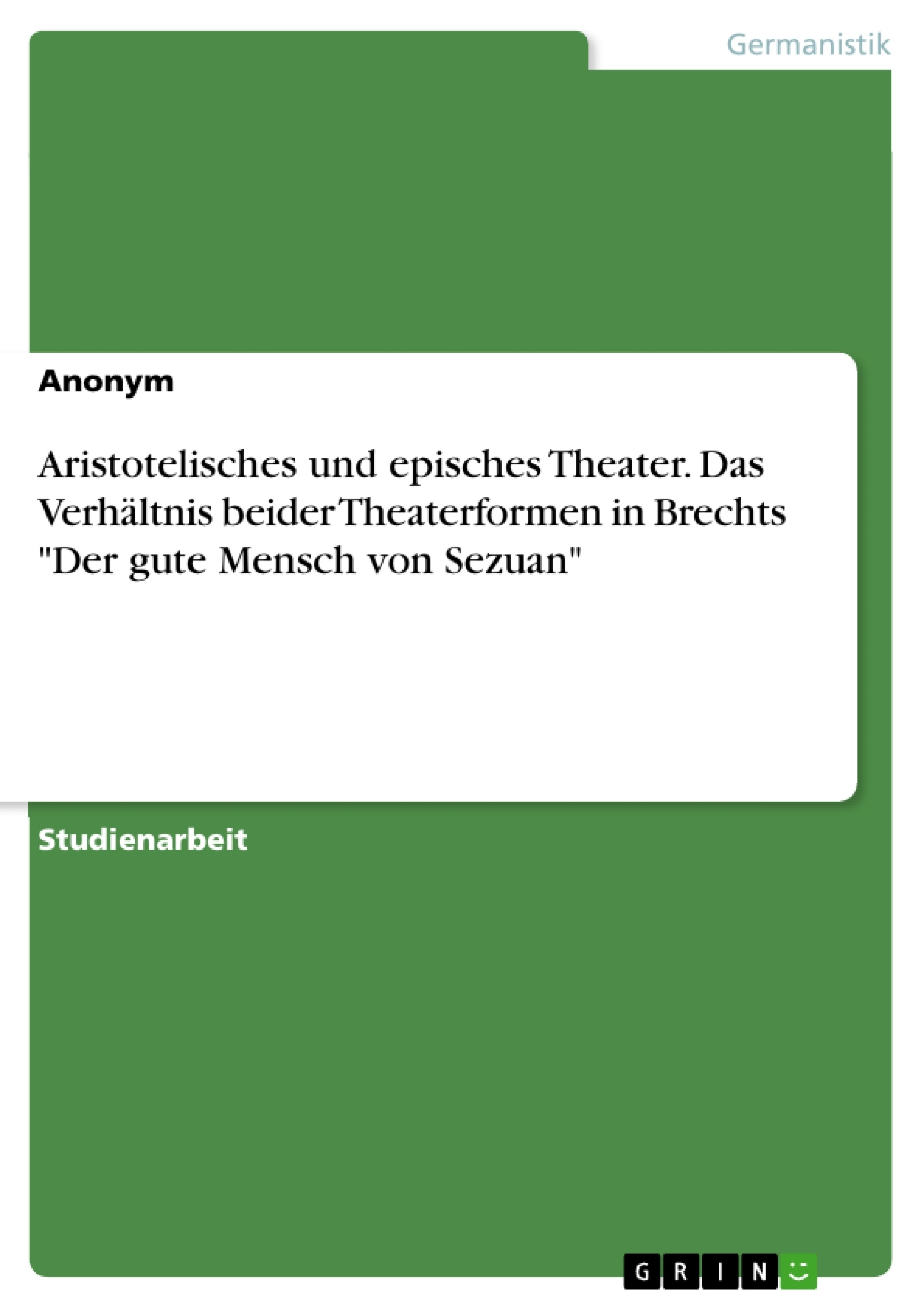Inwiefern sind Aussagen des harten Gegensatzes von aristotelischem und epischem Theater sowie Brechts solitärer Autorschaft dieser Theaterform legitim? Dieser Frage widmet sich die folgende Arbeit. Dabei wird einleitend das aristotelische Theater eingehend betrachtet, um auf dieser Folie anschließend in einer genauen Definition des epischen Theaters Differenzpunkte, aber möglicherweise auch Gemeinsamkeiten auszuarbeiten. Weiterhin soll dieser Vergleich exemplarisch an Brechts Stück "Der gute Mensch von Sezuan" erläutert werden, das, wie sich zeigen wird, für dieses Vorgehen in vielerlei Hinsicht eine ideale Grundlage darstellt. In einem abschließenden Fazit werden die Ergebnisse dieser Arbeit dann noch einmal zusammenfassend ausgewertet.
Sei es im Bewusstsein der Theaterbesucher*innen des 20. Jahrhunderts oder dem der Schüler*innen der vergangenen Jahrzehnte, das epische Theater ist untrennbar mit dem Namen Bertolt Brecht verbunden. Dieser Status sorgt dann auch für eine massenhafte Rezeption von Brechts Theatermodell, das ebenfalls unter der Bezeichnung nicht-aristotelisches Theater bekannt ist. Der Name legt es schon nahe: In der Mehrheit der Texte von gängigen Lehrmaterialien und -plattformen bis hin in einige Fachveröffentlichungen wird Brechts Theater als direkter Gegensatz zum klassischen, von Aristoteles geprägten Theater verstanden. „Im Gegensatz zur klassischen Form [dem aristotelischen Theater] wurde 1926 von Bertolt Brecht das epische Theater entwickelt.“ In Zusammenfassungen dieser Art schwingt auch immer die Ansicht eines spontanen kreationistischen Aktes mit, Brecht hätte sich in einem radikalen Gesinnungswandel vom traditionellen Theater losgelöst und eine eigene Form geschaffen, um die gesamtgesellschaftlichen Tendenzen und Veränderungen auszudrücken, aber zugleich auch auf sie einzuwirken. Aus diesem Grund sind Brechts Reflexionen über seine Theaterarbeit und Kunst allgemein immer durch den soziologischen Aspekt bestimmt, denn er schafft Kunst gezielt für das Publikum, um es auf eine bestimmte Weise konkret politisch und kritisch zu bewegen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die klassische Form: Aristotelisches Theater
- 3. Die Erneuerung: Episches Theater
- 3.1 Überblick der Entwicklungsphasen des epischen Theaters
- 3.2 Verfremdungseffekt
- 4. Exemplarische Analyse: Der gute Mensch von Sezuan
- 4.1 Inhalt und politischer Kontext
- 4.2 Verfremdungseffekte im Stück
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen aristotelischem und epischem Theater, insbesondere im Hinblick auf Bertolt Brechts Werk. Sie hinterfragt die gängige Darstellung beider Theaterformen als strikten Gegensatz und beleuchtet mögliche Gemeinsamkeiten. Die Analyse von Brechts "Der gute Mensch von Sezuan" dient als exemplarischer Fall, um die theoretischen Überlegungen zu veranschaulichen.
- Vergleich des aristotelischen und epischen Theaters
- Brechts Beitrag zur Entwicklung des epischen Theaters
- Analyse von Verfremdungseffekten in Brechts Stücken
- Der Einfluss des politischen Kontextes auf Brechts Theater
- Die Rezeption des epischen Theaters
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des aristotelischen und epischen Theaters ein und stellt die Forschungsfrage nach dem tatsächlichen Gegensatz und möglichen Gemeinsamkeiten beider Formen in den Mittelpunkt. Sie betont Brechts Rolle in der Entwicklung des epischen Theaters und kündigt den methodischen Ansatz an: eine eingehende Betrachtung des aristotelischen Theaters, gefolgt von einer Definition des epischen Theaters und einem exemplarischen Vergleich anhand von Brechts "Der gute Mensch von Sezuan".
2. Die klassische Form: Aristotelisches Theater: Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen des aristotelischen Theaters, basierend auf Aristoteles' Poetik. Es werden die sechs Elemente des Dramas (Mythos, Charakter, Sprache, Erkenntnisfähigkeit, Inszenierung und Melodik) erläutert und deren Bedeutung für die Struktur und Wirkung des klassischen Dramas hervorgehoben. Besonderes Augenmerk liegt auf den drei Einheiten der Handlung, des Ortes und der Zeit, sowie auf der Bedeutung der Mimesis und der Katharsis als Zielsetzung des Dramas. Das Kapitel betont die emotionale Wirkung des aristotelischen Theaters auf den Zuschauer.
Schlüsselwörter
Aristotelisches Theater, Episches Theater, Bertolt Brecht, Verfremdungseffekt, "Der gute Mensch von Sezuan", Dramentheorie, Mimesis, Katharsis, Politisches Theater.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Aristotelisches und Episches Theater
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über das aristotelische und das epische Theater, mit besonderem Fokus auf Bertolt Brechts Werk und dessen Beitrag zur Entwicklung des epischen Theaters. Er vergleicht beide Theaterformen, hinterfragt deren Darstellung als strikter Gegensatz und beleuchtet mögliche Gemeinsamkeiten. Die Analyse von Brechts "Der gute Mensch von Sezuan" dient als Fallbeispiel.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage. Kapitel 2 beschreibt das aristotelische Theater anhand von Aristoteles' Poetik, inklusive der sechs Elemente des Dramas und der Bedeutung von Mimesis und Katharsis. Kapitel 3 behandelt das epische Theater, inklusive seiner Entwicklungsphasen und des Verfremdungseffekts. Kapitel 4 analysiert Brechts "Der gute Mensch von Sezuan" im Hinblick auf Inhalt, politischen Kontext und Verfremdungseffekte. Kapitel 5 bietet ein Fazit.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, das Verhältnis zwischen aristotelischem und epischem Theater zu untersuchen, Brechts Rolle in der Entwicklung des epischen Theaters zu beleuchten und die theoretischen Überlegungen anhand einer exemplarischen Analyse von "Der gute Mensch von Sezuan" zu veranschaulichen. Er hinterfragt die gängige Gegenüberstellung beider Theaterformen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind der Vergleich des aristotelischen und epischen Theaters, Brechts Beitrag zum epischen Theater, die Analyse von Verfremdungseffekten in Brechts Stücken, der Einfluss des politischen Kontextes auf Brechts Theater und die Rezeption des epischen Theaters.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Schlüsselwörter sind: Aristotelisches Theater, Episches Theater, Bertolt Brecht, Verfremdungseffekt, "Der gute Mensch von Sezuan", Dramentheorie, Mimesis, Katharsis, Politisches Theater.
Wie wird das epische Theater im Text beschrieben?
Der Text beschreibt das epische Theater als eine Erneuerung des klassischen Theaters, die sich von den Prinzipien des aristotelischen Theaters absetzt. Ein zentraler Aspekt ist der Verfremdungseffekt, der den Zuschauer zur kritischen Distanzierung und Reflexion anregen soll.
Welche Rolle spielt Bertolt Brecht im Text?
Brecht spielt eine zentrale Rolle als Hauptvertreter des epischen Theaters. Sein Stück "Der gute Mensch von Sezuan" dient als exemplarische Fallstudie zur Veranschaulichung der theoretischen Überlegungen und des Vergleichs zwischen aristotelischem und epischem Theater.
Was ist der Verfremdungseffekt?
Der Verfremdungseffekt, ein zentrales Konzept des epischen Theaters, zielt darauf ab, die Gewohnheit und die Selbstverständlichkeit des Dargestellten zu durchbrechen und den Zuschauer zu einer kritischen Distanzierung und Reflexion anzuregen. Er soll verhindern, dass das Publikum sich emotional mit den Figuren identifiziert und stattdessen die dargestellte Situation analytisch betrachtet.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Aristotelisches und episches Theater. Das Verhältnis beider Theaterformen in Brechts "Der gute Mensch von Sezuan", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1290036