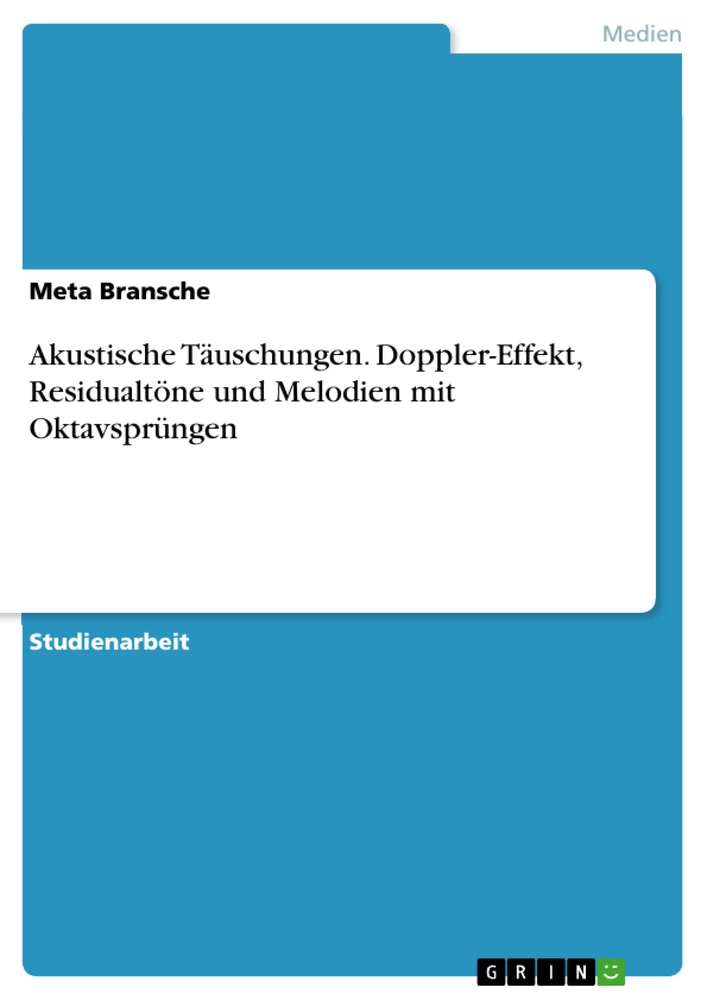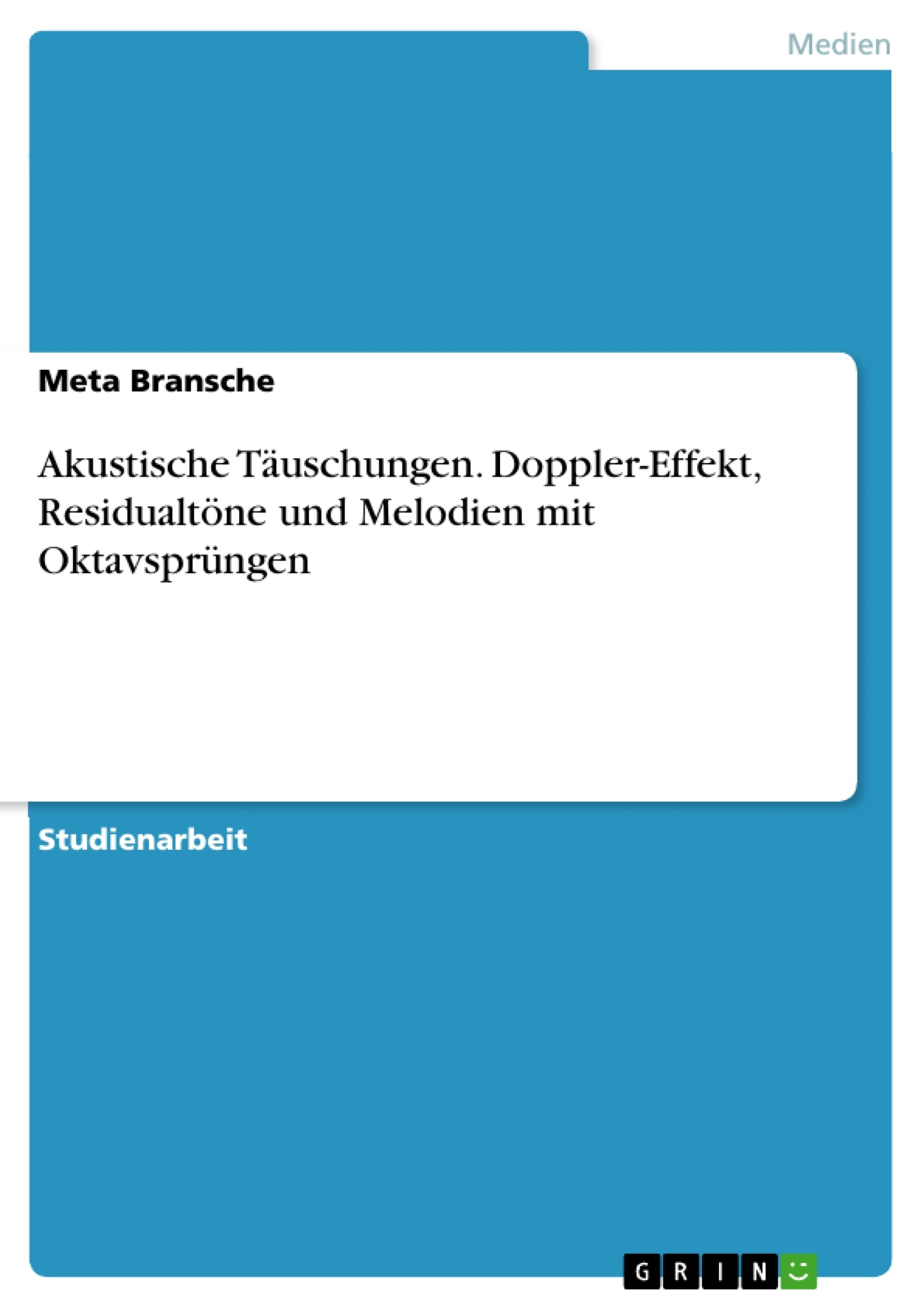Mit akustischen Täuschungen können unterschiedliche Phänomene beschrieben werden, die zum einen durch die Physiologie des menschlichen Ohres, zum anderen durch die Sinnesverarbeitung im menschlichen Gehirn selbst, oder aber auch durch die Interaktion und Manipulation verschiedener Frequenzen entstehen.
Philosophisch betrachtet, könnte man meinen, dass Klang an sich eine akustische Täuschung sei, die abhängig von der Lokalität ist. Im moleküllosen Vakuum des Weltalls, ein milliardenfach größerer Raum im Vergleich zur Erde, existiert kein für Menschen wahrnehmbarer Klang, da die Ausbreitung des Schalls von einem Medium abhängig ist, dass in Wellen versetzt werden kann. Lediglich mittels Technologien „übersetzte“ Schallwellen können aus dem Weltall für Menschen hörbar gemacht werden – hier handelt es sich meist um Radiowellen oder elektromagnetische Wellen, die für ein Klangerlebnis der großen leeren Weite in ein hörbares Frequenzspektrum konvertiert werden. Die Ausbreitung des Schalls ist an die Gegebenheiten einer Atmosphäre gebunden. Würde ein Mensch, geboren und aufgewachsen auf einer interstellaren Raumfahrtsmission, möglicherweise sagen, dass die Klänge auf der Erde allesamt akustische Täuschungen seien? Vermutlich.
Inhaltsverzeichnis
- Akustische Täuschungen
- Melodie mit Oktavsprüngen
- Residualtöne
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit dem Phänomen der akustischen Täuschungen. Es wird beleuchtet, wie diese durch die menschliche Physiologie, die Sinnesverarbeitung im Gehirn und die Interaktion verschiedener Frequenzen entstehen. Der Text analysiert verschiedene Aspekte von Klang und Musik und zeigt auf, wie unsere Wahrnehmung von Klang von kulturellen Gewohnheiten und Definitionen beeinflusst wird.
- Klangwahrnehmung und Physiologie des Ohres
- Die Rolle der Sinnesverarbeitung im Gehirn
- Die Interaktion und Manipulation von Frequenzen
- Kulturelle Einflüsse auf die Klangwahrnehmung
- Psychoakustische Phänomene wie Oktavsprünge und Residualtöne
Zusammenfassung der Kapitel
Akustische Täuschungen
Der Text beginnt mit einer philosophischen Betrachtung von Klang als akustische Täuschung. Er verweist auf die Abhängigkeit von der Lokalität und dem Medium der Schallwellenausbreitung. Der Text analysiert die Unterschiede zwischen der pythagoräischen Musiktheorie und der wohltemperierten Stimmung und zeigt die Folgen dieser Unterschiede für die Entwicklung der Musik.
Melodie mit Oktavsprüngen
Dieses Kapitel beschreibt ein Experiment der Psychologin Diana Deutsch, das die Wahrnehmung von Melodien in Oktavsprüngen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Teilnehmer die Melodie in Oktavsprüngen nur schwer erkannten, wenn sie diese zuerst vernahmen. Die Melodie wurde jedoch sofort erkannt, sobald sie in einer einzigen Oktave präsentiert wurde.
Residualtöne
Der Text erklärt das psychoakustische Phänomen des Residualtons, bei dem ein virtueller Grundton wahrgenommen wird, obwohl er nicht tatsächlich ertönt. Er erläutert, wie das Gehirn aus dem Frequenzspektrum von Obertönen den Grundton schlussfolgern kann. Der Text vergleicht dieses Phänomen mit dem Hinzufügen fehlender Linien bei Buchstaben und zeigt, dass es auch auf Akkordklänge übertragen werden könnte.
Schlüsselwörter
Akustische Täuschungen, Psychoakustik, Oktavsprünge, Residualtöne, Obertonreihe, Klangwahrnehmung, Musiktheorie, Wohltemperierte Stimmung, Pytharagoräische Intervalle, Cent-Zahlen, Intervalle, Kultur, Sinnesverarbeitung, Gehirn.
- Arbeit zitieren
- Meta Bransche (Autor:in), 2022, Akustische Täuschungen. Doppler-Effekt, Residualtöne und Melodien mit Oktavsprüngen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1288725