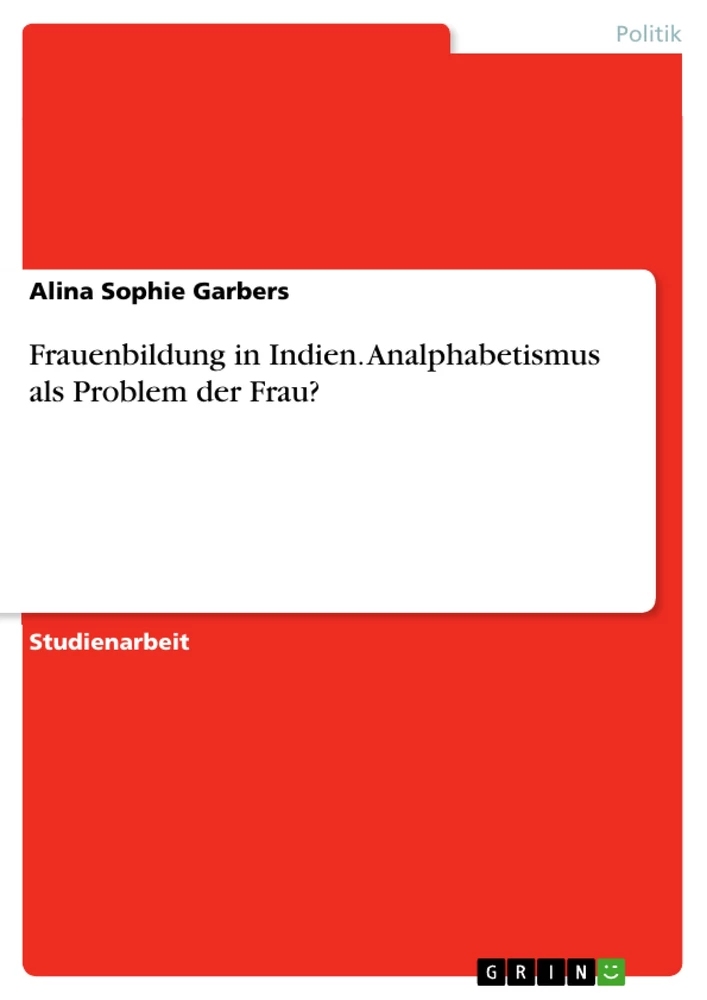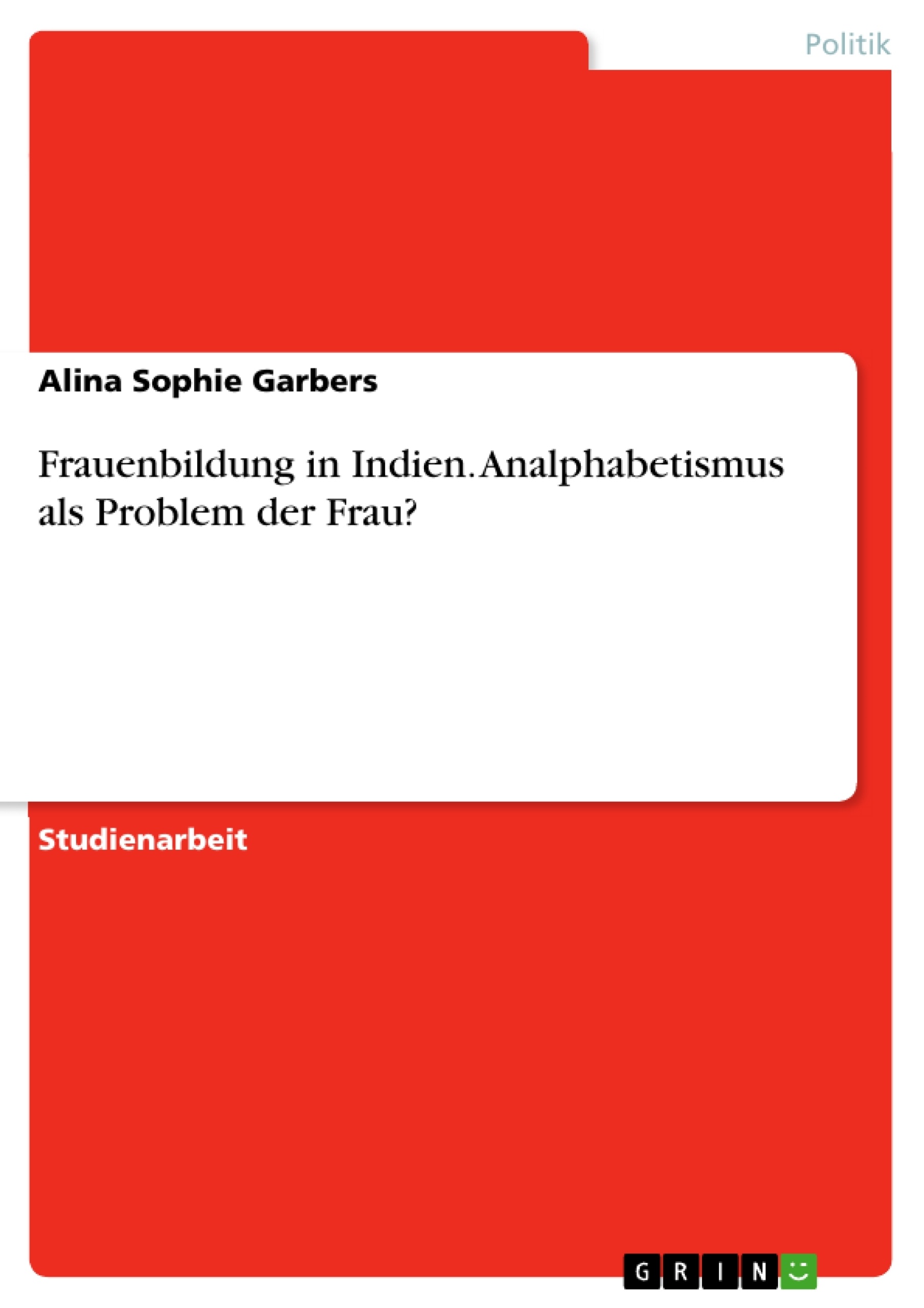Diese Arbeit untersucht die Frage, warum Frauen stärker von Analphabetismus betroffen sind. Zentrale Fragestellung der Arbeit ist deshalb, wie sich der prozentual höhere Anteil der Analphabetinnen in Indien erklären lässt.
Es gibt "keine kulturelle, ethnische, sprachliche, soziale oder politische Gruppe, die eine politisch relevante Mehrheit bildet". Die Ursachen liegen in der Zerstreuung innerhalb des Landes: Die indische Bevölkerung unterteilt sich in "zahllose Kasten, Religionsgemeinschaften, linguistische und ethnische Gruppen". In Zahlen gesprochen zeigt sich das am Erfolg der hindunationalistischen Partei, Bharatiya Janata Party (BJP), von Premierminister Narendra Modi bei den Parlamentswahlen in Indien 2019. Obwohl diese eine absolute Mehrheit von Sitzen im Parlament erzielte, betrug ihr Stimmenanteil nur 37 Prozent. Letztlich führt die sozio-kulturelle Zersplitterung zur Stabilität des politischen Systems, da es so zu keiner Mobilisierung einer gesellschaftlichen Mehrheitsgruppe kommt.
Auch im Bereich "Alphabetisierung" besteht, in diesem Fall, ein Geschlechtergefälle. Berücksichtigt man Frauen und Männer, betrug die Alphabetisierungsrate im Jahr 2018 ca. 74,4 Prozent und lag damit – über sechzig Jahre nach der Unabhängigkeit – weiterhin unter dem globalen Durchschnitt von ca. 87 Prozent. Besonders betroffen davon sind die indischen Mädchen und Frauen. Nur 65,79 Prozent der mindestens 15-jährigen Inderinnen konnten im Jahr 2018 lesen und schreiben. Die Männer, im Gegensatz dazu, zu 82,37 Prozent.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Bildung in Indien
- 2.1 Das Menschenrecht auf Bildung
- 2.2 Frauen und Bildung
- 2.3 Ergebnisse
- 3 Frauen und Familie
- 3.1 Historische Hintergründe
- 3.2 Das Ideal der indischen Frau
- 3.3 Ergebnisse
- 4 Folgen des Analphabetismus
- 4.1 Armut und Gewalt
- 4.2 Politische Beteiligung
- 4.3 Ergebnisse
- 5 Lösungsvorschläge
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Ursachen und Folgen des Analphabetismus in Indien mit besonderem Fokus auf die Situation von Frauen. Sie will verstehen, warum der Anteil der Analphabetinnen in Indien deutlich höher ist als der der Männer. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf hinduistische Frauen, da diese die Mehrheit der indischen Bevölkerung ausmachen.
- Das Menschenrecht auf Bildung in Indien
- Die Rolle der Familie und Tradition im indischen Bildungssystem
- Die Folgen des Analphabetismus für Frauen in Indien
- Mögliche Lösungsansätze zur Verbesserung der Bildungschancen für Frauen in Indien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die aktuelle Situation in Indien dar, die durch wirtschaftliches Wachstum und gleichzeitig bestehende soziale Ungleichheiten geprägt ist. Der Fokus wird auf den hohen Anteil an Analphabetinnen gelegt und die Forschungsfrage formuliert, die sich mit den Ursachen für den höheren Anteil an Analphabetinnen im Vergleich zu Männern befasst.
Kapitel 2 beleuchtet die Bildungssituation in Indien und diskutiert die de jure und de facto Umsetzung des Menschenrechts auf Bildung. Es werden die Herausforderungen und Erfolge des indischen Bildungssystems im Hinblick auf die Gleichstellung von Frauen betrachtet.
Kapitel 3 untersucht den Einfluss der Familie und Tradition auf die Bildungschancen von Frauen in Indien. Es werden historische Hintergründe beleuchtet und das Ideal der indischen Frau in den Fokus gerückt.
Kapitel 4 analysiert die Folgen des Analphabetismus für Frauen in Indien. Es werden die Auswirkungen auf Armut, Gewalt und politische Teilhabe beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Frauenbildung, Analphabetismus, Indien, Familienstrukturen, Traditionen, Menschenrechte, Armut, Gewalt, politische Teilhabe und Lösungsansätze. Die Arbeit basiert auf wissenschaftlicher Literatur und aktuellen Daten zur Situation von Frauen in Indien.
- Quote paper
- Alina Sophie Garbers (Author), 2022, Frauenbildung in Indien. Analphabetismus als Problem der Frau?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1288293