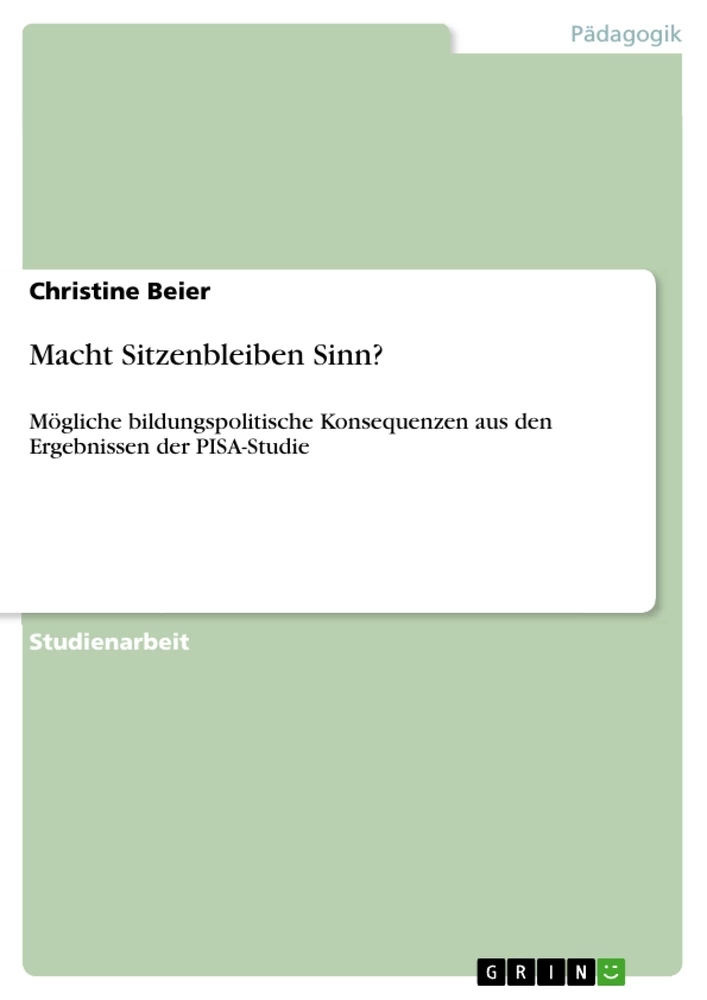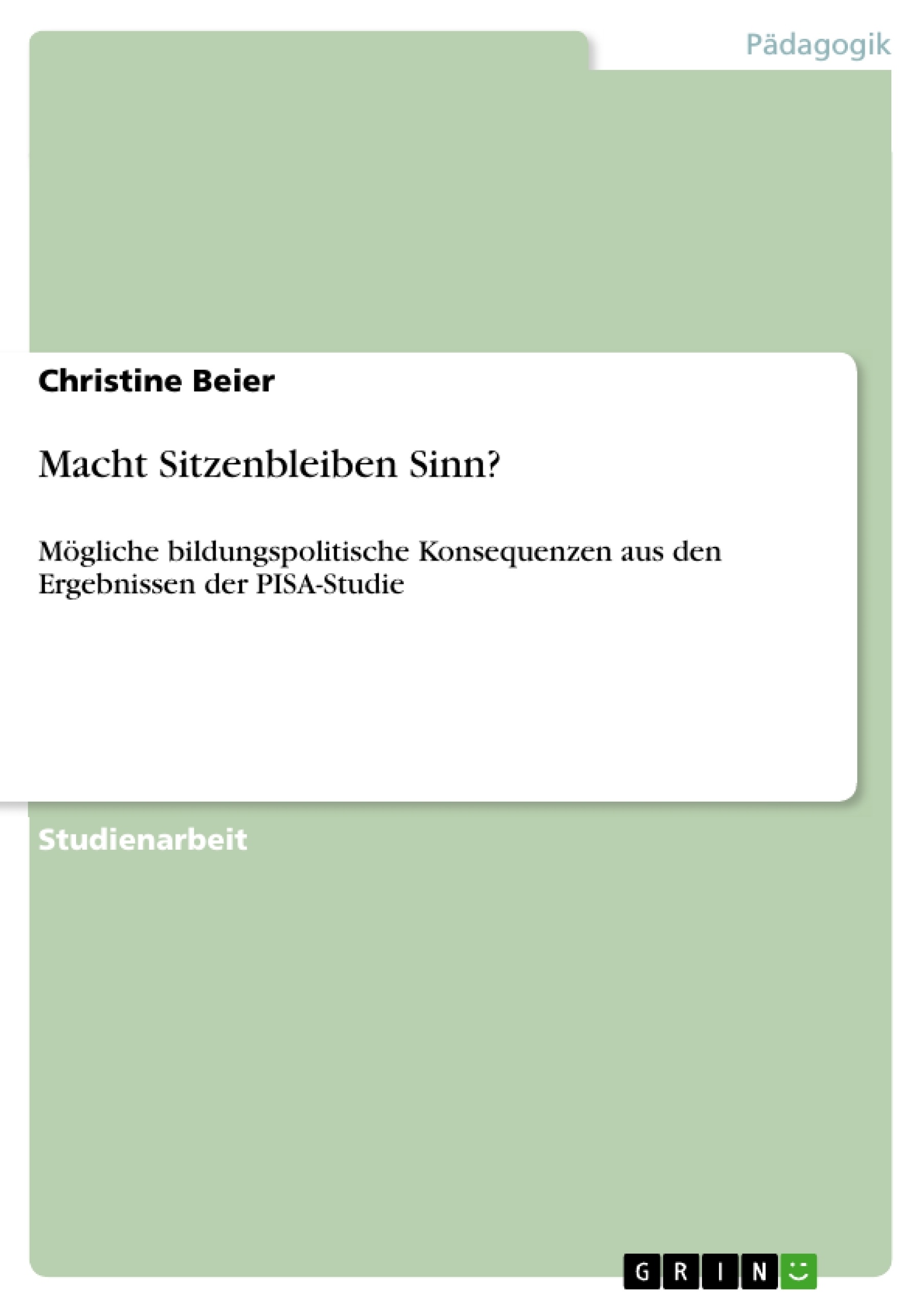Das „Sitzenbleiben“ ist im deutschen Schulsystem seit mehreren hundert Jahren fest verankert. Die Kritik am Sitzenbleiben ist nach Bekanntwerden der Ergebnisse der PISA-Studie neu entfacht; nachdem die deutschen Schüler bei dieser internationalen Vergleichsstudie so schlecht abschnitten, plädierte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) dafür, eher in vorbeugende Förderung zu investieren, statt bundesweit jährlich etwa 250.000 Schüler eine Jahrgangsstufe wiederholen zu lassen.
An die Maßnahme der Wiederholung einer Klassenstufe wird die Erwartung geknüpft, dass dies zu einer Steigerung der Homogenität innerhalb einer Lerngruppe führe und somit zu einem insgesamt besseren Lernerfolg. Für denjenigen, der eine Klasse wiederholt, soll das Sitzenbleiben dazu dienen, dass er in der neuen, weniger anspruchsvollen Lerngruppe wieder Fuß fasst und sich seine Leistung verbessert. In den letzten Jahren ist dieser Zusammenhang jedoch mehrfach in Frage gestellt worden, was sich nicht zuletzt in jüngsten Forderungen der GEW ausdrückt, das Sitzenbleiben doch ganz abzuschaffen.
In der vorliegenden Arbeit soll zunächst das Sitzenbleiben als Instrument in das deutsche gegliederte Schulsystem eingeordnet werden. Es soll erläutert werden, welche Erwartungen an die Klassenwiederholung geknüpft werden und welche Funktion das Sitzenbleiben erfüllen soll. Im Anschluss daran wird aufgezeigt, welche geschichtliche Bedeutung die Klassenwiederholung hat und aus welchem Kontext heraus sie vor etwa zweihundert Jahren entstanden ist.
Daran schließt sich im zweiten Kapitel eine Diskussion der Frage an, als wie sinnvoll das Sitzenbleiben in der heutigen Zeit angesehen werden kann und welche Probleme damit verbunden sind.
Im dritten Kapitel sollen Möglichkeiten diskutiert werden, was Deutschland tun könnte um aus dem Bildungsmittelmaß heraus wieder weiter an die internationale Spitze zu kommen. Anhand des PISA-Siegers Finnland soll gezeigt werden, wie eine ausgeprägte Förderkultur eventuell als Alternative zu einer starken Selektionskultur gesehen werden kann, um die Leistungsfähigkeit der Schüler zu steigern.
Daran schließt sich eine Darstellung des derzeitigen Meinungsbildes an, das derzeit in Deutschland zum Thema Sitzenbleiben zu finden ist. Dabei werden sowohl Meinungen des Volkes als auch die Stimmung innerhalb der Politik aufgegriffen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Klassenwiederholung. Definition und Historisches
- Einordnung des Sitzenbleibens in die Grundstruktur des deutschen Schulsystems
- Geschichte des Sitzenbleibens
- Mit der Klassenwiederholung auftretende Probleme
- Homogene Lerngruppen = leistungsstarke Lerngruppen?
- Psychologische Aspekte des Sitzenbleibens
- Gesellschaftliche Auswirkungen des Sitzenbleibens
- Mögliche Konsequenzen
- Was kann Deutschland vom PISA-Sieger Finnland lernen?
- Stimmungslage in Deutschland zum Thema Abschaffen des Sitzenbleibens
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zulassungsarbeit befasst sich mit der Thematik des Sitzenbleibens im deutschen Schulsystem und analysiert die möglichen bildungspolitischen Konsequenzen aus den Ergebnissen der PISA-Studie. Die Arbeit untersucht die historische Entwicklung des Sitzenbleibens, die damit verbundenen Probleme und die gesellschaftlichen Auswirkungen. Darüber hinaus werden alternative pädagogische Ansätze, wie sie in Finnland praktiziert werden, vorgestellt und im Kontext der deutschen Bildungslandschaft diskutiert.
- Die historische Entwicklung des Sitzenbleibens im deutschen Schulsystem
- Die Problematik des Sitzenbleibens im Hinblick auf Homogenität, psychologische Auswirkungen und gesellschaftliche Folgen
- Die Ergebnisse der PISA-Studie und deren Bedeutung für die Diskussion um das Sitzenbleiben
- Alternative pädagogische Ansätze, insbesondere die Förderkultur in Finnland
- Die aktuelle Debatte um das Sitzenbleiben in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Sitzenbleiben ein und stellt die Relevanz der Thematik im Kontext der PISA-Studie heraus. Sie beleuchtet die Kritik am Sitzenbleiben und die Erwartungen, die an die Klassenwiederholung geknüpft werden.
Das erste Kapitel definiert das Sitzenbleiben und ordnet es in die Grundstruktur des deutschen Schulsystems ein. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Sitzenbleibens und die Gründe für seine Einführung als pädagogische Maßnahme.
Das zweite Kapitel diskutiert die Problematik des Sitzenbleibens in der heutigen Zeit. Es werden sowohl psychologische als auch gesellschaftliche Aspekte beleuchtet, die mit der Klassenwiederholung verbunden sind.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Sitzenbleiben, die PISA-Studie, die deutsche Bildungslandschaft, die Förderkultur, die Selektionskultur, die Homogenität von Lerngruppen, die psychologischen Auswirkungen des Sitzenbleibens und die gesellschaftlichen Folgen der Klassenwiederholung. Die Arbeit beleuchtet die aktuelle Debatte um das Sitzenbleiben in Deutschland und diskutiert alternative pädagogische Ansätze, die sich an der Förderkultur in Finnland orientieren.
- Citation du texte
- Christine Beier (Auteur), 2006, Macht Sitzenbleiben Sinn?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128801