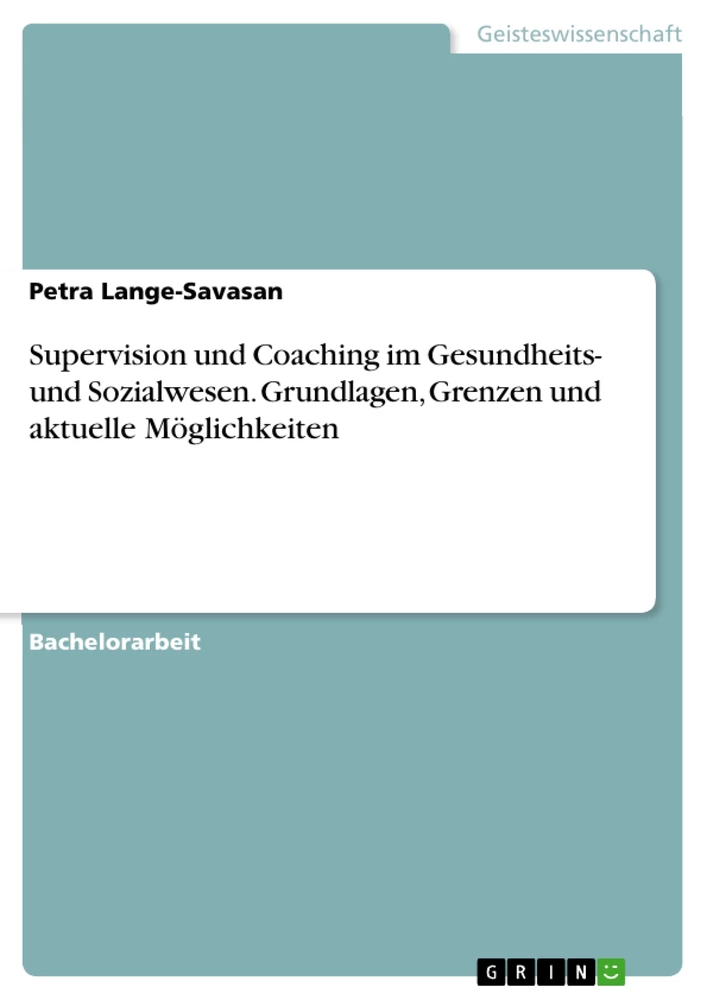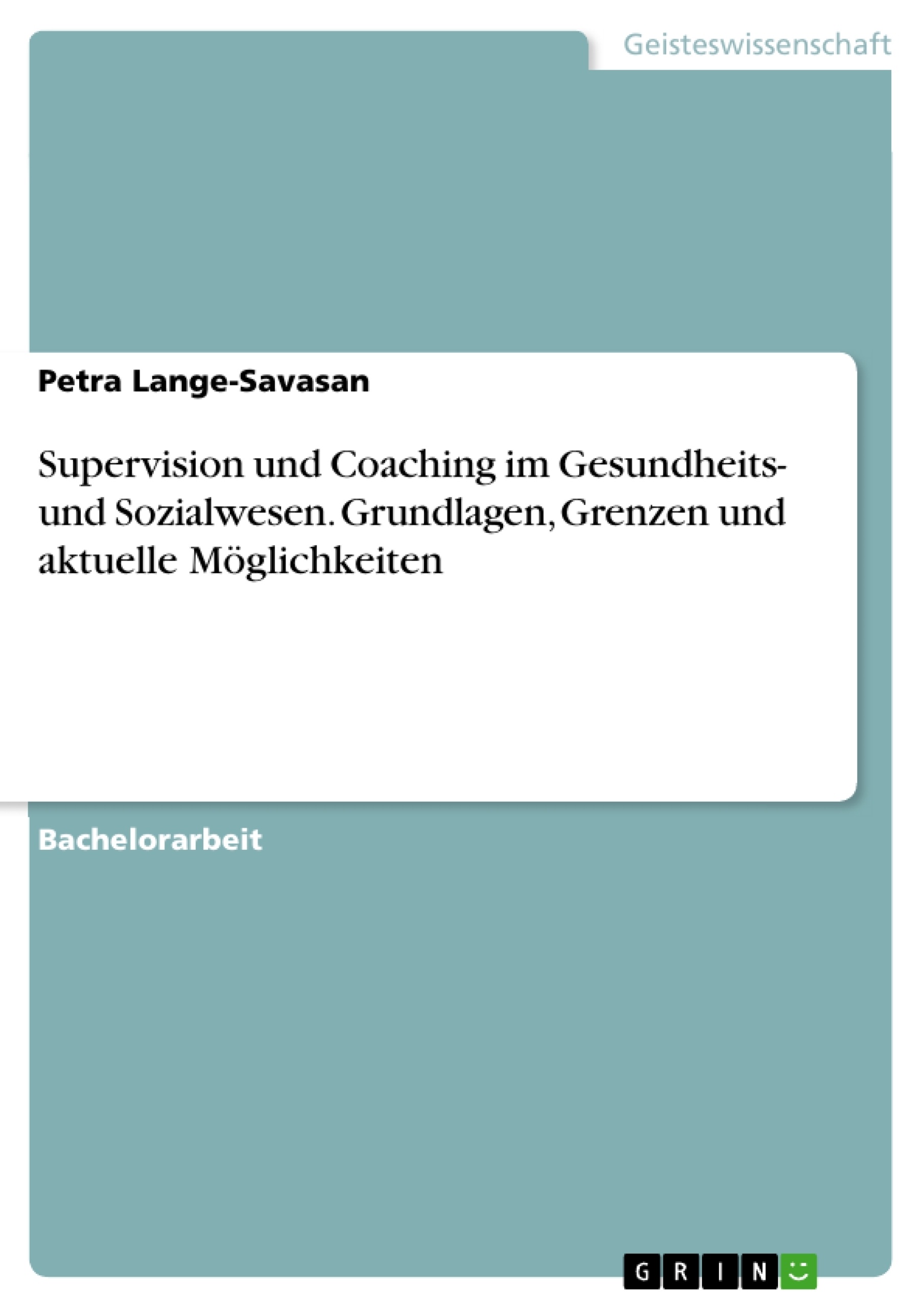Diese Arbeit bietet einen grundlegenden Blick auf Supervision und Coaching. Dieser Blick richtet sich dabei auf die Entstehungsgeschichte und das zu Grunde liegende Gedankengut der Beratungsformate. Durch diese ausführliche Darstellung wird es möglich, die Anwendungsgebiete, die Settings, das individuelle Vorgehen, die Grenzen, aber auch die Möglichkeiten, die Chancen und den Gewinn von Supervision und Coaching, die hier beschrieben werden, nachzuvollziehen. So entsteht die Gelegenheit, die eigenen Grundlagen, die Vorgehensweisen und das individuelle Verständnis im Beratungsprozess zu reflektieren und zu optimieren.
Seit einigen Jahren gelten Supervision und Coaching als wesentliche Bestandteile in der Beratungslandschaft und sind fest im Gesundheits- und Sozialbereich implementiert. Der aktuelle Bedarf an Supervision und Coaching ist, insbesondere im Sozial- und Gesundheitswesen, sehr hoch. Diese Tatsache ist nicht nur allein an der Covid-19-Pandemie festzumachen. Belardi beschreibt in diesem Zusammenhang u.a. die Folgen der neuen Arbeitswelt (New Work), sowie den demografischen Wandel als Verursachung eines erhöhten Bedarfes.
Richtet man den Scheinwerfer auf diese Beratungslandschaft, taucht auf der einen Seite ein Pool von Supervisorinnen und Coaches auf. Diese Supervisorinnen und Coaches verfügen über die unterschiedlichsten, mehr oder weniger fundierten Vorerfahrungen, Studienabschüsse oder zertifizierten Aus- und Weiterbildungen. Auf der anderen Seite stehen Supervisandinnen, die i.d.R. nur vage Vorstellungen, bzgl. der Organisation, der Systematik, der möglichen Themen und des Beratungsprozesses als solchen haben.
Die Auftraggeberinnen, häufig Führungskräfte und Personalverantwortliche der Unternehmen, wirken in dieser Interessenmixtur als dritte Instanz, da sie die Beraterinnen beauftragen und häufig exakte Zielerwartungen an die Supervisorinnen und die Supervisandinnen weitergeben. Dieses Verhältnis der Arbeitskonstellation wird als Dreieckskontrakt definiert. Arbeiten die Coaches in einem abhängigen Dienstleistungsverhältnis, sind sie mit ihrer Planung, Durchführung und mit ihrem möglichen Erfolgsdruck ihrer Interventionen nicht nur ihren Klientinnen und dem Unternehmen, sondern noch einer vierten Instanz, ihrer vorgesetzten Dienststelle, verpflichtet (Viereckskontrakt).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziel dieser Arbeit
- Aufbau dieser Arbeit
- Vorgehen bei der Recherche und Materialauswahl
- Supervision
- Supervision - Definition
- Supervision - Entstehungsgeschichte
- Supervision - Ausbildung
- Supervision - unterschiedliche Formen
- Supervision - Grundlegendes Gedankengut
- Coaching
- Coaching Definition
- Coaching – Entstehungsgeschichte
- Coaching - Ausbildung
- Coaching unterschiedliche Formen
- Coaching-Grundlegendes Gedankengut
- Anlässe, Grenzen und aktuelle Möglichkeiten von Supervision und Coaching im Gesundheits- und Sozialwesen
- Anlässe für Supervision und Coaching im Gesundheits- und Sozialwesen
- Grenzen von Supervision und Coaching
- Möglichkeiten von Supervision und Coaching
- Zusammenfassung, Fazit und Ausblick
- Zusammenfassung
- Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema Supervision und Coaching im Gesundheits- und Sozialwesen. Sie analysiert die Grundlagen, Grenzen und aktuellen Möglichkeiten dieser beiden Formen der professionellen Unterstützung. Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis für Supervision und Coaching in diesem Kontext zu entwickeln und die Bedeutung dieser Methoden für die Verbesserung von Arbeitsbedingungen und -prozessen im Gesundheits- und Sozialwesen aufzuzeigen.
- Definition und Entstehung von Supervision und Coaching
- Unterschiedliche Formen und Modelle von Supervision und Coaching
- Grundlegendes Gedankengut und theoretische Ansätze
- Anlässe und Anwendungsbereiche von Supervision und Coaching im Gesundheits- und Sozialwesen
- Grenzen und Herausforderungen von Supervision und Coaching
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit erläutert sowie das Vorgehen bei der Recherche und Materialauswahl beschreibt. Die folgenden Kapitel befassen sich mit den Grundlagen von Supervision und Coaching. Es werden Definitionen, Entstehungsgeschichten, Ausbildungsmöglichkeiten, unterschiedliche Formen und grundlegendes Gedankengut beider Methoden vorgestellt. Kapitel 4 befasst sich mit den Anlässen, Grenzen und aktuellen Möglichkeiten von Supervision und Coaching im Gesundheits- und Sozialwesen. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung, einem Fazit und einem Ausblick, in dem die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und zukünftige Entwicklungen und Forschungsfelder aufgezeigt werden.
Schlüsselwörter
Supervision, Coaching, Gesundheits- und Sozialwesen, professionelle Unterstützung, Arbeitsbedingungen, Arbeitsqualität, psychologische und soziale Kompetenzen, Reflexion, Lösungsorientierung, Entwicklung, Motivation, Resilienz, Selbsterfahrung, Burnout-Prävention, Kommunikation, Teamarbeit, Qualitätsmanagement, ethische Aspekte, rechtliche Rahmenbedingungen.
- Quote paper
- Petra Lange-Savasan (Author), 2022, Supervision und Coaching im Gesundheits- und Sozialwesen. Grundlagen, Grenzen und aktuelle Möglichkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1288009