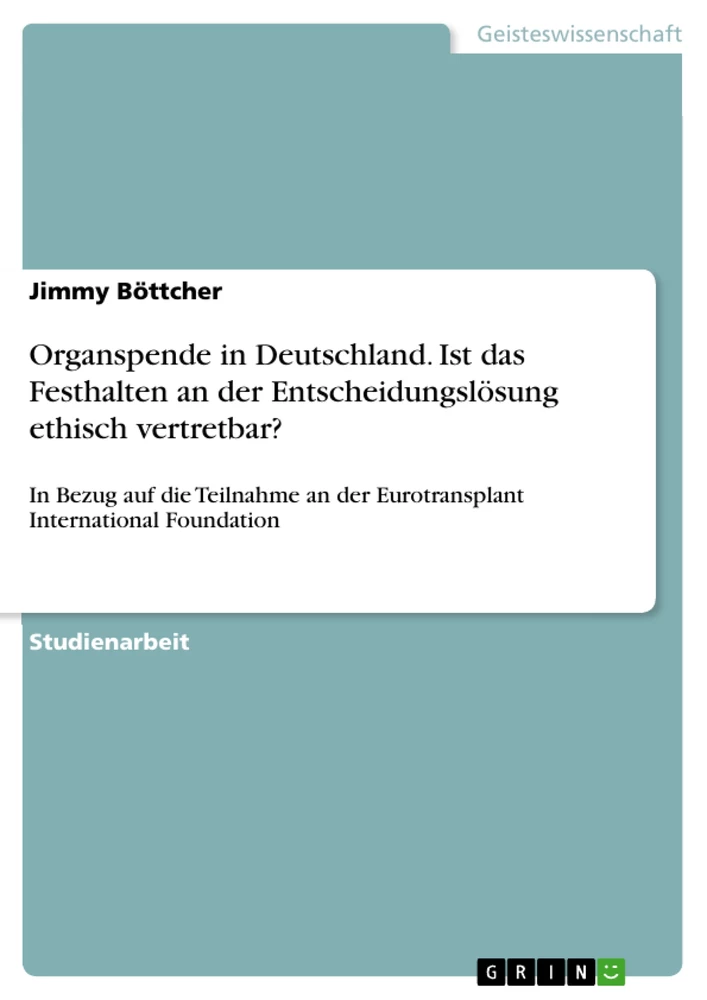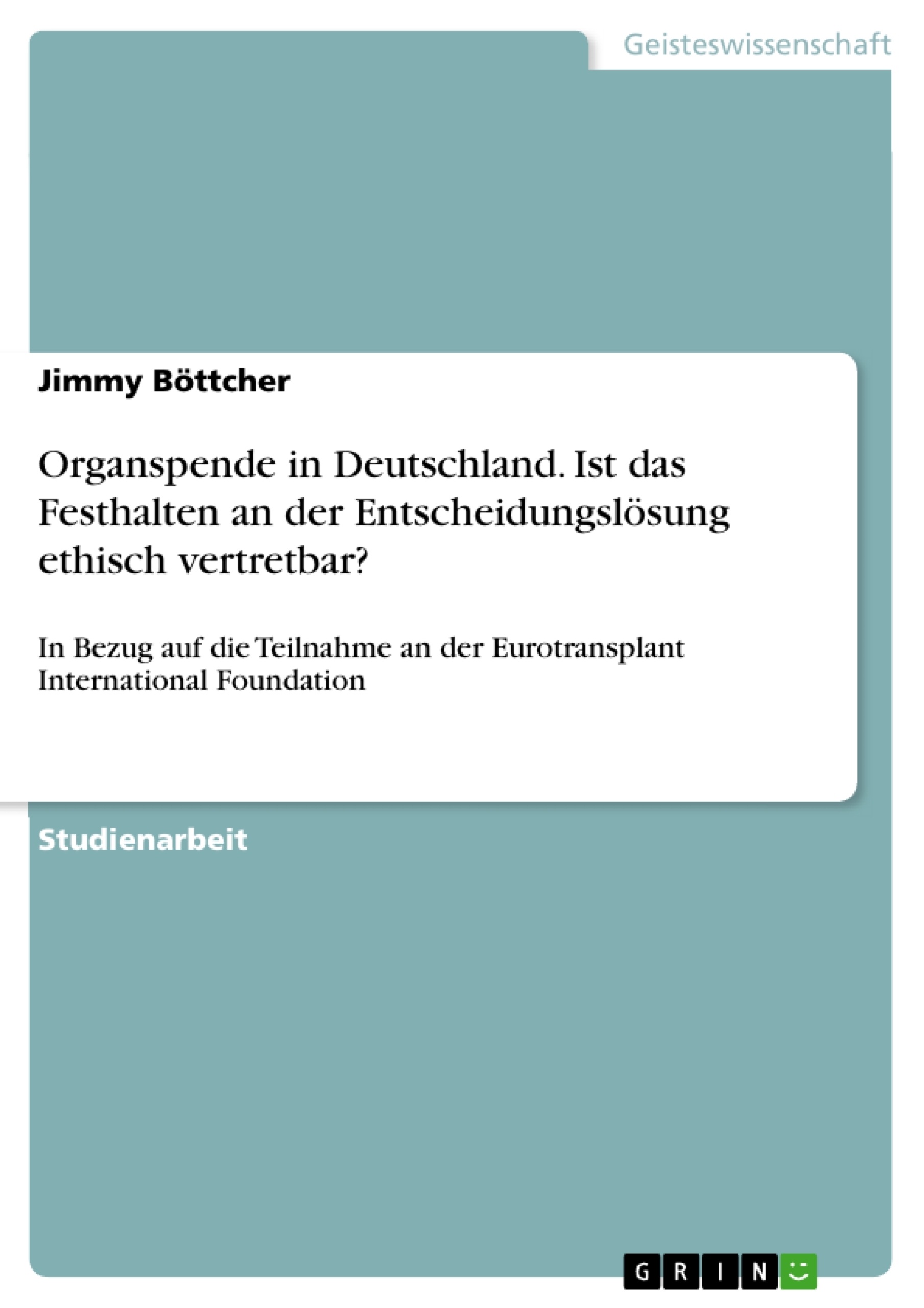Die Arbeit zeigt die Unterschiede in Bezug auf die Organspende zwischen Deutschland und den anderen Mitgliedsländern der Eurotransplant International Foundation auf. So wird verdeutlicht, wieso Deutschlands Organpolitik in der Kritik von Eurotransplant steht, und erläutert, was sich in Deutschland verändern muss, damit eine Kultur der Organspende entstehen kann. Im Mittelpunkt der Hausarbeit steht die Frage, ob Deutschlands Festhalten an der Entscheidungslösung unter Einbeziehung der Teilnahme an der Eurotransplant Foundation ethisch vertretbar ist.
Die Transplantationsmedizin ist eine junge Wissenschaft, die erste Transplantation fand in dem Jahr 1954 statt. Eine ziemlich lange Zeit ist seit der ersten Transplantation im Vergleich zu einem Menschenleben vergangen und dennoch ist es eine sehr kurze Zeitspanne, um als Menschheit ein Bewusstsein für die Thematik Organspende zu erlangen. Durch die Bundestagsdebatte aus dem Jahr 2020 gewann das Thema Organspende wieder an Dynamik und die ethische Diskussion darüber, wie der Staat die Organspende auslegen sollte, entfachte von Neuem.
Um die Organspende in Europa zu vereinfachen, gründete sich im Jahr 1967 die Stiftung Eurotransplant International Foundation, kurz: Eurotransplant. Die Aufgabe von Eurotransplant ist es, den Internationalen Austausch von Organspenden zu koordinieren. Eurotransplant besteht aus den acht europäischen Ländern: Belgien, Deutschland, Kroatien, Luxemburg, Österreich, Slowenien, Ungarn und den Niederlanden. Das Ziel ist es, durch die gemeinsame Vermittlung der Spenderorgane, diese so effektiv wie möglich einzusetzen, um den Patienten und Patientinnen somit eine bestmögliche Behandlung gewährleisten zu können.
Durch die gemeinsame Datenbank haben die circa 137 Millionen Menschen der acht Mitgliedsländer bessere Chancen ein passendes Spenderorgan zu erhalten. Durch die teilweise starken Abweichungen zwischen Organexport- und Import kommt es innerhalb der Foundation immer wieder zu Spannungen. Hauptverursacher der Spannungen in den letzten Jahren ist Deutschland, da sie einen schwachen Organexport vorzuweisen haben und dennoch vehement an der Entscheidungslösung festhalten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wie entscheidet Eurotransplant?
- 3. Deutschland und die weiteren Eurotransplant Mitgliedsländer
- 4. Eurotransplant macht Druck
- 5. Wie soll der Mangel an Organspenden behoben werden?
- 6. Die Widerspruchslösung und das Grundgesetz
- 7. Ungleichmäßige Verhältnisse
- 8. Fehlendes Verständnis
- 9. Deutschlands Souveränität
- 10. Die Widerspruchslösung führt nicht unbedingt zur weniger Selbstbestimmung.
- 11. Es gibt keine Garantie für mehr Organspenden
- 12. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Diskrepanz zwischen der deutschen Organ-Spendenpraxis und der anderer Eurotransplant-Mitgliedsländer. Sie analysiert die Gründe für die niedrige Spendenrate in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern und hinterfragt die ethische Vertretbarkeit des deutschen Vorgehens im Kontext der Eurotransplant-Mitgliedschaft. Die Arbeit beleuchtet kritische Punkte der deutschen „Organpolitik“ und deren Auswirkungen auf die internationale Zusammenarbeit.
- Der Vergleich der Organspende-Systeme in Deutschland und anderen Eurotransplant-Mitgliedsländern.
- Die Kritik von Eurotransplant an der deutschen Entscheidungslösung.
- Die ethische Debatte um die Entscheidungslösung im Vergleich zur Widerspruchslösung.
- Mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Organspendesituation in Deutschland.
- Die Rolle Deutschlands innerhalb der Eurotransplant Foundation.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Organspende ein und stellt die Eurotransplant International Foundation vor. Sie beschreibt die Aufgabe von Eurotransplant, den internationalen Austausch von Organspenden zu koordinieren und hebt die Spannungen hervor, die durch unterschiedliche Organexport- und Importzahlen zwischen den Mitgliedsländern entstehen, wobei Deutschland im Fokus steht aufgrund seines geringen Organexports und der Beibehaltung der Entscheidungslösung.
2. Wie entscheidet Eurotransplant?: Dieses Kapitel beschreibt das computerbasierte System von Eurotransplant zur Vermittlung von Spenderorganen. Es erklärt den Bewertungsprozess, der auf einem „Perfect Match“-Prinzip basiert, und hebt die Bedeutung von Faktoren wie Wartezeit, Dringlichkeit und Transportweg hervor. Das Kapitel warnt vor Datenmanipulation und erwähnt den Organspendeskandal von 2012 in Deutschland. Es betont, dass eine Registrierung bei Eurotransplant keine Garantie für eine Organspende darstellt.
3. Deutschland und die weiteren Eurotransplant Mitgliedsländer: Hier wird der Unterschied zwischen der deutschen Entscheidungslösung und der Widerspruchslösung in anderen Eurotransplant-Mitgliedsländern erläutert. Das Kapitel verdeutlicht, wie die Entscheidungslösung in Deutschland zu einer deutlich geringeren Spendenrate führt, da die Zustimmung des Verstorbenen oder der Angehörigen erforderlich ist, was oft zu Ablehnungen führt, selbst wenn eine Organspende im Sinne des Verstorbenen wäre.
4. Eurotransplant macht Druck: Dieses Kapitel verdeutlicht den erheblichen Unterschied in der Organspenderate zwischen Deutschland und anderen Eurotransplant-Mitgliedsländern, wie beispielsweise Kroatien. Es beschreibt den Druck, den Eurotransplant auf Deutschland ausübt, die Widerspruchslösung einzuführen, um die Organversorgung zu verbessern und einen fairen Ausgleich zwischen Organexport und -import zu schaffen. Die Unzufriedenheit von Eurotransplant mit den deutschen Reformen von 2020 wird hervorgehoben.
5. Wie soll der Mangel an Organspenden behoben werden?: Das Kapitel beschreibt die Gesetzesreformen von 2022 in Deutschland, die zwar die Widerspruchslösung ablehnten, aber dennoch Verbesserungen im Bereich der Organspende anstreben. Es wird die Einrichtung eines Online-Registers und eine Aufklärungskampagne erwähnt, um die Bereitschaft zur Organspende zu erhöhen.
Schlüsselwörter
Organspende, Eurotransplant, Entscheidungslösung, Widerspruchslösung, Deutschland, Organexport, Organimport, ethische Aspekte, Gesetzesreformen, Transplantationsmedizin.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der deutschen Organ-Spendenpraxis im Kontext der Eurotransplant-Mitgliedschaft
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Diskrepanz zwischen der deutschen Organ-Spendenpraxis und der anderer Eurotransplant-Mitgliedsländer. Sie untersucht die Gründe für die niedrige Spendenrate in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern und hinterfragt die ethische Vertretbarkeit des deutschen Vorgehens im Kontext der Eurotransplant-Mitgliedschaft. Ein Schwerpunkt liegt auf der Kritik von Eurotransplant an der deutschen Entscheidungslösung und den daraus resultierenden Spannungen in der internationalen Zusammenarbeit.
Welche Länder sind involviert?
Die Arbeit konzentriert sich auf Deutschland und die anderen Mitgliedsländer der Eurotransplant International Foundation. Vergleiche werden mit Ländern gezogen, die eine deutlich höhere Organspenderate aufweisen, wie beispielsweise Kroatien.
Was ist die Entscheidungslösung und wie unterscheidet sie sich von der Widerspruchslösung?
In Deutschland gilt die Entscheidungslösung: Eine Organspende ist nur möglich mit der Zustimmung des Verstorbenen (wenn diese zu Lebzeiten dokumentiert wurde) oder der Angehörigen. Im Gegensatz dazu erlaubt die Widerspruchslösung die Entnahme von Organen, es sei denn, der Verstorbene hat zu Lebzeiten explizit widersprochen. Die Widerspruchslösung führt in der Regel zu deutlich höheren Spendenraten.
Welche Kritik übt Eurotransplant an Deutschland?
Eurotransplant kritisiert die niedrige Organspenderate in Deutschland im Vergleich zu anderen Mitgliedsländern. Der geringe Organexport aus Deutschland führt zu Ungleichgewichten im System. Eurotransplant übt deshalb Druck auf Deutschland aus, die Widerspruchslösung einzuführen, um die Organversorgung zu verbessern und einen ausgewogeneren Austausch zu gewährleisten. Die Unzufriedenheit mit den deutschen Reformen von 2020 wird ebenfalls hervorgehoben.
Welche Gesetzesreformen gab es in Deutschland?
Die Arbeit erwähnt die Gesetzesreformen von 2022, die die Widerspruchslösung ablehnten, aber dennoch Verbesserungen im Bereich der Organspende anstrebten. Diese umfassen die Einrichtung eines Online-Registers und eine Aufklärungskampagne zur Steigerung der Bereitschaft zur Organspende.
Wie funktioniert das Organspende-System von Eurotransplant?
Eurotransplant verwendet ein computerbasiertes System zur Vermittlung von Spenderorganen. Der Bewertungsprozess basiert auf einem „Perfect Match“-Prinzip, wobei Faktoren wie Wartezeit, Dringlichkeit und Transportweg berücksichtigt werden. Die Arbeit warnt jedoch auch vor möglichen Datenmanipulationen und betont, dass eine Registrierung bei Eurotransplant keine Garantie für eine Organspende darstellt.
Welche ethischen Fragen werden angesprochen?
Die Arbeit beleuchtet die ethische Debatte um die Entscheidungslösung im Vergleich zur Widerspruchslösung. Sie untersucht die Frage der Selbstbestimmung des Einzelnen im Kontext der Organspende und die Auswirkungen der unterschiedlichen Systeme auf die internationale Zusammenarbeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Organspende, Eurotransplant, Entscheidungslösung, Widerspruchslösung, Deutschland, Organexport, Organimport, ethische Aspekte, Gesetzesreformen, Transplantationsmedizin.
Gibt es eine Garantie für mehr Organspenden durch die Widerspruchslösung?
Nein, die Arbeit betont, dass es keine Garantie für mehr Organspenden durch die Einführung der Widerspruchslösung gibt.
Wie wird der Mangel an Organspenden behoben werden?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Ansätze, darunter verbesserte Aufklärung, die Einrichtung von Online-Registern und die Überarbeitung von Gesetzen, jedoch ohne die Garantie auf eine signifikante Steigerung der Organspenden.
- Arbeit zitieren
- Jimmy Böttcher (Autor:in), 2022, Organspende in Deutschland. Ist das Festhalten an der Entscheidungslösung ethisch vertretbar?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1285388