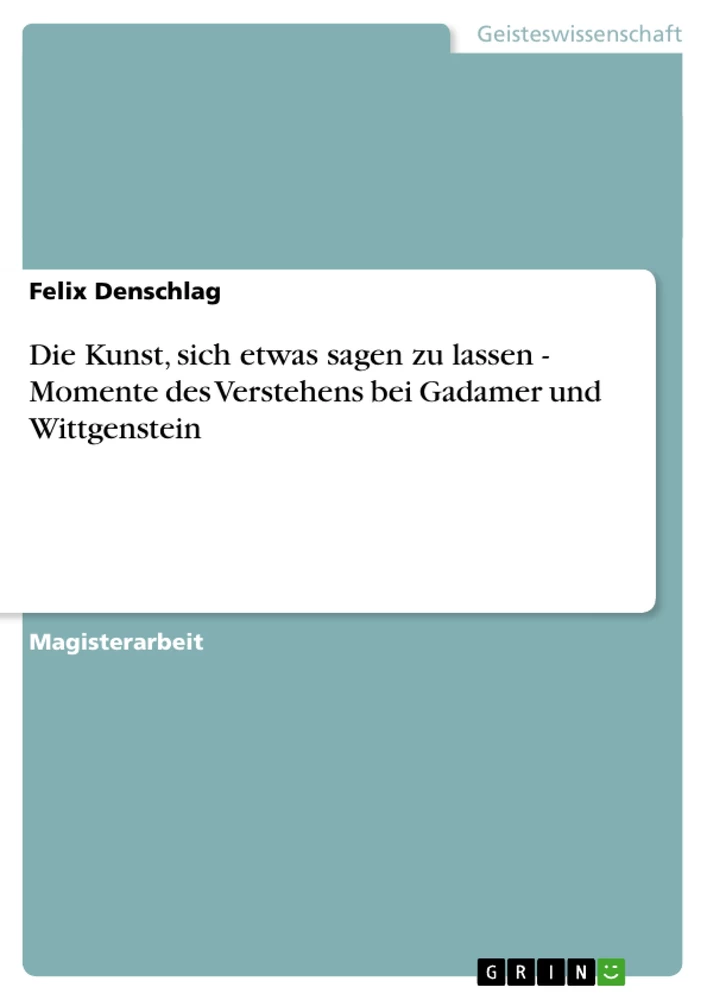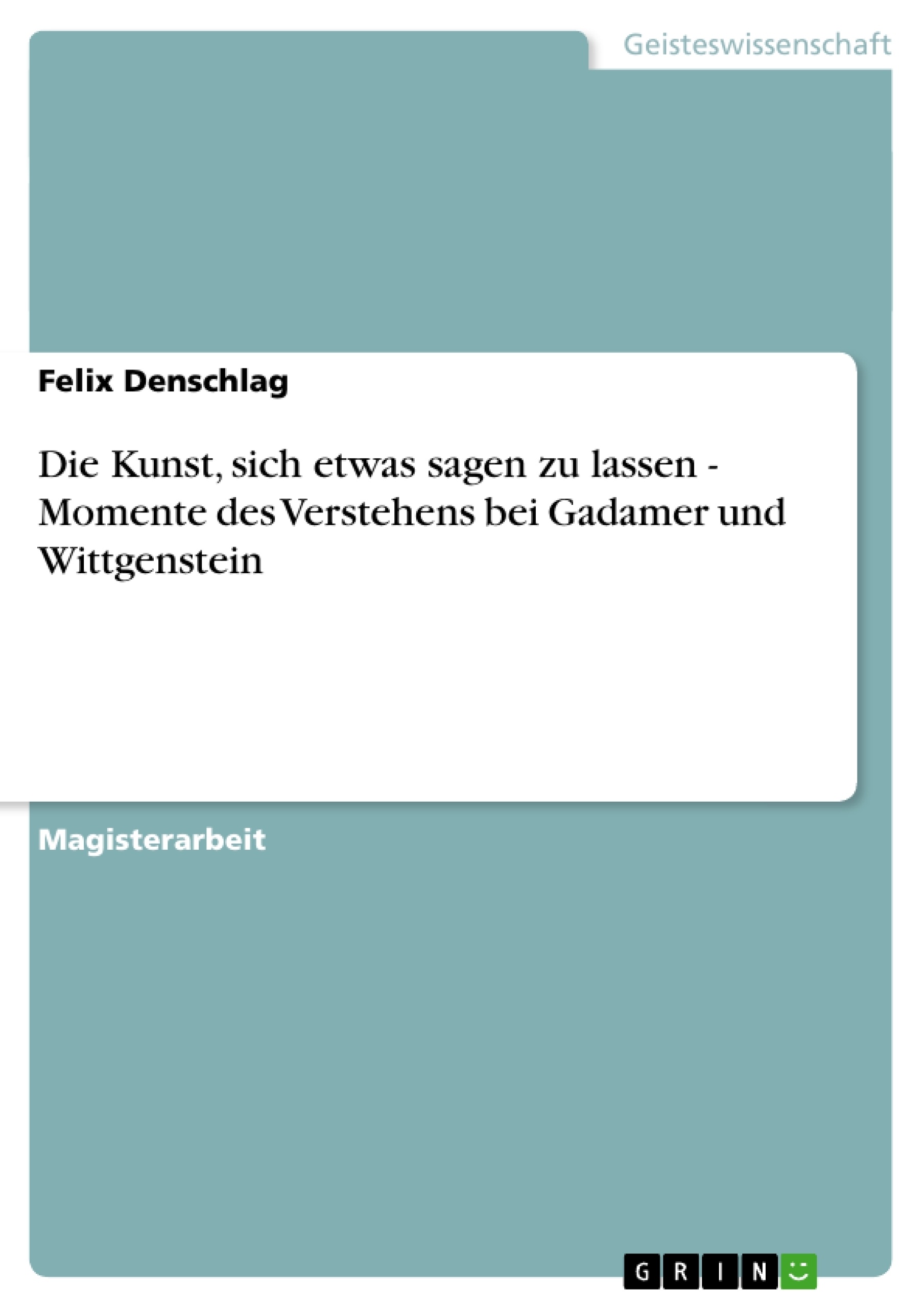Die vorliegende Magisterarbeit beschäftigt sich dem Begriff des Sprachverstehens. Es geht um die Frage, wie das Sprachverstehen, die Fähigkeit zur sprachlichen
Verständigung, zu charakterisieren ist. Mit der Bezugnahme auf Ludwig Wittgenstein und Hans-Georg Gadamer wird gleichzeitig der Versuch unternommen, eine Beziehung zwischen der für die sprachanalytische Philosophie zentralen Problematik des Verstehens sprachlicher Bedeutung und der Problematik des ‚hermeneutischen’ Verstehens herzustellen. Es werden also zwei Aspekte des Sprachverstehens thematisiert, die in der Philosophie des 20. Jahrhunderts eine deutlich hervorgehobene Rolle spielen.
In dieser Arbeit wird die Auffassung vertreten, dass Gadamer und Wittgenstein zwei Denker sind, die sich zwar beide mit dem Sprachverstehen befassen, jedoch mit unterschiedlichen Aspekten desselben – wodurch sich der Versuch eines direkten Vergleichs der Verstehenskonzepte erübrigt. Es ergibt sich jedoch die Möglichkeit der Differenzierung des Verstehensbegriffs und der Vermittlung der unterschiedlichen Ansätze in Form einer gegenseitigen Ergänzung. Diese Herangehensweise hat den Vorzug, dass Missverständnisse, die sich aus einer vorschnellen Parallelisierung ergeben, vermieden werden können.
Die Unterscheidung im Begriff des Sprachverstehens lässt sich treffen zwischen einem performativen Sprachverstehen eines Sprechers – der Beherrschung einer Sprache – und dem interpretativen Sprachverstehen eines Hörers. Das Vollzugswissen, das pragmatische Bedeutungsverstehen im Sinne Wittgensteins, wird in der Hermeneutik Gadamers nicht eigens thematisiert, sondern vielmehr vorausgesetzt. Gadamer konzentriert sich ganz auf die Interpretation, in der jedoch die sprachlichen Ausdrücke – Wörter und Sätze – in der Bedeutung verstanden werden müssen, die sie in der Sprache haben. Es ist also gefordert, die Hermeneutik Gadamers durch Ausführungen zum Bedeutungsverstehen zu ergänzen. Dazu sind die Arbeiten Wittgenstein bestens geeignet, da hier die elementare Sprachbeherrschung thematisch wird.
Zur Charakterisierung des Sprachverstehens werden zwei Bestimmungen hervorgehoben, die sich sowohl bei Wittgenstein als auch bei Gadamer finden lassen: die Bedingtheit des Verstehens und sein Praxischarakter. Dabei zeigt sich in der Thematisierung der Bedingungen des Verstehens eine deutliche Nähe zwischen beiden Denkern, in der Charakterisierung des Verstehens als praktische Fähigkeit hingegen ihre unterschiedliche Fragestellung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Wittgensteins Konzeption des Bedeutungsverstehens
- 1.1 Wittgensteins Anliegen und Vorgehen in den Philosophischen Untersuchungen
- 1.2 Bedeutung und Verstehen in den Philosophischen Untersuchungen
- 1.2.1 Die Kritik der, Gegenstandstheorie der Bedeutung' und der Rekurs auf den Gebrauch
- 1.2.2 Wittgensteins Konzeption sozialer Sprachspiele in Lebensformen
- 1.2.3 Das Auffinden von, Familienähnlichkeiten' statt der Suche nach dem, Wesen' des Verstehens
- 1.2.4 Die Regelhaftigkeit des Verstehens
- 1.2.5 Private Sprache – ein Widerspruch in sich
- 1.2.6 Der konkrete Verstehensvollzug
- 1.3 Bedingungen des Verstehens in Über Gewißheit
- 1.4 Zusammenfassung und Ausblick auf Gadamer
- 2. Gadamers Konzeption des Äußerungsverstehens
- 2.1 Grundzüge der Texthermeneutik Gadamers
- 2.1.1 Der Zirkel des Verstehens
- 2.1.2 Vorurteile als Bedingungen des Verstehens
- 2.1.3 Die Situiertheit des Verstehens und das wirkungsgeschichtliche Bewusstsein
- 2.1.4 Tradition und Autorität
- 2.1.5 Der Anwendungs- und Fragecharakter des Verstehens
- 2.2 „Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache."
- 2.2.1 Sprache als Medium des Verstehens
- 2.2.2 Sprache im Gespräch
- 2.2.3 Hermeneutik: die Kunst, sich etwas sagen zu lassen
- 2.3 Charakterisierung des Sprachverstehens
- 2.1 Grundzüge der Texthermeneutik Gadamers
- 3. Verhältnisbestimmung von Bedeutungsverstehen und, hermeneutischem' Verstehen
- 3.1 Die Bedingtheit des Sprachverstehens
- 3.1.1 Die, Übereinstimmung in den Urteilen'
- 3.1.2 Wittgenstein: ein ungeschichtlicher Denker?
- 3.2 Das praktische Moment des Sprachverstehens
- 3.2.1 Das, Beherrschen einer Technik'
- 3.2.2 Die, Kunst des Zuhörens'
- 3.2.3 Der Bezug auf das Innere
- 3.1 Die Bedingtheit des Sprachverstehens
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit befasst sich mit dem Sprachverstehen und untersucht, wie die Fähigkeit zur sprachlichen Verständigung charakterisiert werden kann. Sie analysiert die Konzepte von Ludwig Wittgenstein und Hans-Georg Gadamer, um eine Verbindung zwischen der sprachanalytischen Problematik des Verstehens sprachlicher Bedeutung und der hermeneutischen Problematik des Verstehens herzustellen. Die Arbeit beleuchtet zwei wichtige Aspekte des Sprachverstehens, die im 20. Jahrhundert eine zentrale Rolle in der Philosophie spielen.
- Die Bedeutung des Sprachverstehens in der Philosophie
- Die Konzepte von Wittgenstein und Gadamer zum Sprachverstehen
- Die Verbindung zwischen sprachanalytischer und hermeneutischer Perspektive
- Die Unterscheidung zwischen performativem und interpretativem Sprachverstehen
- Die Rolle der Sprache als Medium des Verstehens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Sprachverstehens ein und stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor. Sie erläutert die Relevanz der Konzepte von Wittgenstein und Gadamer für das Verständnis von Sprachverstehen und die Verbindung zwischen sprachanalytischer und hermeneutischer Perspektive.
Kapitel 1 analysiert Wittgensteins Konzeption des Bedeutungsverstehens. Es werden seine Kritik an der, Gegenstandstheorie der Bedeutung' und sein Rekurs auf den Gebrauch von Sprache in unterschiedlichen Situationen beleuchtet. Die Konzeption sozialer Sprachspiele in Lebensformen, das Auffinden von, Familienähnlichkeiten' und die Regelhaftigkeit des Verstehens werden ebenfalls untersucht.
Kapitel 2 widmet sich Gadamers Konzeption des Äußerungsverstehens. Es werden die Grundzüge der Texthermeneutik Gadamers, insbesondere der Zirkel des Verstehens, die Rolle von Vorurteilen, die Situiertheit des Verstehens und das wirkungsgeschichtliche Bewusstsein, sowie die Bedeutung von Tradition und Autorität behandelt.
Kapitel 3 setzt sich mit der Verhältnisbestimmung von Bedeutungsverstehen und, hermeneutischem' Verstehen auseinander. Es werden die Bedingtheit des Sprachverstehens, die, Übereinstimmung in den Urteilen', die Frage nach der Geschichtlichkeit des Verstehens bei Wittgenstein und das praktische Moment des Sprachverstehens, insbesondere das, Beherrschen einer Technik', die, Kunst des Zuhörens' und der Bezug auf das Innere, analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Sprachverstehen, die sprachliche Verständigung, die sprachanalytische Philosophie, die Hermeneutik, Ludwig Wittgenstein, Hans-Georg Gadamer, Bedeutungsverstehen, Äußerungsverstehen, performatives Sprachverstehen, interpretatives Sprachverstehen, Sprachspiele, Lebensformen, Familienähnlichkeiten, Regelhaftigkeit, Vorurteile, Tradition, Autorität, Geschichtlichkeit, Praxis, Sprache als Medium des Verstehens.
- Quote paper
- Felix Denschlag (Author), 2007, Die Kunst, sich etwas sagen zu lassen - Momente des Verstehens bei Gadamer und Wittgenstein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128507