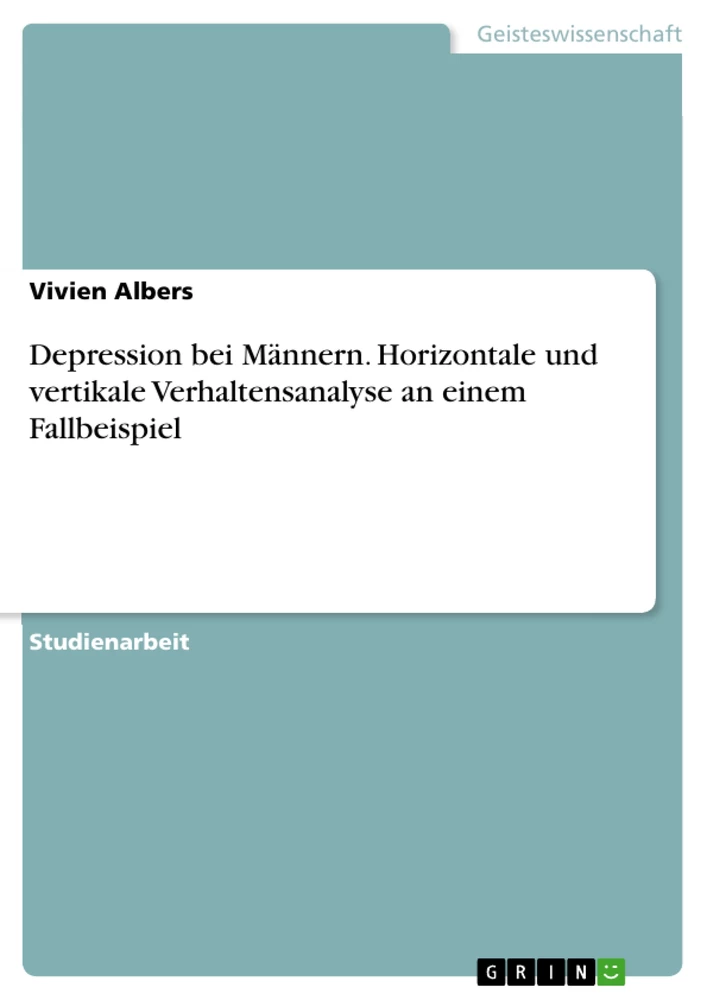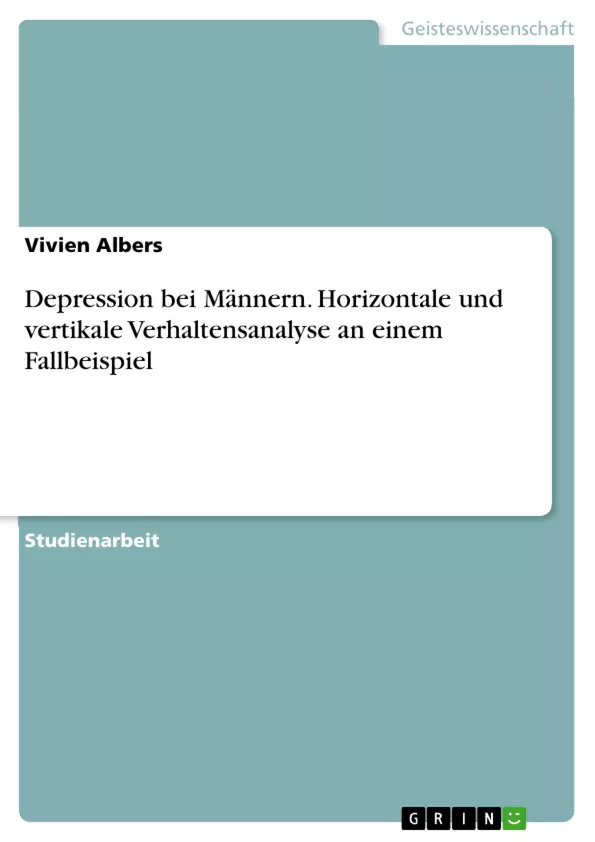Im Theorieteil der folgenden Arbeit wird der Begriff depressive Störung zunächst näher erläutert. Mithilfe von Grafiken werden verschiedene Daten wie Prävalenzzahlen, Arbeitsunfähigkeitstage und Todesfälle aufgrund von depressiven Störungen veranschaulicht. Es werden Geschlechterunterschiede zwischen Frauen und Männern unter die Lupe genommen und verschiedene Ätiologiemodelle der depressiven Störung dargeboten. Im nächsten Schritt wird anhand eines Fallbeispiels eine horizontale und vertikale Verhaltensanalyse unternommen. Herr O. ist ein 43-jähriger sportlicher, gut-gekleideter und pflichtbewusster Mann mit einem gesicherten Einkommen. Allerdings leidet er seit über 20 Jahren immer wieder unter verschiedenen depressiven Symptomen. Wie es dazu kommen konnte, lässt sich aus seiner biografischen Lerngeschichte entnehmen. Herr O. wird dafür auf Mikro- und Makroebene analysiert. Daraus wird anschließend eine Therapieplanung abgeleitet. Im letzten Teil dieser Arbeit werden die Ergebnisse der Arbeit kritisch reflektiert und Empfehlungen zur Prävention depressiver Störungen diskutiert. Zum Abschluss erfolgt ein kurzer Ausblick, wie die Ergebnisse weiterverwendet werden können.
Depressionen gehören aufgrund Ihrer Häufigkeit und schwerwiegenden Folgen zu den bedeutsamsten psychischen Erkrankungen. Dabei ist auffällig, dass Frauen fast doppelt so häufig mit einer Depression diagnostiziert werden wie Männer. Gleichzeitig ist die Suizidrate bei Männern dreimal höher als bei Frauen. Fast jeder 50. Todesfall eines Mannes ist eine Selbsttötung. Häufige Gründe dafür sind Leistungsdruck, ständige Erreichbarkeit und soziale Krisen. Die Unterschiede in der Häufigkeit depressiver Störungen bei Frauen und Männern beruhen auf einer Vielzahl komplexer biologischer, psychosozialer, soziokultureller und sozioökonomischer Faktoren. Dabei stellt sich auch die Frage, ob es diese Unterschiede tatsächlich gibt oder ob Prävalenzzahlen der Depression aufgrund verschiedener Ursachen bei Frauen künstlich höher sind. Depressionen werden häufig unterschätzt. Ob Frau oder Mann, fast 20% der Deutschen erkranken mindestens ein Mal in ihrem Leben an einer depressiven Störung. Wichtig ist daher nicht nur eine angemessene Behandlung, sondern auch die Prävention.
Inhaltsverzeichnis
- Hintergrund
- Fallbeispiel: Der Fall des Herrn O.
- Biographie
- Kindheit und Jugend
- Beruflicher Werdegang
- Soziale Kontakte und Freizeitaktivitäten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text präsentiert das Fallbeispiel eines 43-jährigen Mannes (Herr O.), der unter wiederholten depressiven Episoden leidet. Er beleuchtet die Symptome, die Entstehungsgeschichte der Depression und deren Einfluss auf das Leben des Betroffenen.
- Symptome der Depression
- Biographie und Lebensgeschichte als Einflussfaktoren
- Soziale Beziehungen und deren Einfluss auf die Depression
- Der Umgang mit dem eigenen Perfektionismus und hohen Ansprüchen
- Die Herausforderungen im Beruf und der Umgang mit Arbeitsbelastung
Zusammenfassung der Kapitel
Hintergrund
Der Abschnitt "Hintergrund" definiert zunächst die Depression als psychische Erkrankung und beleuchtet ihre Symptome und Häufigkeit. Anschließend wird die Fallgeschichte von Herrn O. vorgestellt. Der Leser erhält Einblick in die Symptome, die Herr O. erlebt, und erfährt über seinen bisherigen Umgang mit der Depression, inklusive seiner persönlichen Erfahrungen mit Therapie und Medikamenten.
Biographie
Dieser Abschnitt präsentiert die Biographie von Herrn O. und beschreibt seine Kindheit, seine Eltern und die prägenden Familienwerte. Er beleuchtet die Entwicklung seiner beruflichen Karriere und die Auswirkungen des Berufs auf seine psychische Gesundheit. Darüber hinaus werden seine sozialen Kontakte und Freizeitaktivitäten vorgestellt, die ebenfalls einen wichtigen Einfluss auf seine Lebenssituation haben.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind Depression, Biographie, Familienstrukturen, Perfektionismus, Arbeitsbelastung, soziale Kontakte und Freizeitaktivitäten. Der Text beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen diesen Faktoren und zeigt, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und die Entstehung und den Verlauf einer Depression prägen können.
Häufig gestellte Fragen
Warum werden Depressionen bei Männern oft anders wahrgenommen?
Männer zeigen oft andere Symptome (wie Aggression oder Rückzug in die Arbeit) und nehmen seltener Hilfe in Anspruch, obwohl ihre Suizidrate deutlich höher ist als bei Frauen.
Was ist eine horizontale und vertikale Verhaltensanalyse?
Die horizontale Analyse betrachtet konkrete Situationen und Reaktionen, während die vertikale Analyse die biografische Lerngeschichte und tieferliegende Werte (z. B. Perfektionismus) untersucht.
Welche Rolle spielt Leistungsdruck bei männlichen Depressionen?
Ständige Erreichbarkeit, beruflicher Stress und hohe Ansprüche an sich selbst sind häufige Auslöser für depressive Episoden bei Männern.
Was ist das Ziel der Therapieplanung im Fallbeispiel Herr O.?
Ziel ist es, die biografisch erlernten Muster zu erkennen, den extremen Perfektionismus abzubauen und gesündere Bewältigungsstrategien für Stress zu entwickeln.
Wie hoch ist die Prävalenz von Depressionen in Deutschland?
Etwa 20 % der Deutschen erkranken mindestens einmal in ihrem Leben an einer depressiven Störung.
- Citar trabajo
- Vivien Albers (Autor), 2022, Depression bei Männern. Horizontale und vertikale Verhaltensanalyse an einem Fallbeispiel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1282659