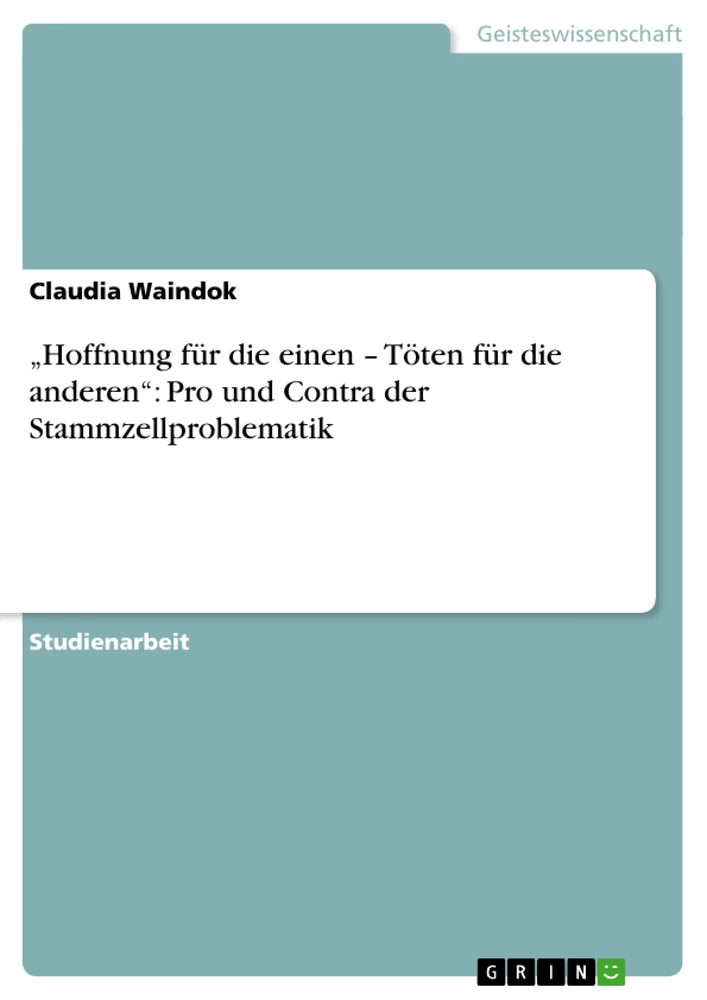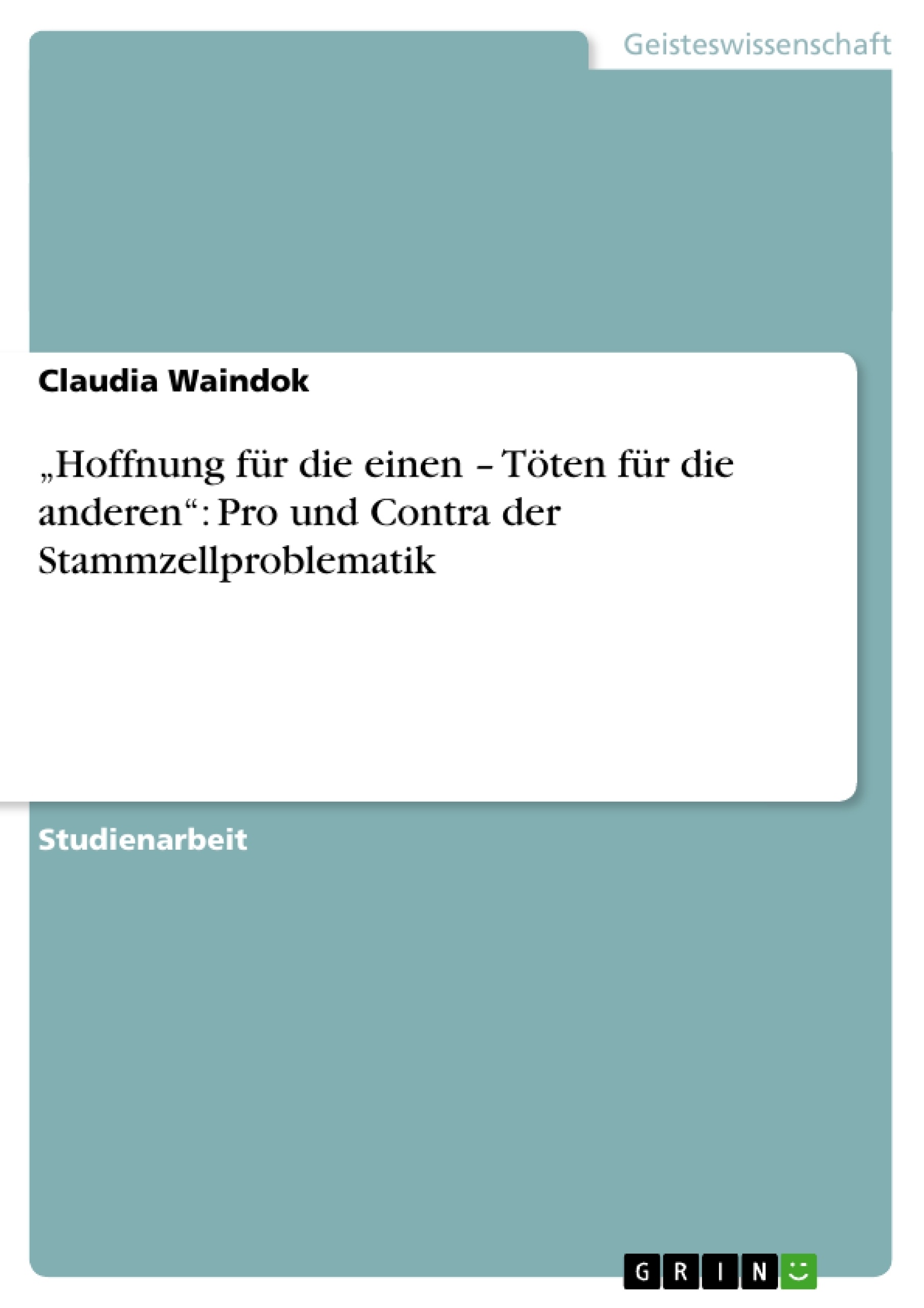Ab wann beginnt menschliches Leben?
Eine Frage, die nicht nur in Bezug zu der immer wieder diskutierten Abtreibungsproblematik steht, sondern die auch Kernpunkt der Diskussion um die Forschung an und mit Stammzellen ist.
Vor dem Hintergrund, ob menschliches Leben bereits außerhalb des Mutterleibes beginnen kann, brach Ende des letzten Jahrtausends die erste große Auseinandersetzung über die Stammzellendebatte in der Öffentlichkeit aus.
„Hoffnung für die einen – Töten für die anderen“ schrieb die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) am 12.07.2001 kurz vor der Novellierung des Embryonenschutzgesetzes und trifft damit die Hauptschlagader der von der Bundesministerin für Bildung und Forschung Dr. Annette Schavan 2008 als „ethisches Dilemma“ bezeichneten Problematik.
Während für die Befürworter der Stammzellenforschung medizinische Fortschritte und die Heilung chronischer Krankheiten das schlagkräftigste Argument darstellt, bezeichnen ihre Gegner sie als „Eingriff in die Schöpfung“, was gleichzeitig eine Beteiligung der Kirche an dieser Diskussion impliziert.
Nach einer Aufzeichnung der juristischen und medizinischen Seite der Stammzellenforschung soll in dieser Arbeit daher die kirchliche Position zu diesem Thema erläutert werden.
In einer abschließenden Diskussion werden die verschiedenen Positionen reflektiert und gegeneinander abgewogen und beurteilt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Stammzellen - Differenzierung und Forschungsstand
- Die juristische Seite - das Stammzellgesetz
- Die kirchliche Seite
- Das christliche Menschenbild
- Kirchliche Haltung zur Stammzellenforschung
- Pro und Contra der Stammzellenforschung
- Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der ethischen Dimension der Stammzellenforschung aus kirchlicher Perspektive. Sie analysiert die Positionen der Kirche im Kontext der medizinischen und juristischen Aspekte der Stammzellforschung und beleuchtet die Debatte um die ethische Zulässigkeit der Forschung an und mit embryonalen Stammzellen.
- Das christliche Menschenbild und seine Bedeutung für die Bewertung der Stammzellenforschung
- Die ethische Position der Kirche zur Stammzellenforschung
- Die Argumente für und gegen die Stammzellenforschung
- Die Rolle des Staates und der Gesellschaft in der Debatte um die Stammzellenforschung
- Die Bedeutung der Stammzellenforschung für die medizinische Forschung und die Entwicklung neuer Therapien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Stammzellenforschung ein und stellt die Relevanz der ethischen Debatte um die Forschung an und mit embryonalen Stammzellen heraus. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf die Frage, ab wann menschliches Leben beginnt, und die damit verbundenen ethischen und rechtlichen Herausforderungen.
Das zweite Kapitel erläutert die verschiedenen Arten von Stammzellen und deren Differenzierungspotenzial. Es beleuchtet die medizinischen Möglichkeiten, die sich durch die Stammzellenforschung eröffnen, und die damit verbundenen ethischen Fragen.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der Stammzellenforschung in Deutschland. Es analysiert das Embryonenschutzgesetz und seine Auswirkungen auf die Forschung an und mit embryonalen Stammzellen.
Das vierte Kapitel widmet sich der kirchlichen Position zur Stammzellenforschung. Es analysiert das christliche Menschenbild und seine Bedeutung für die Bewertung der Stammzellenforschung. Es beleuchtet die Haltung der Kirche zur Forschung an und mit embryonalen Stammzellen und diskutiert die ethischen Argumente, die für und gegen die Stammzellenforschung sprechen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Stammzellenforschung, das christliche Menschenbild, die ethische Debatte, die juristischen Rahmenbedingungen, die Position der Kirche, die medizinischen Möglichkeiten und die ethischen Herausforderungen der Stammzellenforschung.
- Quote paper
- Claudia Waindok (Author), 2008, „Hoffnung für die einen – Töten für die anderen“: Pro und Contra der Stammzellproblematik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128245