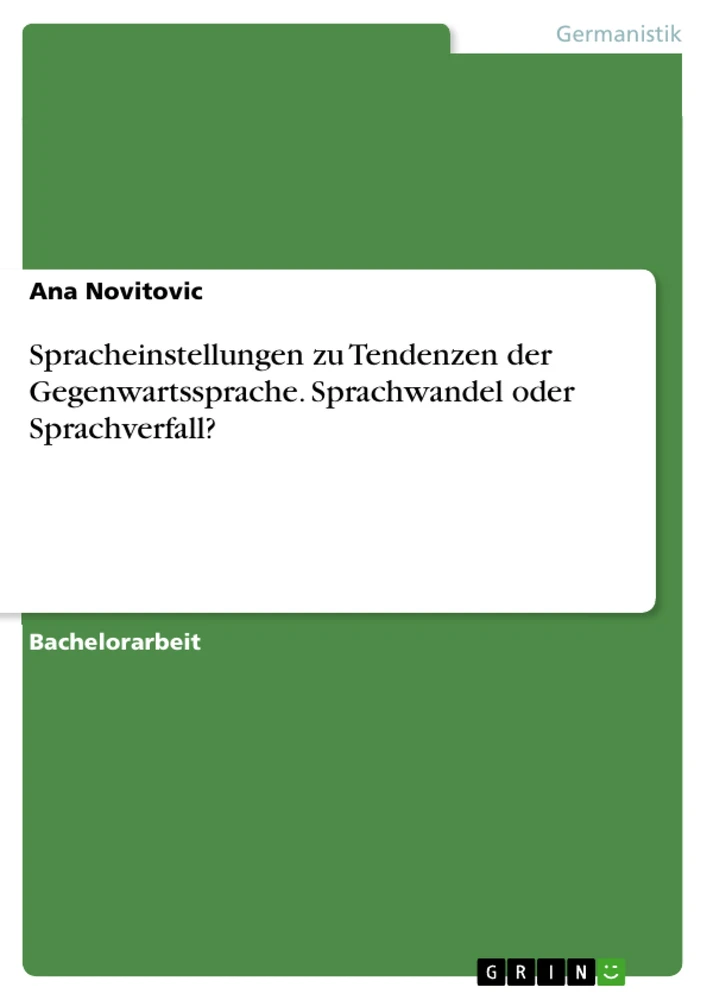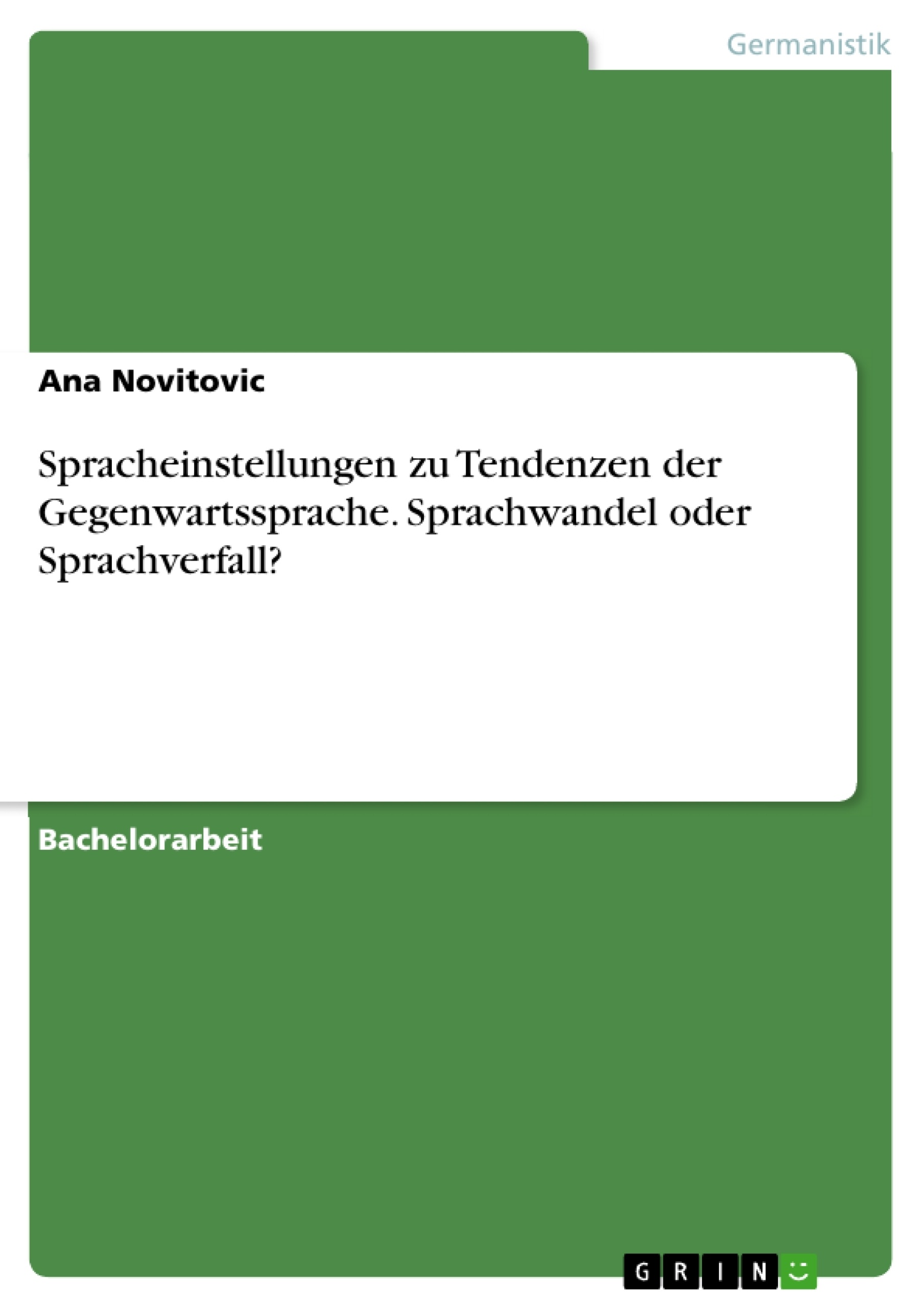In der Öffentlichkeit ist der Sprachwandel die meistdiskutierte Auseinandersetzung mit Sprache. Schließlich bemerken Sprecher einer Sprachgemeinschaft, dass sich die Sprache und ihr eigener Sprachgebrauch mit der Zeit verändern. Diese Veränderung ist jedoch nicht wünschenswert. So wird beklagt, dass der gegenwärtige Zustand der Sprache schlechter sei als der zuvor. Die Sprachentwicklung verläuft ihrer Ansicht nach daher insgesamt eher negativ. Sprachwandel wird in der Öffentlichkeit also als Sprachverfall empfunden. Schuld an dieser Verschlechterung sind vor allem fremdsprachige und migrationsbedingte Einflüsse.
In der vorliegenden Bachelor-Arbeit wird der Diskurs um Sprachwandel und Sprachverfall vorgestellt. Im Vordergrund steht dabei die Frage, welche Faktoren dazu führen, dass die Öffentlichkeit Sprachwandelphänomenen skeptisch gegenübersteht. Dafür werden zwei aktuelle Tendenzen der Gegenwartssprache und ihre Bewertungen genauer vorgestellt: der Anglizismeneinfluss und Kiezdeutsch. So hat die Mehrheit Angst vor dem Englischeinfluss und begründet sie damit, dass die englische Sprache das Deutsche überflutet und deswegen überfremdet. Kiezdeutsch wird als falsches Deutsch empfunden, weil es Strukturen aufweist, die vom Standarddeutschen abweichen. Zunächst soll gezeigt werden, dass solche Aussagen von außerlinguistischen Kriterien motiviert sind. Dafür wird die linguistische Perspektive vorgestellt, die beweist, dass die genannten Phänomene ihre Berechtigungen haben und keineswegs den Verfall des Deutschen herbeiführen. Es spielen daher subjektive Einstellungskriterien eine Rolle, die die Öffentlichkeit zu solchen Aussagen verleitet. Vor allem Stereotypisierungsprozesse dominieren dann die Bewertung von Sprachwandelphänomenen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Spracheinstellungsforschung
- a. Gründe für die Spracheinstellungsforschung
- b. Begriffe der Spracheinstellungsforschung
- i. Zum Begriff Einstellung
- ii. Zum Begriff Spracheinstellung
- III. Sprachverfall oder Sprachwandel?
- a. Sprachverfall – Sprache als geschlossenes System
- b. Sprachwandel – Sprache als offenes System
- i. ökonomisch kommunikative Bedürfnisse von Sprache
- ii. Sprachvariation
- IV. Anglizismen – Bedrohung oder Bereicherung?
- a. Die,Anglifizierung des Deutschen
- b. Die Anglizismenkritik
- i. Das Sprachbild der Anglizismenkritiker
- ii. Die Thesen der Anglizismenkritiker
- 1. Anglizismen sind überflüssig und verdrängen die deutsche Sprache
- 2. Anglizismen erschweren die Verständigung
- V. Kiezdeutsch
- a. Kiezdeutsch - eine Sprachverarmung
- b. Kiezdeutsch - eine Sprachinnovation
- i. Eine multiethnolektale Jugendsprache
- ii. Grammatische Kennzeichen
- iii. Kiezdeutsch als Identitätsakt
- iv. Spracheinstellungen zum Kiezdeutsch
- VI. Umfrage zu Tendenzen der Gegenwartssprache
- a. Abstract
- b. These
- c. Korpusbeschreibung
- d. Korpusanalyse
- i. Ergebnisauswertung
- ii. Ergebnisanalyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich dem Diskurs über Sprachwandel und Sprachverfall in der deutschen Sprache. Im Fokus steht die Frage, welche Faktoren dazu beitragen, dass die Öffentlichkeit Sprachwandelphänomenen skeptisch gegenübersteht. Hierfür werden zwei aktuelle Entwicklungen in der Gegenwartssprache - der Einfluss von Anglizismen und das Kiezdeutsch - im Detail analysiert. Die Arbeit zeigt, dass die negativen Bewertungen dieser Sprachformen oft auf außerlinguistischen Kriterien beruhen und subjektive Einstellungen eine bedeutende Rolle spielen.
- Die Bedeutung von Spracheinstellungen für die linguistische Forschung
- Die kritische Auseinandersetzung mit dem Sprachverfallstopos
- Die Analyse von Anglizismen und Kiezdeutsch als aktuelle Sprachwandelphänomene
- Die Untersuchung von Stereotypisierungsprozessen in der Bewertung von Sprachwandelphänomenen
- Die Rolle subjektiver Einstellungskriterien in der öffentlichen Sprachdebatte
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Diese Einleitung stellt den Diskurs um Sprachwandel und Sprachverfall in der Öffentlichkeit vor und argumentiert für die Relevanz der Spracheinstellungsforschung. Sie führt die beiden Schwerpunktthemen der Arbeit - Anglizismen und Kiezdeutsch - ein und skizziert den Aufbau der Arbeit.
- II. Spracheinstellungsforschung: Dieses Kapitel beleuchtet die Gründe für die zunehmende Bedeutung der Spracheinstellungsforschung in der Linguistik. Es erläutert die zentralen Begriffe "Einstellung" und "Spracheinstellung" im Kontext sozialer und psychologischen Faktoren und führt den Begriff "Language Attitudes" ein.
- III. Sprachverfall oder Sprachwandel?: Dieses Kapitel diskutiert die unterschiedlichen Perspektiven auf Sprachwandel und Sprachverfall. Es stellt die beiden kontrastierenden Ansätze "Sprache als geschlossenes System" (Sprachverfall) und "Sprache als offenes System" (Sprachwandel) gegenüber und erläutert die Bedeutung von ökonomisch kommunikativen Bedürfnissen und Sprachvariation.
- IV. Anglizismen – Bedrohung oder Bereicherung?: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Einfluss von Anglizismen auf die deutsche Sprache. Es analysiert die Kritik an Anglizismen, beleuchtet die Argumente der Anglizismenkritiker und stellt die Thesen der Kritik im Detail dar.
- V. Kiezdeutsch: Dieses Kapitel analysiert das Phänomen des Kiezdeutsch. Es beleuchtet die Debatte um Kiezdeutsch als Sprachverarmung oder Sprachinnovation und geht auf die grammatischen Kennzeichen und die Rolle von Kiezdeutsch als Identitätsakt ein. Das Kapitel untersucht auch die unterschiedlichen Spracheinstellungen zum Kiezdeutsch.
- VI. Umfrage zu Tendenzen der Gegenwartssprache: Dieses Kapitel beschreibt eine empirische Untersuchung zur Spracheinstellung. Es umfasst den Abstract, die These, die Korpusbeschreibung und die Analyse der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen dieser Arbeit sind Sprachwandel, Sprachverfall, Spracheinstellungsforschung, Language Attitudes, Anglizismen, Kiezdeutsch, Stereotypisierung, subjektive Einstellungskriterien und die öffentliche Sprachdebatte.
- Quote paper
- Ana Novitovic (Author), 2012, Spracheinstellungen zu Tendenzen der Gegenwartssprache. Sprachwandel oder Sprachverfall?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1282151