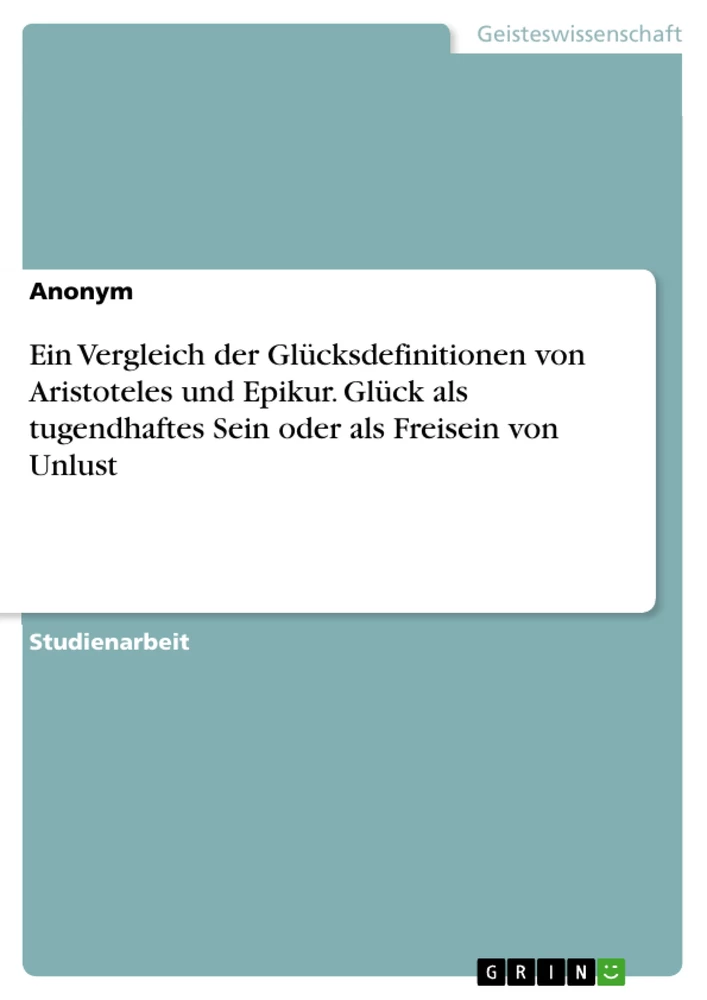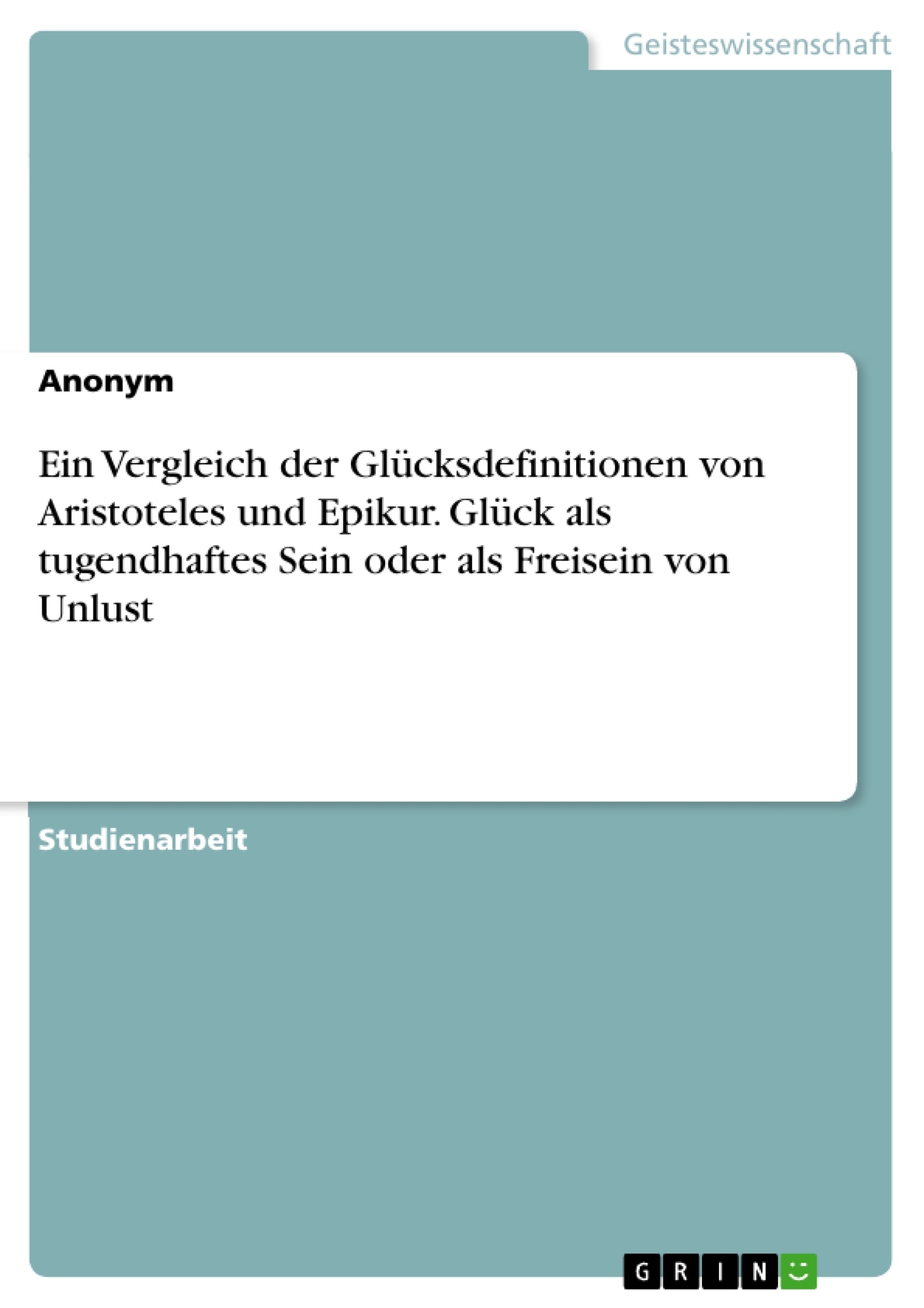Die folgende Arbeit behandelt im Rahmen eines Ethikseminars die antiken Glücksdefinitionen von Aristoteles und Epikur. Das Konzept des guten/glücklichen Lebens wird dabei wird fokussiert auf eine Gegenüberstellung, welche Gemeinsamkeiten beziehungsweise Unterschiede aufarbeitet.
Die Frage nach der Glückseligkeit ist ein elementarer Bestandteil der Philosophie, welche von der Antike bis zur Gegenwart relevant ist. Beschäftigungen mit dem Glück können als „zutiefst menschlich“ betrachtet werden. Das Glück ist in der Antike eher auf die Frage nach einem möglichst gelingenden, sinnvollen oder auch guten Leben bezogen. Die antiken Philosophen legen die gelungene Lebensführung, in Form des Glücks, begrifflich auf das Wort „Eudaimonia“ fest. Bei Höffe wird diese als eines von vier Grundmodellen der Ethik beschrieben. Die Eudaimonia besteht nicht in einem Zustand des vorübergehenden Empfindens, sondern in der Gesamtheit und Qualität eines gelungenen Lebens. Hat man dies erreicht, so hat man auch das Glück erreicht und lebt in Glückseligkeit. Das Ziel (telos) des Glücks als Lebensführung galt als unumstritten in der griechischen Philosophie und wird oft nicht explizit erwähnt, ist aber dessen Voraussetzung. Der Streitpunkt war eher die Frage, worin die Glückseligkeit konkret besteht und was man tun muss, um sie zu erreichen. Hier setzt die folgende Arbeit an: Es wird der Versuch unternommen, zwei unterschiedliche Entwürfe des Glücks anhand einschlägiger Sekundärliteratur vergleichend zu untersuchen. Aristoteles beschäftigt sich hauptsächlich in der Nikomachischen Ethik, die eine der relevantesten Werke von ihm ist, mit dem Glück. Epikur, ein bedeutender Vertreter des Hellenismus, behandelt seine Glücksauffassung maßgeblich im Brief an Menoikeus. Aufgrund ihrer Relevanz sind diese beiden Philosophen für den Vergleich gewählt. In der Arbeit wird zuerst die Eudaimonia nach Aristoteles und anschließend nach Epikur dargestellt. Die Fragestellung der Arbeit liefert den Fokus, der bei dieser Analyse gelegt werden soll. Bei Aristoteles ist das das tugendhafte Sein, bei Epikur ist es die Lust. Beide sind auf unterschiedliche Weise maßgeblich für die jeweiligen Definitionen. Die Konstruktionen sollen hinsichtlich ihrer Unterschiede und Gemeinsamkeiten dargestellt und abschließend kurz verglichen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Glück als tugendhaftes Sein - Glück bei Aristoteles
- Das höchste Gut: Eudaimonia
- Das Ergon und die Areté
- Die Seelenlehre und die Tugenden
- Die Lebensformen der Polis
- Glück als Freisein von Unlust - Glück bei Epikur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht und vergleicht die Glücksdefinitionen von Aristoteles und Epikur, zwei bedeutenden Philosophen der Antike. Dabei wird der Fokus auf die unterschiedlichen Konzepte des Glücks gelegt: bei Aristoteles das tugendhafte Sein, bei Epikur die Lust.
- Das höchste Gut in der Philosophie des Aristoteles: Eudaimonia
- Die Rolle der Tugendhaftigkeit in der Erlangung des Glücks nach Aristoteles
- Die Bedeutung der Vernunft und ihrer Ausübung in der Lebensführung
- Epikurs Konzept des Glücks als Freisein von Unlust
- Die Bedeutung von Lust und Schmerz in der epikureischen Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Glücksdefinitionen von Aristoteles und Epikur ein und stellt die Relevanz der Thematik in der Philosophie dar. Die Arbeit legt ihren Fokus auf die Frage nach den konkreten Bestandteilen der Glückseligkeit und den Handlungsrichtlinien, um sie zu erreichen.
- Glück als tugendhaftes Sein - Glück bei Aristoteles: Dieses Kapitel befasst sich mit der Glücksauffassung des Aristoteles. Es wird die Eudaimonia als das höchste Gut und das Ziel allen menschlichen Handelns definiert. Des Weiteren werden das Ergon-Argument, die Seelenlehre und die wichtigsten Tugenden erläutert. Zudem wird die Rolle der Politik und die verschiedenen Lebensformen, die Aristoteles beschreibt, dargestellt.
- Glück als Freisein von Unlust - Glück bei Epikur: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Epikurs Verständnis von Glück. Es wird die Auffassung vorgestellt, dass das Glück von der Autarkie der Seele und der Abwesenheit von Unlust abhängt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen der griechischen Philosophie, insbesondere mit den Konzepten des Glücks, der Tugendhaftigkeit, der Vernunft, der Lust und der Unlust. Sie befasst sich mit den zentralen Werken von Aristoteles (Nikomachische Ethik) und Epikur (Brief an Menoikeus) und untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihrer philosophischen Ansätze.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Ein Vergleich der Glücksdefinitionen von Aristoteles und Epikur. Glück als tugendhaftes Sein oder als Freisein von Unlust, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1281071