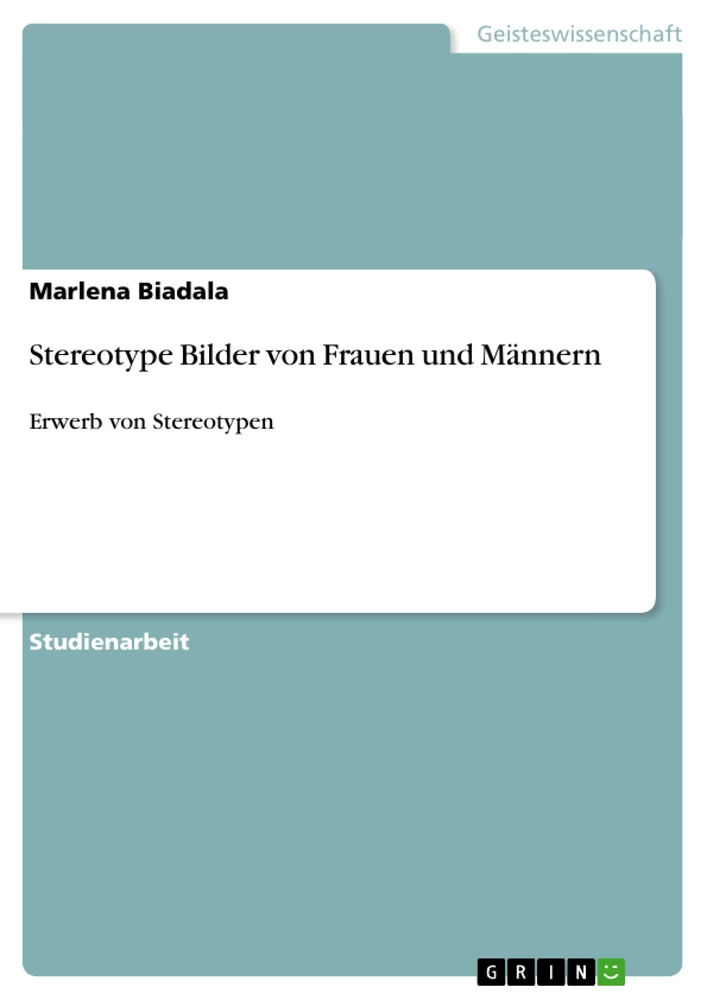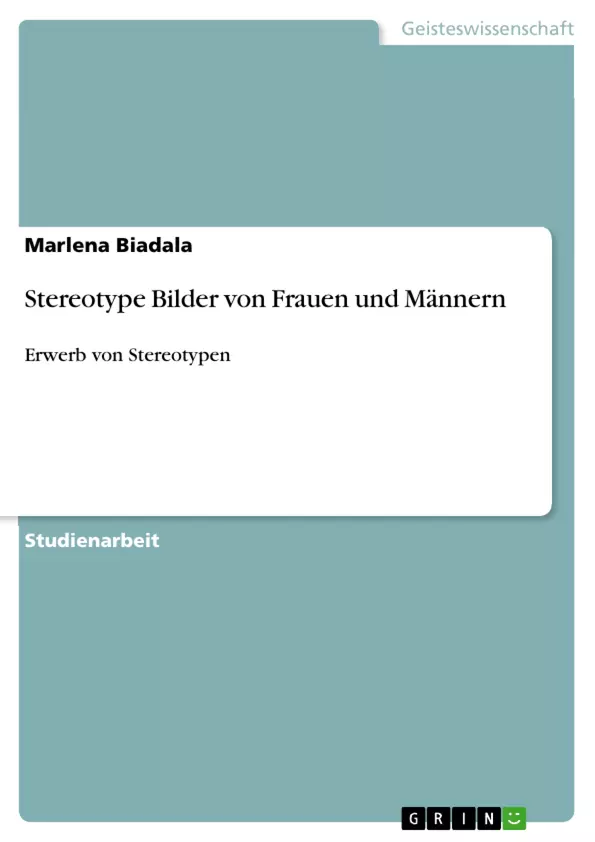Geschlechterstereotype sind Eigenschaften, die je nach dem Geschlecht von der Gesellschaft als typisch weiblich oder typisch männlich gesehen werden. Ge-schlechterrollen sind die Rollen, die jedem der Geschlechter zugeschrieben wer-den, d.h. das sind so zu sagen „Vorschriften“, nach denen sich typische Frauen und typische Männer richten sollen.
Wir begegnen Stereotypen jeden Tag. Wie eine typische Frau und ein typischer Mann sein sollen, wurde im Kapitel 4 besprochen. Kapitel 5 „Geschlechterrollen“ geht auf das weibliche und männliche Benehmen ein. Diese sind Beweise dafür, dass es nicht ausreicht, als eine Frau/ ein Mann zur Welt zu kommen, um sich als diese/r zu fühlen oder als diese/r von den anderen behandelt zu werden.
Weiter wurden Beispiele herausgesondert, um auf die Quellen von Geschlechter-stereotypenerwerb hinzuweisen. In den Fernsehserien werden wir mit dem Hausfrau-Bild konfrontiert, die Zeichentrickserien zeigen immer noch die Männer als das „stärkere- Geschlecht“, aufgrund von den Zeitschriften schließen wir, dass sich die Frauen nur für die Mode, Klatsch und nichts Wichtiges interessierten und dass die Männer die Macht besitzen würden und dass sie klüger seien, denn in den Männer-Zeitschriften werden schwierigere Themen behandelt. Man könnte jetzt zu der Schlussfolgerung kommen, dass sich nichts innerhalb von Jahren verändert hat. Die Männer stehen im Vordergrund, die Frauen immer noch im Hintergrund. Die von der Verfasserin dieser Arbeit durchgeführte Umfrage zeigt aber, dass die Frauen des 21. Jahrhunderts zielstrebiger und selbstständiger geworden sind, obwohl sie dabei emotional und träumerisch geblieben sind. Vielleicht kann als Fehler dieser Umfrage angesehen werden, dass nur Studenten und Studentinnen befragt wurden. Möglicherweise wären die Antworten anders gewesen, wenn sie unter nicht gebildeten Menschen durchgeführt worden wäre. Vielleicht soll man also sagen, die StudentInnen des 21. Jahrhunderts sind zielstrebiger und selbstständiger geworden. Es ist aber als positiv zu sehen, dass man doch- auch wenn nur unter Studierenden- eine Spur von Veränderungen finden kann. Die Tendenz ist, dass sich die Geschlechterstereotype sehr langsam verändern. Es ist aber höchstwahrscheinlich, dass die Enkelkinder unserer Enkelkinder den Spruch „Männer weinen nicht“ nicht mehr kennen lernen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Was ist überhaupt ein Geschlechterstereotyp?
- 3 Ursprünge der Geschlechterstereotype
- 4 Inhalte der Geschlechterstereotype
- 5 Geschlechterrollen
- 6 Erwerb von Stereotypen
- 6.1 Märchen
- 6.2 Lehrwerke
- 6.3 Zeitschriften
- 6.4 Fernsehserien
- 6.5 Zeichentrickserien
- 6.6 Werbung
- 6.7 Lieder
- 7 Zusammenfassung
- 8 Abstract
- 9 Literaturliste
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Geschlechterstereotype: ihre Definition, Ursprünge und den Erwerb im Laufe des Lebens. Das Ziel ist es, zu verstehen, wie diese Stereotype entstehen, welche Inhalte sie haben und welchen Einfluss sie auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Frauen und Männern ausüben. Die Arbeit hinterfragt, inwieweit biologisches Geschlecht (sex) allein ausreicht, um als Frau oder Mann wahrgenommen zu werden.
- Definition und Abgrenzung von Geschlechterstereotypen und Vorurteilen
- Soziokulturelle Ursprünge und Entwicklung von Geschlechterstereotypen
- Inhalte und Darstellung von Geschlechterstereotypen in verschiedenen Medien
- Der Erwerb von Geschlechterstereotypen durch Sozialisationsprozesse
- Der Einfluss von Geschlechterstereotypen auf die gesellschaftliche Rollenverteilung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Geschlechterstereotype ein und stellt die Forschungsfrage nach der Entstehung, dem Inhalt und dem Einfluss dieser Stereotype auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Frauen und Männern. Sie illustriert dies anhand persönlicher Kindheitserfahrungen und wirft die Frage auf, ob und wie sich das Bild der typischen Frau und des typischen Mannes verändert hat.
2 Was ist überhaupt ein Geschlechterstereotyp?: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Geschlechterstereotyp" und grenzt ihn von Vorurteilen ab. Es erläutert, dass Stereotype als relativ stabile, sozial geteilte Überzeugungen über die Merkmale von Frauen und Männern zu verstehen sind, die nicht unbedingt diskriminierend sein müssen. Der Fokus liegt auf der kognitiven Struktur dieser Stereotype und darauf, wie sie Informationen über Aussehen, Verhalten und soziale Rollen speichern und abrufen.
3 Ursprünge der Geschlechterstereotype: Hier werden die Ursachen für das Entstehen von Geschlechterstereotypen untersucht. Ein zentraler Punkt ist die ungleiche Machtverteilung zwischen den Geschlechtern, die in allen bekannten Kulturen besteht. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, historisch und auch in der heutigen Gesellschaft, wird als maßgeblicher Faktor für die Entstehung und Perpetuierung von Stereotypen dargestellt. Das Kapitel betont den Teufelskreis aus Rollenverteilung und Stereotypenverstärkung.
Schlüsselwörter
Geschlechterstereotype, Vorurteile, Sexismus, Geschlechterrollen, Sozialisation, Medien, Geschlechtergleichstellung, Machtverhältnisse, Arbeitsteilung.
Häufig gestellte Fragen zu "Geschlechterstereotype: Entstehung, Inhalt und Einfluss"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Geschlechterstereotype umfassend. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine Definition von Geschlechterstereotypen, die Erörterung ihrer Ursprünge, eine Analyse ihrer Inhalte und eine Betrachtung des Erwerbs von Stereotypen über verschiedene Sozialisationsinstanzen (Märchen, Lehrwerke, Medien etc.). Zusätzlich werden die Zielsetzung, die Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter aufgeführt.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, zu verstehen, wie Geschlechterstereotype entstehen, welche Inhalte sie haben und welchen Einfluss sie auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Frauen und Männern ausüben. Ein weiterer Fokus liegt auf der Frage, inwieweit biologisches Geschlecht allein ausreicht, um als Frau oder Mann wahrgenommen zu werden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung von Geschlechterstereotypen und Vorurteilen, soziokulturelle Ursprünge und Entwicklung von Geschlechterstereotypen, die Darstellung von Geschlechterstereotypen in verschiedenen Medien, den Erwerb von Geschlechterstereotypen durch Sozialisationsprozesse und den Einfluss von Geschlechterstereotypen auf die gesellschaftliche Rollenverteilung.
Wie werden Geschlechterstereotype in dieser Arbeit definiert?
Geschlechterstereotype werden als relativ stabile, sozial geteilte Überzeugungen über die Merkmale von Frauen und Männern definiert, die nicht unbedingt diskriminierend sein müssen. Der Fokus liegt auf der kognitiven Struktur dieser Stereotype und darauf, wie sie Informationen über Aussehen, Verhalten und soziale Rollen speichern und abrufen. Ein wichtiger Aspekt ist die Abgrenzung zu Vorurteilen.
Welche Ursprünge von Geschlechterstereotypen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die ungleiche Machtverteilung zwischen den Geschlechtern als zentralen Faktor für das Entstehen von Geschlechterstereotypen. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, historisch und in der heutigen Gesellschaft, wird als maßgeblicher Faktor für die Entstehung und Perpetuierung von Stereotypen dargestellt. Der Teufelskreis aus Rollenverteilung und Stereotypenverstärkung wird betont.
Wo werden Geschlechterstereotype erworben?
Der Erwerb von Geschlechterstereotypen wird im Kontext von Sozialisationsprozessen betrachtet. Die Arbeit analysiert verschiedene Quellen, darunter Märchen, Lehrwerke, Zeitschriften, Fernsehserien, Zeichentrickserien, Werbung und Lieder.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geschlechterstereotype, Vorurteile, Sexismus, Geschlechterrollen, Sozialisation, Medien, Geschlechtergleichstellung, Machtverhältnisse, Arbeitsteilung.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Definition von Geschlechterstereotypen, Ursprünge der Geschlechterstereotype, Inhalte der Geschlechterstereotype, Geschlechterrollen, Erwerb von Stereotypen (mit Unterkapiteln zu verschiedenen Medien), Zusammenfassung, Abstract und Literaturliste.
- Quote paper
- Marlena Biadala (Author), 2008, Stereotype Bilder von Frauen und Männern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128012