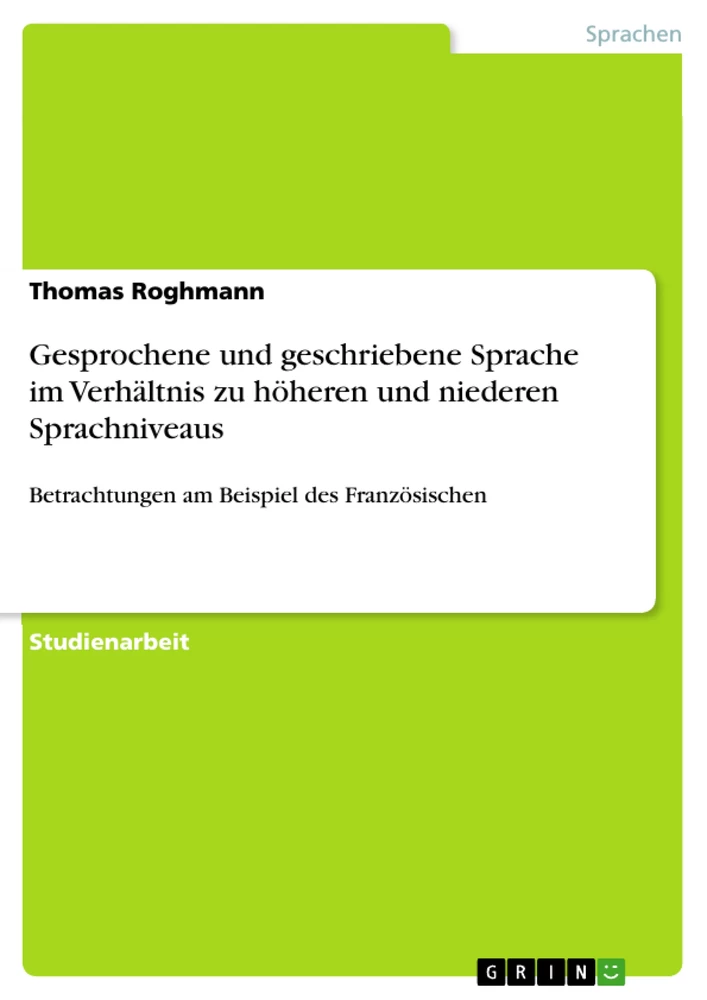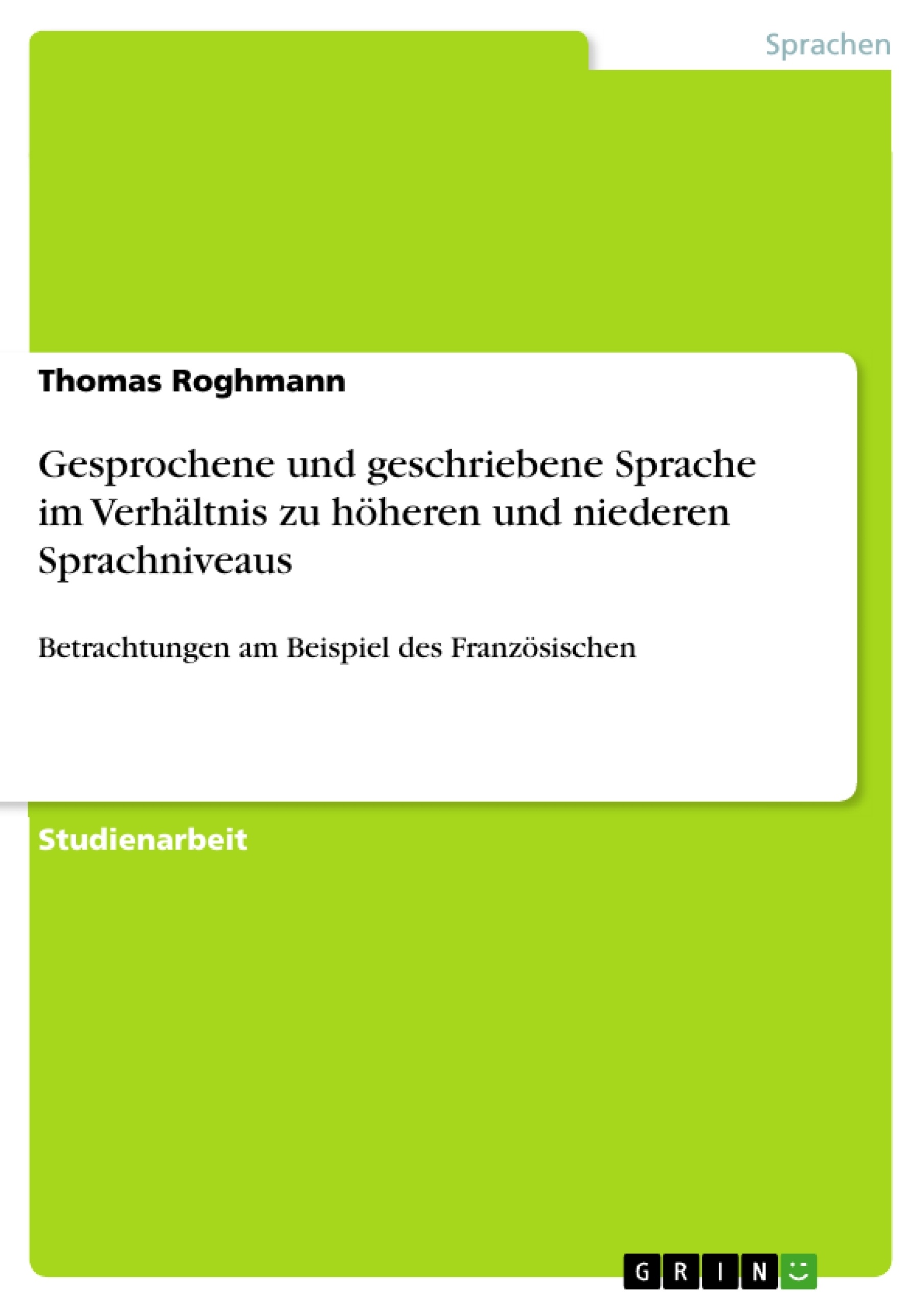Da das methodische Grundprinzip der Sprachwissenschaft bis Mitte der 60er Jahre auf einer idealisierenden Homogenitätsannahme beruhte, der zufolge alle Sprecher eines Systems dieselben sprachlichen Oppositionen realisieren und erkennen, ergaben sich Schwierigkeiten, die tatsächliche Heterogenität der historischen Einzelsprachen in bezug auf regionale, soziale und stilistische Varianten zu erfassen. Eugenio Coseriu, welcher diesen Mangel des Strukturalismus am deutlichsten wahrnahm, unterschied daher die Ebene der „funktionellen Sprache“ und jene der „Architektur der Sprache“. Letztere trägt der faktischen Untergliederung eines Systems in mehrere Subsysteme Rechnung.* Doch stellen Diatopik,
Diastratik und Diaphasik theoretische Konstrukte dar, die in der Praxis nicht klar voneinander abgegrenzt erscheinen, sondern sich vielmehr überlagern. Schließlich kann ein und dieselbe Sprachstruktur in bezug auf mehrere Dimensionen markiert sein. – Was die Unterscheidung zwischen gesprochener und geschriebener Sprache anbelangt, so ist zwar umstritten, ob ihr ebenfalls der Rang einer eigenständigen Variation im Sinne Coserius zukommt, feststeht aber, daß beide Aspekte bis zu einem bestimmten Grad auf eigenen Regeln beruhen, welche wiederum mit den übrigen Dimensionen gewisse Interferenzen eingehen. Das Endziel der vorliegenden Arbeit besteht darin zu zeigen, in welchem Verhältnis diastratische und „diamesische“ Ebene zueinander stehen, bzw. wie sich der Gegensatz aus ‚gesprochen’ und ‚geschrieben’ in Beziehung setzten läßt zu jenem aus höheren und niederen Sprachniveaus. Zuvor soll jedoch herausgearbeitet werden, inwiefern die Ebenen jeweils in sich differenziert sind. Daher widmen sich Kapitel 1 und 2 zunächst beiden Gegensatzpaaren einzeln. Während in Kapitel 1 der Unterscheidung zwischen Konzeption und Medialität eine übergeordnete Rolle zukommt, wird das darauffolgende Kapitel die Opposition zwischen höheren und niederen Niveaus mit Hilfe zweier unterschiedlicher Ansätze zu erklären versuchen. Bedingt durch Veränderungen in der Sozialstruktur moderner Gesellschaften, zeigt
auch die jüngere Sprachgeschichte Frankreichs eine Tendenz zur Auflösung diastratischer Differenzen, und zwar zugunsten einer Zunahme an diaphasischen Varietäten. Dieser Umstand, welcher Gegenstand des dritten Kapitels ist, beeinflußt automatisch die in Kapitel 4 vorgenommenen Zuordnungen, und sollte deshalb ebenfalls berücksichtigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesprochene Sprache und geschriebene Sprache
- Die Unterscheidung von code phonique/graphique und code parlé/écrit
- Zum Verhältnis von code phonique und code graphique
- Inkongruenz von graphischem und phonischem Zeicheninventar
- Divergenzen bei morphologischen Markierungen
- Metasprachliche Informationsleistung
- Zum Verhältnis von code parlé und code écrit
- Grad der Partizipation
- Grad der Situationsidentität
- Planungsgrad - Spontaneitätsgrad
- Grad der persönlichen Betroffenheit
- Gesprochen und „geschrieben' als eigenständige Varietätendimension ?
- Höhere und niedere Sprachniveaus
- High versus Low: Der Diglossiebegriff nach Charles A. Ferguson
- Elaborated code versus restricted code: Die Defizitkonzeption nach Basil Bernstein
- Zum Übergang zwischen diastratischer und diaphasischer Variation
- Code écrit und code parlé im Verhältnis zu höheren und niederen Sprachniveaus
- Quellennachweise
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis von gesprochener und geschriebener Sprache im Kontext von höheren und niederen Sprachniveaus. Sie untersucht, wie sich die Unterscheidung zwischen gesprochener und geschriebener Sprache in Bezug auf diastratische Variation (soziale Unterschiede) und diaphasische Variation (stilistische Unterschiede) darstellt. Die Arbeit analysiert die beiden Gegensatzpaare „gesprochen/geschrieben“ und „höhere/niedere Sprachniveaus“ und untersucht, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und ineinandergreifen.
- Untersuchung der Unterscheidung zwischen gesprochener und geschriebener Sprache anhand der Konzepte „code phonique/graphique“ und „code parlé/écrit“
- Analyse des Verhältnisses von „code phonique“ und „code graphique“ unter Berücksichtigung von Zeicheninventar, morphologischen Markierungen und metasprachlicher Informationsleistung
- Behandlung des Verhältnisses von „code parlé“ und „code écrit“ hinsichtlich Partizipation, Situationsidentität, Planungsgrad und persönlicher Betroffenheit
- Einordnung der Unterscheidung zwischen gesprochener und geschriebener Sprache in den Kontext von höheren und niederen Sprachniveaus
- Analyse der Entwicklung diastratischer und diaphasischer Varietäten in der jüngeren Sprachgeschichte Frankreichs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die methodischen Herausforderungen der Sprachwissenschaft im Umgang mit der Heterogenität von Sprachen dar und führt den Begriff der „funktionellen Sprache“ von Eugenio Coseriu ein. Sie erläutert die Bedeutung der Unterscheidung zwischen gesprochener und geschriebener Sprache und die Interaktion dieser Unterscheidung mit anderen Variationsdimensionen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, das Verhältnis von diastratischer und „diamesischer“ Ebene zu untersuchen und die Beziehung zwischen „gesprochen/geschrieben“ und „höheren/niedrigeren Sprachniveaus“ zu beleuchten.
Kapitel 1 befasst sich mit der Unterscheidung zwischen „code phonique/graphique“ und „code parlé/écrit“. Es wird erläutert, dass sich diese Unterscheidung auf das Medium der Kommunikation bezieht, während die Ebene der Konzeption die sprachlichen Regeln umfasst, die unabhängig vom Medium gelten. Die Notwendigkeit der Umkodierung zwischen verschiedenen Medien wird hervorgehoben und die Affinitäten zwischen „code phonique“ und „code parlé“ sowie „code graphique“ und „code écrit“ werden dargestellt.
Kapitel 2 untersucht das Verhältnis von „code phonique“ und „code graphique“. Es werden die Inkongruenzen zwischen graphischem und phonischem Zeicheninventar, die Divergenzen bei morphologischen Markierungen und die metasprachliche Informationsleistung der beiden Codes beleuchtet. Das Kapitel analysiert auch das Verhältnis von „code parlé“ und „code écrit“ in Bezug auf Partizipation, Situationsidentität, Planungsgrad und persönliche Betroffenheit.
Kapitel 3 befasst sich mit der Frage, ob „gesprochen“ und „geschrieben“ als eigenständige Varietätendimensionen betrachtet werden können. Es werden die Konzepte von Charles A. Ferguson (Diglossie) und Basil Bernstein (Elaborated code versus restricted code) vorgestellt, die unterschiedliche Ansätze zur Erklärung von höheren und niederen Sprachniveaus bieten.
Kapitel 4 untersucht den Übergang zwischen diastratischer und diaphasischer Variation. Es wird die Tendenz zur Auflösung diastratischer Differenzen in modernen Gesellschaften und die Zunahme an diaphasischen Varietäten in der jüngeren Sprachgeschichte Frankreichs beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die gesprochene und geschriebene Sprache, die Unterscheidung von „code phonique/graphique“ und „code parlé/écrit“, das Verhältnis von höheren und niederen Sprachniveaus, die Konzepte von Diglossie und Elaborated code versus restricted code, diastratische und diaphasische Variation sowie die Entwicklung der französischen Sprache.
- Quote paper
- Thomas Roghmann (Author), 2007, Gesprochene und geschriebene Sprache im Verhältnis zu höheren und niederen Sprachniveaus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127997