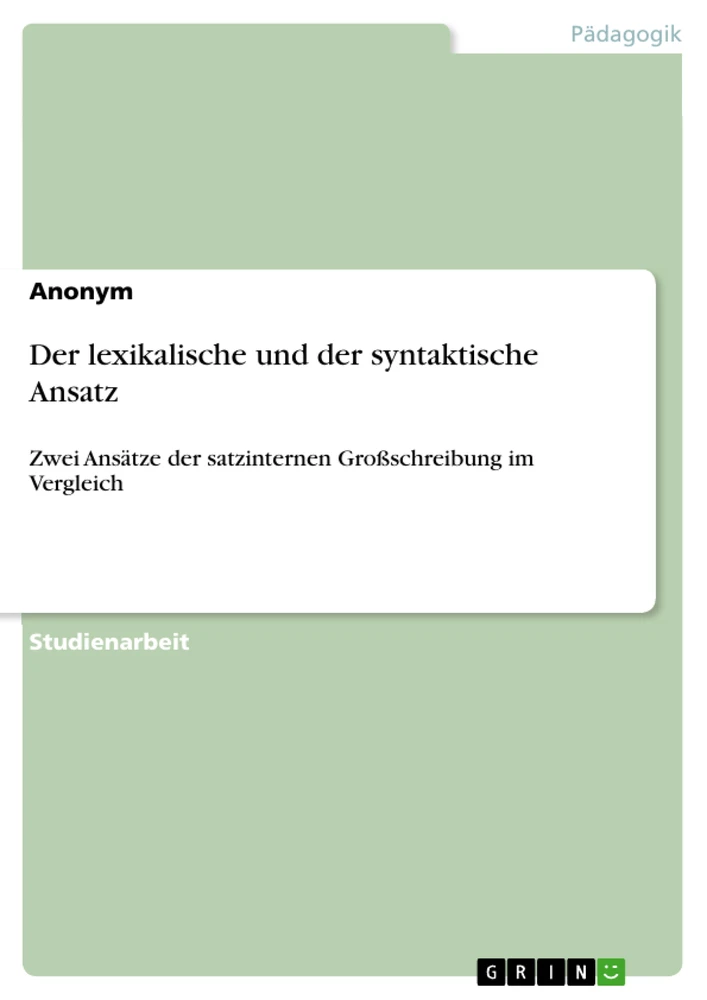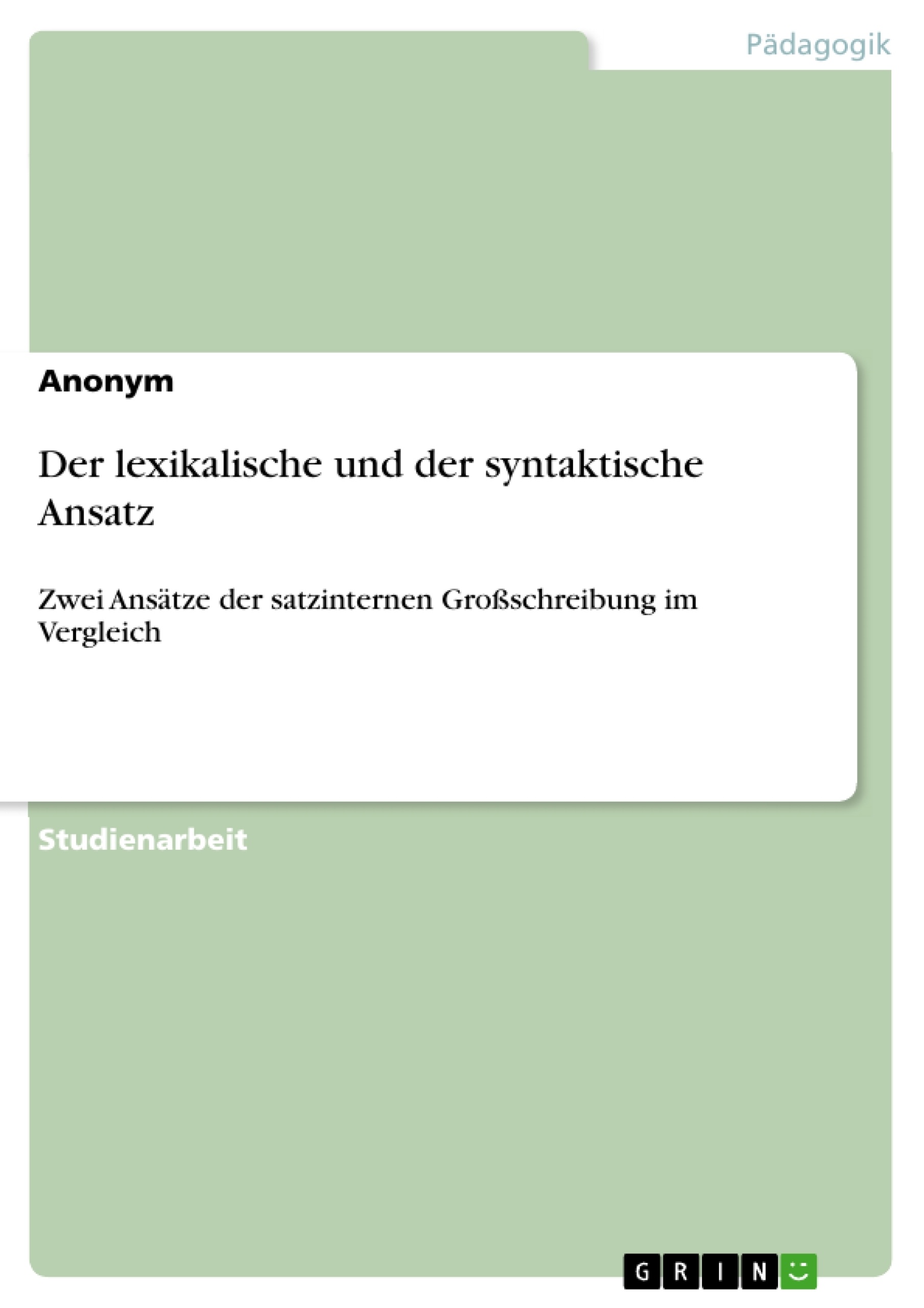Rechtschreibung und Rechtschreibunterricht sind ein wesentlicher Bestandteil des Deutschunterrichts in Baden-Württemberg. Deutschlehrerinnen und -lehrer sind für den erfolgreichen Orthografieerwerb ihrer Schülerinnen und Schüler verantwortlich, weshalb ihnen eine wichtige Aufgabe zugeschrieben wird, da diese Lernende dazu befähigt, an der Gesellschaft teilzuhaben. Dazu gehört das fehlerfreie Verfassen von Bewerbungen, geschäftlichen E-Mails und vieles mehr. Allerdings ist diese wichtige Aufgabe von extremer Komplexität und zahlreichen, vielfältigen Teilbereichen geprägt.
Einer der problematischsten Aspekte umfasst dabei die korrekte Groß- und Kleinschreibung. Diesen Bereich kann man in mehrere Teilbereiche gliedern, wovon die satzinterne Großschreibung Schreibenden die größten Schwierigkeiten bereitet (vgl. Betzel/Droll 2020). Daher soll diese, neben den kurz angeschnittenen Regelungsbereichen, vor allem fokussiert werden.
Die satzinterne Großschreibung ist anhand zwei verschiedener Ansätze beschreibbar: den lexikalischen und den syntaktischen Ansatz. Bevor diese näher beleuchtet werden, wird zunächst die Entstehung der Großschreibung in der deutschen Sprache aufgegriffen. Daraufhin werden die beiden Prinzipien näher untersucht, aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet und deren Möglichkeiten, aber auch Mängel aufgezeigt. Im Anschluss soll ein Vorschlag für den Einsatz im schulischen Kontext skizziert werden, der die Erlernung der satzinternen Großschreibung ermöglicht. Dabei gilt es abzuwägen bzw. herauszuarbeiten, inwiefern die beiden Ansätze dazu einen Beitrag leisten können und welche Funktion sie wann und wie dabei übernehmen können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Entstehung der Großschreibung
- 2.1 Entwicklung der Majuskeln, Minuskeln und der Großschreibung
- 2.2 Historik der satzinternen Großschreibung
- 3. Die korrekte Großschreibung
- 3.1 Reglungsbereiche der Großschreibung
- 3.2 Die korrekte satzinterne Großschreibung
- 3.2.1 Die korrekte satzinterne Großschreibung anhand lexikalischer Eigenschaften
- 3.2.1.1 Prototypische Substantive im Rahmen des lexikalischen Ansatzes
- 3.2.1.2 Substantivierungen im Rahmen des lexikalischen Ansatzes
- 3.2.2 Die korrekte satzinterne Großschreibung anhand syntaktischer Eigenschaften
- 3.2.2.1 Prototypische Substantive im Rahmen des syntaktischen Ansatzes
- 3.2.2.2 Substantivierungen im Rahmen des syntaktischen Ansatzes
- 4. Einsatz im schulischen Kontext
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die satzinterne Großschreibung im Deutschen, indem sie zwei gegensätzliche Ansätze – den lexikalischen und den syntaktischen – vergleicht und gegenüberstellt. Ziel ist die Entwicklung eines fundierten didaktischen Vorschlags zur Vermittlung der satzinternen Großschreibung im Schulunterricht. Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung der Großschreibung und beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus den unterschiedlichen Ansätzen ergeben.
- Historische Entwicklung der Groß- und Kleinschreibung im Deutschen
- Vergleich des lexikalischen und des syntaktischen Ansatzes zur satzinternen Großschreibung
- Analyse der Stärken und Schwächen beider Ansätze
- Didaktische Implikationen für den Rechtschreibunterricht
- Entwicklung eines praxisorientierten Vorschlags für den Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung korrekter Rechtschreibung im Deutschunterricht und hebt die besondere Schwierigkeit der Groß- und Kleinschreibung hervor. Sie fokussiert sich auf die satzinterne Großschreibung als einen zentralen Problem-bereich und führt die beiden zu vergleichenden Ansätze – den lexikalischen und den syntaktischen – ein. Die Arbeit skizziert ihr Ziel: die Entwicklung eines didaktischen Vorschlags für den Umgang mit satzinterner Großschreibung im Unterricht.
2. Die Entstehung der Großschreibung: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung der Groß- und Kleinschreibung. Es beginnt mit der Verwendung ausschließlich von Majuskeln in der Antike und verfolgt die Entstehung der Minuskeln im Kontext der erhöhten Lesbarkeitserfordernisse in Klöstern. Die Arbeit zeigt, wie die Majuskeln von einer rein funktionalen Schreibweise zu einer hervorhebenden Funktion entwickelten, die zunächst für den Textbeginn, später für Satz-, Absatz- und Strophenanfänge verwendet wurde. Der Fokus liegt auf der schrittweisen Entwicklung der satzinternen Großschreibung, beginnend mit der Großschreibung von Nomina sacra, und ihrer Ausweitung auf weitere Wortklassen.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Satzinterne Großschreibung im Deutschen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die satzinterne Großschreibung im Deutschen und vergleicht zwei gegensätzliche Ansätze: den lexikalischen und den syntaktischen Ansatz. Ziel ist die Entwicklung eines fundierten didaktischen Vorschlags zur Vermittlung der satzinternen Großschreibung im Schulunterricht.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der Großschreibung, den Vergleich des lexikalischen und syntaktischen Ansatzes, die Analyse der Stärken und Schwächen beider Ansätze, didaktische Implikationen für den Rechtschreibunterricht und die Entwicklung eines praxisorientierten Vorschlags für den Unterricht. Sie beinhaltet eine detaillierte Inhaltsübersicht mit Kapiteln zur Entstehung der Großschreibung, der korrekten Großschreibung (inklusive lexikalischen und syntaktischen Aspekten, unterschieden nach prototypischen Substantiven und Substantivierungen), und dem Einsatz im schulischen Kontext.
Wie wird die historische Entwicklung der Großschreibung dargestellt?
Das Kapitel zur Entstehung der Großschreibung beschreibt die Entwicklung von der ausschließlichen Verwendung von Majuskeln in der Antike über die Entstehung der Minuskeln bis hin zur Entwicklung der Großschreibung von Nomina sacra und deren Ausweitung auf weitere Wortklassen. Es wird die schrittweise Entwicklung der satzinternen Großschreibung beleuchtet und der Wandel von der rein funktionalen zur hervorhebenden Funktion der Majuskeln erläutert.
Welche Ansätze zur satzinternen Großschreibung werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht den lexikalischen und den syntaktischen Ansatz zur satzinternen Großschreibung. Beide Ansätze werden detailliert erläutert, und zwar getrennt nach prototypischen Substantiven und Substantivierungen. Die Stärken und Schwächen beider Ansätze werden analysiert.
Welches Ziel verfolgt die didaktische Betrachtung?
Das Ziel der didaktischen Betrachtung ist die Entwicklung eines praxisorientierten Vorschlags für den Unterricht zur Vermittlung der satzinternen Großschreibung. Die Arbeit zielt darauf ab, Lehrkräften ein fundiertes Werkzeug an die Hand zu geben, um die Herausforderungen der satzinternen Großschreibung im Unterricht effektiv zu bewältigen.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Entstehung der Großschreibung, ein Kapitel zur korrekten Großschreibung (unterteilt in Reglungsbereiche und die korrekte satzinterne Großschreibung nach lexikalischen und syntaktischen Eigenschaften), ein Kapitel zum Einsatz im schulischen Kontext und ein Fazit. Die detaillierte Kapitelstruktur ist im Inhaltsverzeichnis ersichtlich.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Hausarbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Satzinterne Großschreibung, Lexikalischer Ansatz, Syntaktischer Ansatz, Majuskeln, Minuskeln, Nomina sacra, Rechtschreibung, Didaktik, Deutschunterricht, Prototypische Substantive, Substantivierungen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Der lexikalische und der syntaktische Ansatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1278899