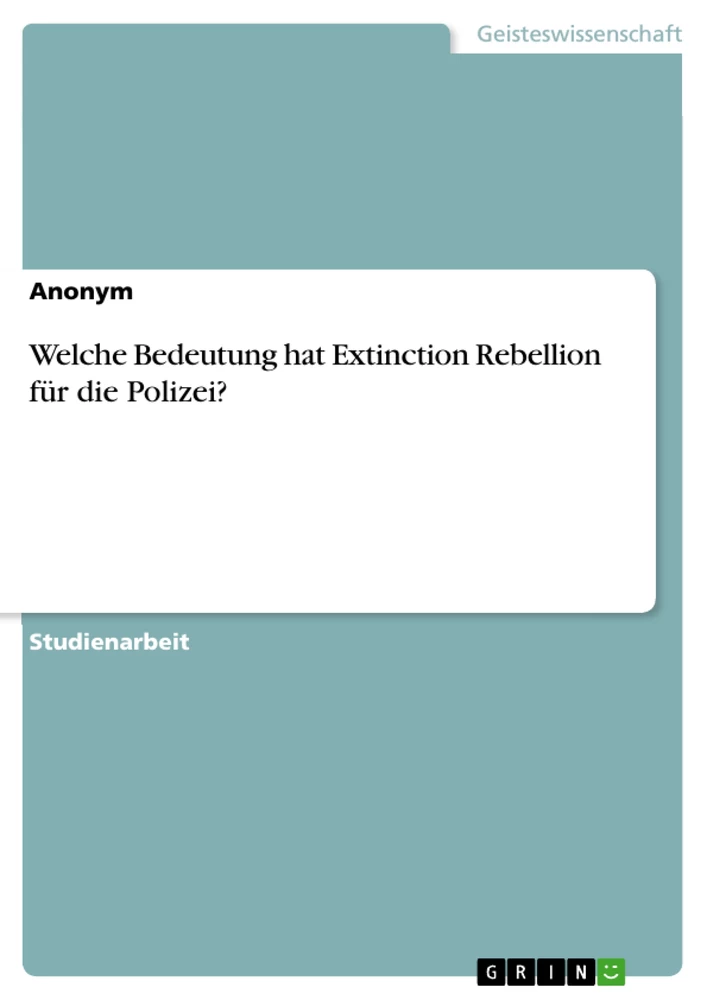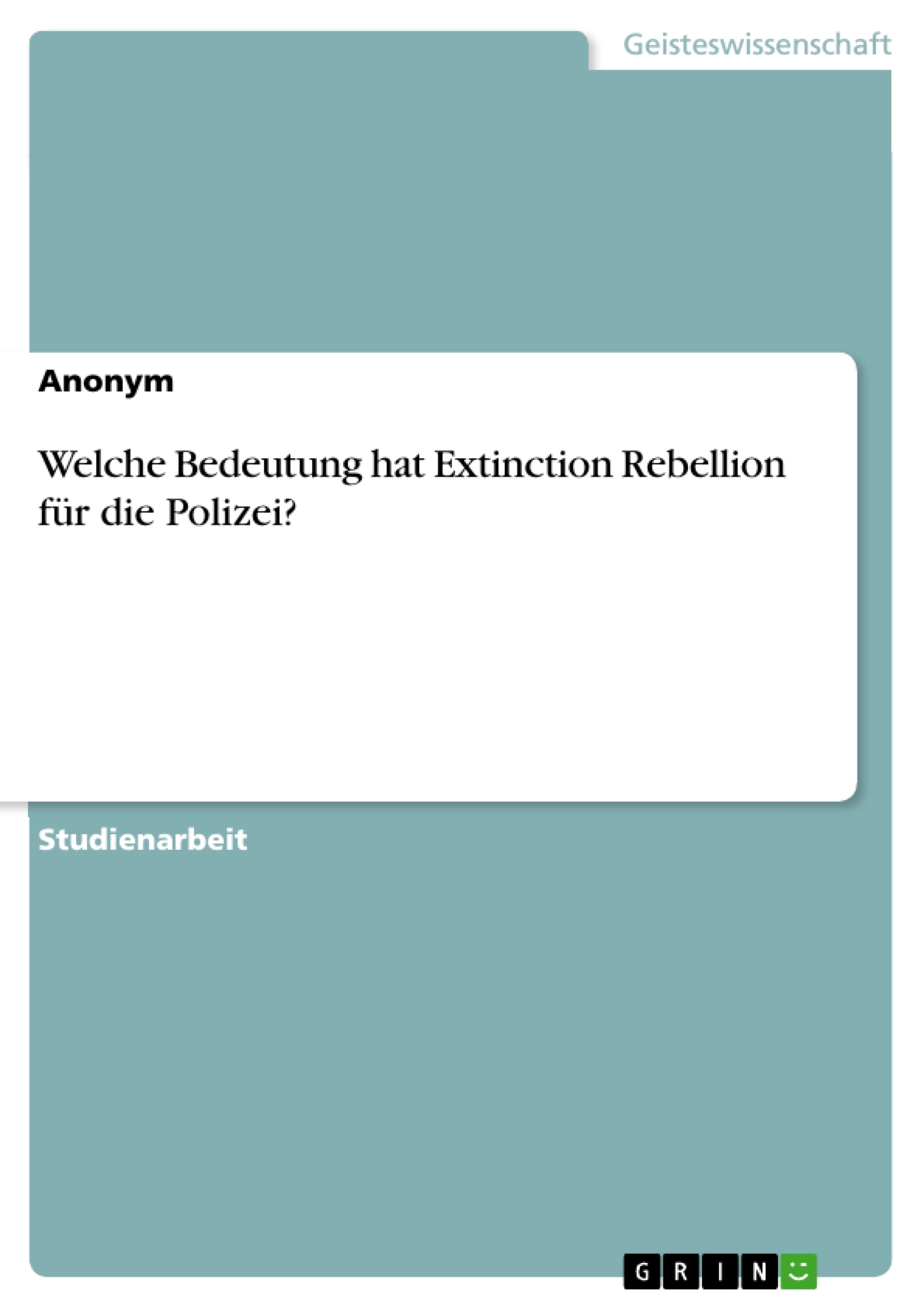Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung der Bewegung "Extinction Rebellion" (XR) für die Polizei. Die Jahre 2020/2021 standen im Zeichen einer Pandemie, die zu einer weltweiten Krise führte und die Regierungen aller Länder unter sofortigen Handlungszwang setzte. Dabei gerät fast in den Hintergrund, dass das letzte Jahrzehnt auch durch ein weiteres großes Thema bestimmt wurde, den Klimawandel. Bis heute polarisiert er Gesellschaften auf dem gesamten Planeten. Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 erlangten die mittlerweile weltweiten Bewegungen „Fridays for Future“ (FFF) sowie XR besondere mediale Aufmerksamkeit. Während FFF versucht, durch globale Schulstreiks auf die klimapolitischen Missstände hinzuweisen und sich dabei überwiegend im Rahmen der Legalität bewegt, nutzt XR zur Agitation der Bevölkerung medienwirksame Aktionen des gewaltfreien zivilen Ungehorsams.
Besondere Aufmerksamkeit erlangte XR bei ihrem ersten „Rebellion Day“ am 17.11.2018, als die Gruppierung fünf Brücken über der Themse für mehrere Stunden blockierten und so ein immenses Verkehrschaos verursachten. Nach eigenen Angaben waren hierbei über 6.000 Personen beteiligt, von denen 85 verhaftet wurden. Diese Personen setzten sich jedoch nicht aus einem gewaltbereiten Mob zusammen, sondern waren ein Zusammenschluss von Menschen aller Altersgruppen und verschiedensten Bevölkerungsteilen, wobei die Friedlichkeit des Protestes durch spielende und tanzende Gruppen aktiv nach außen dargestellt wurde. Für die Polizei ergibt sich hierbei eine nicht unerhebliche Diskrepanz. Einerseits hat sich XR der Gewaltlosigkeit verschrieben und folgt, wie die Polizei, einem aus objektiver Betrachtung „gutem Zweck“, anderseits ruft die Bewegung zu zivilem Ungehorsam sowie Systemveränderung auf und nimmt dabei sogar Festnahmen in Kauf.
Behr unterscheidet für die Polizei in zwei unterschiedliche kulturelle Bezugssysteme, einerseits die offizielle Police Culture (Polizeikultur) und anderseits eine informelle Cop Culture (Polizistenkultur). XR soll in dieser Arbeit in Relation zu diesen beiden Bezugssystemen gesetzt werden. Dabei wird den Fragestellungen nachgegangen: Inwiefern kann die deutsche Polizei beim Vorgehen gegen die betont zivil, friedlichen Aktionen von XR das Bild einer toleranten Bürgerpolizei im Sinne der Police Culture aufrechterhalten? Und welche Bedeutung haben o.g. Aktionen für Einsatzkräfte, die entsprechend der Cop Culture agieren und im Rahmen von Versammlungslagen auf XR treffen?
Inhalt
1 Einleitung
2 Extinction Rebellion
2.1 Entstehung und Organisationsstruktur
2.2 Ethos der Bewegung
2.3 Aktionsformen
3 Die Rolle der Polizei im Spannungsfeld der Klimaproteste
3.1 Police Culture versus Cop Culture
3.2 Die Polizei im Umgang mit Extinction Rebellion
4 Fazit
I Abkürzungsverzeichnis
II Abbildungsverzeichnis
III Anlagenverzeichnis
5 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Die Jahre 2020/2021 standen im Zeichen einer Pandemie, die zu einer weltweiten Krise führte und die Regierungen aller Länder unter sofortigen Handlungszwang setzte. Dabei gerät fast in den Hintergrund, dass das letzte Jahrzehnt auch durch ein weiteres großes Thema bestimmt wurde, den Klimawandel. Bis heute polarisiert er Gesellschaften auf dem gesamten Planeten. Wenngleich wissenschaftlicher Konsens besteht, dass es einen Klimawandel gibt (vgl. Deutsches Klima-Konsortium, Deutsche Meteorologische Gesellschaft, Deutscher Wetterdienst, Extremwetterkongress Hamburg, Helmholtz-Klima-Initiative, klimafakten.de 2020), herrscht Uneinigkeit über das Ausmaß des Einflusses der Menschen darauf und die zu treffenden Maßnahmen dagegen. Aus diesem Grund versuchen Wissenschaft, Umweltschutzorganisationen und -bewegungen seit Jahrzehnten die Politik zum Handeln zu bringen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 erlangten die mittlerweile weltweiten Bewegungen „Fridays for Future“ (FFF) sowie „Extinction Rebellion“ (XR) besondere mediale Aufmerksamkeit. Während FFF versucht, durch globale Schulstreiks auf die klimapolitischen Missstände hinzuweisen und sich dabei überwiegend im Rahmen der Legalität bewegt, nutzt XR zur Agitation der Bevölkerung medienwirksame Aktionen des gewaltfreien zivilen Ungehorsams .
Besondere Aufmerksamkeit erlangte XR bei ihrem ersten sog. „Rebellion Day“ am 17.11.2018, als die Gruppierung fünf Brücken über der Themse für mehrere Stunden blockierten und so ein immenses Verkehrschaos verursachten. Nach eigenen Angaben waren hierbei über 6.000 Personen beteiligt, von denen 85 verhaftet wurden (Harrabin 2018). Diese Personen setzten sich jedoch nicht aus einem gewaltbereiten Mob zusammen, sondern waren ein Zusammenschluss von Menschen aller Altersgruppen und verschiedensten Bevölkerungsteilen, wobei die Friedlichkeit des Protestes durch spielende und tanzende Gruppen aktiv nach außen dargestellt wurde. Die Bewegung ist mittlerweile weltweit vertreten und auch in Deutschland regelmäßig aktiv. Jüngst machte XR im Rahmen einer einwöchigen Protestwoche der sog. „Rebellionwave“ auf sich aufmerksam. In diesem Zeitraum wurden u.a. in Berlin am 06.10.2020 mehrere Straßen blockiert und das „Haus der Wirtschaft“ besetzt, in welchem sich der Hauptsitz des Deutschen Braunkohlevereins befindet. Vor dem Objekt ketteten sich Aktivistinnen und Aktivisten an Betonklötze und verschickten, nach eigener Aussage, die entsprechenden Schlüssel zusammen mit Gesprächseinladungen an die Parteizentralen der CDU und SPD (vgl. Alten 2021).
Für die Polizei ergibt sich hierbei eine nicht unerhebliche Diskrepanz. Einerseits hat sich XR der Gewaltlosigkeit verschrieben und folgt, wie die Polizei, einem aus objektiver Betrachtung „gutem Zweck“, anderseits ruft die Bewegung zu zivilem Ungehorsam sowie Systemveränderung auf und nimmt dabei sogar Festnahmen in Kauf (vgl. Extinction Rebellion 2020). Hinzu kommt, dass die Aktionen von XR nicht vergleichbar mit den militanten Aktionen anderer Gruppierungen, wie beispielsweise „Ende Gelände“ sind, bei denen häufig klare Straftatbestände erfüllt werden und daraus ebenso klare Handlungsrahmen für die Polizei entstehen. Extinction Rebellion tritt mit kreativen und neuartigen Aktionsformen auf, die häufig an der Schwelle der Legalität stattfinden, denen statt Gewalt aber eine Insubordination zugrunde liegt, die für Polizistinnen und Polizisten (PVB) oftmals mit Gewalt gleichgesetzt wird resp. ebenso schwer zu ertragen sein könnte.
Behr (2013) unterscheidet für die Polizei in zwei unterschiedliche kulturelle Bezugssysteme, einerseits die offizielle Police Culture (Polizeikultur) und anderseits eine informelle Cop Culture (Polizistenkultur) (vgl. Behr 2013: 84). XR soll in dieser Arbeit in Relation zu diesen beiden Bezugssystemen gesetzt werden. Dabei wird den Fragestellungen nachgegangen: Inwiefern kann die deutsche Polizei beim Vorgehen gegen die betont zivil, friedlichen Aktionen von XR das Bild einer toleranten Bürgerpolizei im Sinne der Police Culture aufrechterhalten? Und welche Bedeutung haben o.g. Aktionen für Einsatzkräfte, die entsprechend der Cop Culture agieren und im Rahmen von Versammlungslagen auf XR treffen?
2 Extinction Rebellion
Im Weiteren wird es notwendig sein, die Entstehung von XR und den heutigen Aufbau nachzuvollziehen, um herauszustellen, wie diese Bewegung zu einer derartigen Verbreitung resp. Popularität kommen konnte. Dabei muss betrachtet werden, ob es sich bei XR um einen losen Zusammenschluss aus verschiedensten Kleingruppierungen oder eine Gesamtorganisation handelt, über die Aussagen auf der Makroebene möglich sind, um sie ins Verhältnis zur Institution Polizei auf gleicher Analyseebene zu setzen. Ferner wird auf das Selbstverständnis sowie die Aktionsformen von XR eingegangen, um zu verdeutlichen, was die Bewegung von anderen Umweltorganisationen abgrenzt und wie sie damit ein Novum für die Polizei darstellt.
2.1 Entstehung und Organisationsstruktur
Im Jahr 2015 gründeten die ehemaligen Mitglieder der kapitalismus- und globalisierungs-kritischen „Occupy Bewegung“ Gail Bradbook und George Bada die Kapitalgesellschaft „Compassionate Revolution Limited“, welche zunächst die Finanzierung der Umweltkampagne „Rising up“ gewährleistete. Nach deren vergleichsweise geringem Erfolg wurde im Jahr 2018 „Extinction Rebellion“ gegründet (Thorwarth 2019). XR bezeichnet sich als eine dezentralisierte Massenbewegung besorgter Bürgerinnen und steht nach eigenen Angaben allen offen, die sich der gewaltfreien Kampagne des zivilen Ungehorsams anschließen (Kaufmann et al. 2019: 21). Dabei formuliert die Bewegung drei Hauptforderungen:
„1. Die Regierung muss die Wahrheit sagen, indem sie einen klimatischen und ökologischen Notstand erklärt und in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen die Dringlichkeit eines Wandels vermittelt.
2. Die Regierung muss umgehend handeln, um den Verlust der Artenvielfalt zu stoppen und die Treibhausgasemission bis 2025 auf null zu reduzieren.
3. Die Regierung muss eine Bürgerversammlung für Klima- und Ökogerechtigkeit schaffen und sich von deren Beschlüssen leiten lassen.“ (ebd.: 21)
Extinction Rebellion „[…] organisiert sich auf lokaler Ebene in Ortsgruppen [Mikroebene], auf bundesweiter Ebene in ‚nationalen Arbeitsgruppen‘ [Mesoebene] und auf internationaler Ebene als XR International [Makroebene]“ (vgl. XR Deutschland 2019b). Nach eigenen Angaben gibt es durch diese dezentrale Struktur 1139 Ortsgruppen in 75 Ländern (s. Abbildung 1), auf Deutschland entfallen hierbei 96 Ortsgruppen (vgl. Extinction Rebellion 2021).
Die lokalen Ortsgruppen teilen sich thematisch in Arbeitsgruppen auf, klassische Themenfelder sind Logistik, Aktion, Presse, Finanzen, Regenerative Kultur, Strategie, Politik sowie Talks & Training. Die Kommunikation in den Arbeitsgruppen findet oft in Form eines Plenums statt, wobei auch Delegierte benannt werden, welche die Arbeitsgruppe nach außen vertreten. Diese stimmen auf bundesweiter Ebene im sog. „Ankerkreis“ über die zukünftige Ausrichtung der Bewegung ab (vgl. XR Deutschland 2019b).
Das Verfahren zur Gründung einer Ortsgruppe ist vergleichsweise einfach und für XR Deutschland vorgeschrieben (vgl. XR Deutschland 2019a: 1). Notwendig ist der elektronische Kontakt via E-Mail zur nationalen Arbeitsgruppe „Community“, bei welchem persönliche Daten angeben werden. Weiterhin muss sich der Gründer zu den zehn Prinzipien und Werten der Bewegung (s. Anlage 1) bekennen, die als Coporate Identity von XR gesehen werden können. Als Empfehlung gelten, die Verfügbarkeit eines Raumes und vier weitere Mitstreiter. Anschließend erhält die Ortsgruppe eine individualisierte E-Mail-Adresse sowie Leitfäden und Literatur zugewiesen und kann mit den eigenen Aktionen unter Bezugnahme auf XR beginnen. Für die erste Zeit erhalten die neuen Gruppen Unterstützung der übergeordneten nationalen Arbeitsgruppen, was u.a. bis hin zur Übersendung vorgefertigter Vorträge zur Akquirierung neuer Mitglieder auf Informationsveranstaltungen reicht (vgl. XR Deutschland 2019a: 6).
Bei der Recherche nach Inhalten und Internetauftritten von XR fällt auf, dass sich die Ausgestaltung der Websites sowie die Darstellung im Bereich der Social Media stark ähneln bzw. nahezu identisch sind. Hervorzuheben ist hier insbesondere das sog. „Extinction Logo“ (s. Abbildung 2), welches die häufigste Verwendung findet und bei nahezu allen Aktionen weltweit gezeigt wird. Hier wird deutlich, dass die verschiedenen Ortsgruppen einem gemeinsamen Corporate Design unterliegen, welches Darstellungen für Webpräsenzen bis hin zur Nutzung von bestimmten Bannern und Transparent vorgibt (vgl. Extinction Rebellion 2019). Das steigert den Wiedererkennungswert und lässt die Bewegung ubiquitär erscheinen. Im Gegenzug zu den Verpflichtungen zum Corporate Design und auch -Identity von XR erhalten die neuen Ortsgruppen „Know-How“ (Ratgeber, Leitfäden, Checklisten) bis hin zu konkreter logistischer Unterstützung.
Aufgrund dieser strikten Vorgaben hinsichtlich eines einheitlichen Auftretens, liegt hier bei der Organisationsform der Bewegung der Vergleich zu einem Franchise-Modell nahe. Die Ortsgruppen agieren nach fest vorgeschriebenen und verpflichtenden Handlungsanweisung sowie Prinzipien und Werten. Insofern besteht XR in Größe und Ausgestaltung aus verschiedensten Ortsgruppen und Mitgliedern, über die nur schwerlich generelle Aussagen getroffen werden können. Diese richten sich jedoch nach den selbst gegeben Normen der globalen Bewegung, weshalb eine Betrachtung der Gesamtorganisation XR für die vorliegende Arbeit auf der Makroebene ermöglicht wird.
2.2 Ethos der Bewegung
Extinction Rebellion will sich mit seinen gewaltfreien Aktionen des zivilen Ungehorsams subversiv gegen die Regierungen und Großkonzerne der Welt richten und fordert dabei mit der Einführung der Bürger*innenversammlungen nicht weniger als ein neues Regierungssystem. Von anderen politischen Bewegungen, die ebenfalls nach einer Systemänderung oder gar Überwindung streben, wird diese gewaltfreie Haltung wie folgt eingeschätzt. „XR have been accused of beeing anarchist by the right-wing press and heavily critiqued for not being anarchist enough by self-described anarchists […]“ (Berglund/Schmidt 2020: 16). Wie in den gemeinsamen Prinzipien und Werten dargestellt, (s. Anlage 1) versucht XR zum Erreichen des o.g. Ziels eine kritische Masse von 3,5% der Gesamtbevölkerung zu mobilisieren. Hierbei stützt sich die Bewegung auf die Arbeiten der Politologinnen Chenoweth und Stephan, die Umbrüche in autoritären resp. totalitären System untersuchten (Manemann 2019a: 49). Chenoweth und Stephan stellten zudem heraus, dass gewaltfreie Handlungen besonders für Systemveränderungen geeignet seien, da dies die Wahrscheinlichkeit erhöhen würde, dass Mitglieder der Regierung sich der Revolution anschlössen: „Internally, members of a regime including civil servants, security forces, and members of the judiciary are more likely to shift loyalty toward nonviolent opposition groups than toward violent opposition groups” (Stephan/Chenoweth 2008: 11). Aus diesem Grund entschied sich die Bewegung für Aktionen des gewaltfreien zivilen Ungehorsams und propagiert diesen schwer abgrenzbaren Terminus bei allen ihrer Aktionen.
Als Definition für zivilen Ungehorsam können in diesem Zusammenhang die Ausführungen von Habermas herangezogen werden:
„Ziviler Ungehorsam ist ein moralisch begründeter Protest, dem nicht nur private Glaubensüberzeugungen oder Eigeninteressen zugrunde liegen dürfen. Er ist ein öffentlicher Akt, der in der Regel angekündigt ist und von der Polizei in seinem Ablauf kalkuliert werden kann; er schließt die vorsätzliche Verletzung einzelner Rechtsnormen ein, ohne den Gehorsam gegenüber der Rechtsordnung im Ganzen zu affizieren; er verlangt die Bereitschaft, für die rechtlichen Folgen der Normverletzung einzustehen; die Regelverletzung, in der sich ziviler Ungehorsam äußert und hat ausschließlich symbolischen Charakter – daraus ergibt sich schon die Begrenzung auf gewaltfreie Mittel des Protests.“ (Habermas 2015: 35)
Bei der Reflexion des Begriffs des zivilen Ungehorsams wird deutlich, dieser bezeichnet nicht nur politische Kämpfe, sondern kann selbst als umkämpfter Begriff betrachtet werden, der eher als Politikum denn klarer definitorischer Abgrenzung dient und deshalb gibt es auch nicht die eine Definition des Begriffs (vgl. Pabst 2012). So findet sich die Bezeichnung nicht nur bei XR, sondern auch bei verschiedensten anderen sozialen Bewegungen und Gruppierungen. Berühmteste Beispiele für Massenproteste des zivilen Ungehorsams sind hierbei wohl die Bewegungen um Mahatma Ghandi und Martin Luther King, in dessen Licht sich auch XR gerne sehen würde. Berglund und Schmidt erklären den zivilen Ungehorsam von XR als Aktionen, die Gesetze und Regeln brechen und eine friedliche Konfrontation mit der Polizei und dem expliziten Ziel der Verhaftung suchen. Darüber hinaus müssen die Aktionen zivil sein, was im Mindestmaß Gewaltfreiheit bedeutet (vgl. Berglund/Schmidt 2020: 27).
Auf die einfache Frage, warum man sich festnehmen lasse, führt die Aktivistin Griffiths im Extinction Rebellion Handbuch aus:
„Einer der wirkungsvollsten Wege, Veränderungen herbeizuführen, ist die Bereitschaft von Menschen, sich wegen gewaltfreien zivilen Ungehorsams festnehmen zulassen. In der Tradition der Suffragetten […] und der Bürgerrechtsbewegung bedeutet das Herausfordern einer Festnahme, vom unbeteiligten Zuschauer zum „Aufständischen“ zu werden: für etwas unendlich viel Größeres und Wichtigeres als die eigene Person aufzustehen.“ (Griffiths 2019: 114)
Darüber hinaus beschreibt Hallam, dass der Kern der gewaltfreien Störaktionen von XR sei, das Gesetz zu brechen und dabei ein öffentliches Drama zu schaffen (vgl. Hallam 2019). Durch die konsequente Gewaltfreiheit gegenüber einschreitenden PVB wird dabei ein Underdog-Narrativ und somit das Bild des Tapferen geschaffen, der sich gegen das Böse stellt (vgl. Hallam 2019: 120). Dieses Narrativ kann aber nur bei konsequenter Gewaltlosigkeit aufrechterhalten werden. Insofern richtet XR seinen Fokus in Aktionstrainings und Handlungsleitfäden auf gewaltfreie Disziplin (vgl. ebd.: 121). Gewaltbereite oder gewaltsuchende Gruppen/Personen werden aus diesem Grund bei XR ausgeschlossen. Hier zeigt sich bereits ein Dilemma, welches der Polizei gegenübersteht. Trifft diese im Rahmen von Versammlungslagen auf gewaltbereite, vermummte und konfliktsuchenden Klientel, ist das Einschreiten gegen diese Gruppen für den Außenstehenden nachvollziehbar. So führten beispielsweise die Ausschreitungen rund um den G20 Gipfel in Hamburg zu Solidaritätsbekundungen für die Polizei und Empörungen in Bezug auf die Demonstrantinnen und Demonstranten. Dies lag daran, dass sich der Großteil der medialen Berichterstattung auf den Teil der Protestklientel richtete, die besonders aggressiv auftraten und randalierten. Insofern gab es hier klare Freund-Feind-Konstellationen. XR tritt während ihrer Aktionen betont zivil und friedlich auf. Hier ist es, im Vergleich zur oben beschrieben Konstellation, für außenstehende weniger nachvollziehbar, wenn die Polizei beispielsweise eine Gruppe singender und tanzender XR Aktivisten von der Straße trägt, die zuvor einen Verkehrsknotenpunkt blockiert hatten. In diesem Fall wirkt wohl eher die Polizei als aggressiv auftretende Staatsmacht und es bleibt fraglich, inwiefern dabei das Selbstbild einer volksnahen Bürgerpolizei aufrechterhalten werden kann (vgl. Behr 2006: 42).
2.3 Aktionsformen
Wenngleich ein Fokus von XR auf polizeilichen Festnahmen liegt, um ein besonderes mediales Echo zu erzeugen, ist es nur ein ausgewählter Teil der Bewegung, die an derartigen Aktionen partizipieren. In der Gesamtbetrachtung führen nur ein verschwindend geringer Teil der Aktionen von XR zu Gewahrsam- resp. Festnahmen. Zielsetzung aller Aktionen ist es, mit geringem Personen- und Materialeinsatz die folgenden drei Aspekte zu erfüllen. XR beschreibt diese wie folgt:
„1. Störung durch massiven zivilen Ungehorsam, um unsere Forderungen durchzusetzen 2. Reichweite, um der Öffentlichkeit die Wahrheit zu sagen und die Menschen bei Protesten oder durch die Medien zusammen zu bringen 3. Visionen, um durch wunderbar kreative Gemeinschaftsaktionen eine Zukunft spürbar zu machen, wie wir sie uns vorstellen“ (Jacout/Boardman 2019: 140).
Die Bewegung macht auch hier Vorgaben und stellt ihren Unterstützerinnen und Unterstützern einen Leitfaden zur Verfügung, der rechtliche Konsequenzen aufzeigt und sogar Verhaltenshinweise gegenüber der Polizei vorschlägt (vgl. XR Deutschland/Legal Team Berlin 2020). Die Aktionsformen der Bewegung ähneln sich global betrachtet und können in ihrer Intensität und Devianz progressiv gesteigert werden. Neben sog. „Talks“, bei denen Passanten auf die aktuelle Klimasituationen angesprochen werden, sind eine der häufigsten Aktionen von XR die sog. „Die-Ins“. Hierbei legen sich Personen spontan auf den Boden und stellen sich tot. Damit soll ein Bewusstsein für das Aussterben auf dem Planeten geschaffen werden, wobei die Umrisse der Körper häufig mit Kreide umrandet werden, um die Assoziation eines Tatortes zu erwecken. In ähnlicher Weise wird der Planet oder die Menschheit bei „Trauermärschen“ symbolisch zu Grabe getragen (vgl. Manemann 2019b: 23). Zur Erhöhung der medialen Reichweite und Akquirierung neuer Mitglieder werden darüber hinaus Informationsveranstaltungen, Vorträge und Buchvorlesungen organisiert.
Die eben genannten Aktionsformen führen nur in seltenen Fällen zu polizeilichen Repressionen. Denkbar wären hier Verstöße gegen das Versammlungsgesetz bei nicht angemeldeten „Die-Ins“ und „Trauermärschen“.
Eine radikalere Agitation findet sich dann beim Anbringen von Transparenten, Stickern und Graffiti bis hin zum Verschütten von Kunstblut im öffentlichen Raum, wobei die Tatbestände des Hausfriedensbruchs oder der Sachbeschädigung erfüllt werden könnten. Auf diese Weise nutzten beispielsweise Aktivistinnen und Aktivisten von XR am 03. Oktober 2019 ein ausrangiertes Feuerwehrfahrzeug, um das Finanzministerium in London mit Kunstblut zu bespritzen (vgl. Extinction Rebellion UK 2019). Eine weitere anschauliche Protestform ist auch das sog. „Adbusting“, bei dem der Inhalt eines Werbe- und/oder Wahlplakates so verändert wird, dass neue politische Inhalte entstehen (vgl. XR Deutschland/Legal Team Berlin 2020: 32).
Aktionen von XR, die häufig ein polizeiliches Einschreiten notwendig werden lassen, sind sog. „Swarmings“ und „Lock-ons“ bzw. „Glue-ons“. Beim „Swarming“ begeben sich die Aktivistinnen und Aktivisten an neuralgische Verkehrsknotenpunkte und blockieren diese. Hierdurch kommt es häufig zu einer Verdichtung resp. Stauung des Fahrzeugverkehrs. Im weiteren Verlauf werden Transparente präsentiert und wartenden Verkehrsteilnehmern werden Informationsbroschüren sowie kleine Snacks überreicht. Zur Unterstreichung des zivilen und friedlichen Charakters werden auf der Straße dann Yoga-Übungen oder Spiele durchgeführt. Eine polizeiliche Räumung wir hier ggf. notwendig, um größere Verkehrsbeeinträchtigungen zu verhindern. Die Auflösung solcher „Swarmings“, denen durch die o.g. Straßenspiele nahezu Volksfestcharakter attestiert werden kann, würde demnach eine übertriebene agierende Staatsgewalt implizieren. Wenngleich Swarmingaktionen bei Nichtanmeldung eine größere Störung verursachen, empfiehlt jedoch die Bewegung selbst ihren Mitgliedern diese anzumelden, um unter dem Schutz des Versammlungsgesetzes zu stehen und etwaigen Nötigungsvorwürfen zuvorzukommen (vgl. ebd.: 26).
Bei „Glue-on“ und „Lock-on“ kleben, bzw. ketten sich Aktivistinnen oder Aktivisten an Gebäude, Bäume oder Straße. Dadurch wird eine Räumung eines Platzes, Straße oder Gebäudes erschwert. Polizeikräfte werden zum Handeln gezwungen und eine zumindest kurzzeitige Gewahrsamnahme scheint unumgänglich. Griffiths beschreibt diese Aktionsform auch als „[…]ein Werben um Festnahme“ (Griffiths 2019: 113).
Alle Aktionen haben gemeinsam, dass sie durch die Bewegung in verschiedensten sozialen Medien dokumentiert und ausführlich dargestellt werden. Dabei wird scheinbar auch das Ziel verfolgt, durch Polizeipräsenz die mediale Reichweite bzw. die Zahl der Medienvertreter zu steigern.
Wenngleich die Darstellungen der Aktionsformen von XR an dieser Stelle holzschnittartig sind, zeigt sich, dass für Unterstützerinnen und Unterstützer der Bewegung die Beteiligung in verschiedensten Protestformen möglich ist. Dabei reichen die Aktionen von bloßen Informationsweitergaben zur klaren Normüberschreitung. Die Bewegung ist sich dabei den verschiedenen Einschreitschwellen der Polizei sowie der Möglichkeit der Erfüllung verschiedener Straftatbestände bewusst, nimmt diese in Kauf oder forciert sie gar. Dies spiegelt sich in den Leitfäden und Handbüchern der Bewegung wider. Polizeiliches Handeln wird im Vorfeld bedacht und zum Teil bewusst provoziert, um eine erhöhte mediale Reichweite zu erzielen und den Status der „Rebellion“ zu unterstreichen. Jedoch zeigt sich bei allen Aktionen auch das Selbstverständnis der Bewegung als gewaltfreie Rebellion. Im Gegensatz zu anderen Klimabewegungen wird hier nicht aktiv gegen die Polizei vorgegangen und es findet eine Abgrenzung zu extremistischen und gewaltbereiten Personen statt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz attestiert der Bewegung „Ende Gelände“, die häufig im gleichem Zusammenhang mit XR genannt wird, dass diese sich verstärkter Einflussnahme von Linksextremisten ausgesetzt sieht und darüber hinaus Gewalt als Agitationsmittel – nicht – ablehne (vgl. Bundesamt für Verfassungsschutz 2018). Im Kontext der Klimabewegungen zeichnet sich XR somit dadurch aus, dass sie sich nicht von extremistischen, gewaltbereiten Gruppierungen oder politischen Positionen unterwandern lassen, aber im Vergleich zu weniger radikaleren Bewegungen wie FFF eher bereit sind Normenverstöße zu begehen.
3 Die Rolle der Polizei im Spannungsfeld der Klimaproteste
PVB fungieren als Vertreter des Staates und setzen auch dessen Exekutivgewalt durch.
„Nicht von ungefähr wird die Polizei immer wieder als „die politischste aller Verwaltungen“ bezeichnet. Schon aufgrund ihrer organisatorischen Zuordnung zu den Innenressorts des Bundes und der Länder ist sie besonders eng mit dem politischen Feld verwoben. Zudem wird sie regelmäßig in Bereichen aktiv, die durch gesellschaftlich relevante Konflikte und Spannungen geprägt sind und in denen ihre Rolle auch darin besteht, politische Leitlinien der jeweils Regierenden durchzusetzen“ (Heidemann 2020: 96).
Das Echo, welches ihr aufgrund eigener Maßnahmen bzw. der Durchsetzung o.g. politischer Leitlinien entgegenschallt, ist für sie oft schwer zu ertragen. Aus diesem Grund sehen Polizeigewerkschaften die Polizei häufig als „Fußabtreter einer der Politik überdrüssig gewordenen Gesellschaft“ (vgl. Gewerkschaft der Polizei 2020). Das Echauffieren der Polizei und ihrer Gewerkschaften richtet sich dabei bekanntermaßen meist gegen das Verhalten des polizeilichen Gegenübers, eigene polizeiliche Maßnahmen werden nur selten reflektiert, noch seltener kritisiert. Man könnte überspitzt unterstellen, die Polizei ist bereit für den Staat auszuteilen, aber nicht einzustecken.
Besonders im Rahmen von Klimaprotesten gelangt die Polizei in ein Spannungsfeld. Sie agiert bei Klimaprotesten als Stellvertreter eines Staates, zu dessen Umweltpolitik sie nur marginale Berührungspunkte hat. Dennoch haben Klimaproteste für die Polizei eine besondere Bedeutung und gipfelten in der Vergangenheit häufig in gewalttätigen Auseinandersetzungen. In den 1980er Jahren waren es die Umweltproteste um den Bau der Frankfurter Startbahn West oder des Kernkraftwerkes bei Brokdorf, die zu neuen Einsatzkonzepten innerhalb der Polizei, wie beispielsweise der Einführung der BFE (vgl. Scholzen 2014) und mit dem Brokdorf-Beschluss auch zu einer Grundsatzentscheidung des BGH im Versammlungsrecht führten. In den 1990er und 2000er führten die Atommülltransporte (Castor-Transporte) die Polizeien des Bundes und der Länder an ihre Belastungsgrenzen. In jüngerer Vergangenheit waren es die Proteste um den Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs, (Stuttgart 21) aber auch die Proteste gegen die G-7 bzw. G-20 Gipfel, die – nicht nur – aber auch im Zeichen des Klimaschutzes standen.
Diese exemplarische Aufzählung macht deutlich, dass obwohl die Polizei nur geringfügige Berührungspunkte zum Klimaschutz hat, im Gegenzug die Klimaschutzproteste der Vergangenheit einen enormen Einfluss auf die Polizei hatten. In besonderer Erinnerung blieben die eben genannten Proteste vor allem, weil sie ausnahmslos gewalttätige Auseinandersetzungen nach sich zogen und zum Teil neue taktische Konzepte der Polizei hervorriefen. Im Jahr 2018 sah sich die Polizei dann mit FFF und XR friedlichen Massenprotesten und einem scheinbaren Paradigmenwechsel in den Klimaprotestbewegungen gegenüber. Womit sich die Frage stellt, ob diese ebenso geeignet sind Veränderungen in der deutschen Polizei hervorzurufen.
Im Folgenden sollen die kulturellen Bezugssysteme Cop Culture und Police Culture im Sinne von Behr dargestellt und anschließend, die Problemfelder aufgezeigt werden, in welchem sich diese kulturellen Bezugssysteme bei Konfrontation mit Aktionen des zivilen Ungehorsams im Sinne von XR, befinden.
3.1 Police Culture versus Cop Culture
Behr (2013) unterscheidet in seiner organisationssoziologischen Betrachtung in Polizistenkultur (Police Culture) und Polizeikultur (Cop Culture). So schreibt er:
„Polizistenkultur ist in das Innere der Organisation gerichtet, Polizeikultur nach außen. Beide stehen in einem symbiotischen und arbeitsteiligen Verhältnis zueinander und beide ermöglichen erst den Vollzug der eigentlich „paradoxen“ Aufgabe der Polizei, nämlich den gesellschaftlichen Frieden und den Schutz von Menschenrechten notfalls mit Gewalt durchzusetzen bzw. wiederherzustellen“ (Behr 2013: 81).
Polizeikultur in diesem Sinne kann als eine offizielle Vorgabe von Werten und Leitlinien betrachtet werden, die sich im Rahmen normativer und politischer Korrektheit bewegt. Polizeikultur im Sinne von Behr richtet sich nach außen und findet auf Institutionsebene statt. Insofern ist man bestrebt, sich als bürgernahe, tolerante, gesprächsbereite und transparente Polizei der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die hierzu erstellten Leitlinien werden nach außen dargestellt und nach innen meist in der Form eines Top-down-Prozesses den PVB vorgegeben. Diese Managementmethode gibt allerdings keinen konkreten Handlungsrahmen für die alltägliche Arbeit vor, sondern stellt eher einen gewünschten Zustand der Organisation aus Führungsperspektive dar (vgl. Heidemann 2020: 107). Demnach stellt sich die Polizei auch in Bezug auf Versammlungslagen nach außen tolerant und versammlungsfreundlich dar, gibt den PVB vor Ort aber keine klaren Vorgaben, wann beispielsweise gegen Demonstranten vorzugehen ist, die eine Straße blockieren. Exemplarisch aufgeführt seien hier die Einsätze rund um die „Querdenker-Proteste“. Hier wurde der Eindruck erweckt, dass die Polizei erst dann entschlossen gegen die Auflagenverstöße vorging, als medial bekannt wurde, dass die Versammlungen scheinbar von Rechtsextremen unterwandert werden (vgl. Stern 2020). Erst nach dieser Erkenntnis schienen klare Handlungsstrategien für die Polizei vorzuliegen, da nun im Sinne einer „political correctness“ gehandelte bzw. die Klientel klar kategorisiert werden konnte. Gleiche Kategorisierungsschwierigkeiten aufgrund mangelnder Erfahrung, könnte es auch in Bezug auf XR geben, da es sich auch hier um eine junge Bewegung handelt. PVB, die ihren täglichen Dienst „auf der Straße“ verrichten, erleben, dass der polizeiliche Alltag nicht immer mit den Vorgaben und Werten aus den Hochglanzbroschüren und Leitbildern der Polizeikultur zu bewältigen sind. Deshalb werden die Vorgaben der Führungsebene vernachlässigt oder zumindest durch eigene Handlungsmuster, Wertemaßstäbe sowie Verhaltensstrategien ergänzt, um bestimmte Einsatzsituationen zu bewältigen (vgl. Behr 2013: 81). Dieses informelle Wertesystem beschreibt Behr als Cop Culture. Aktuelle Untersuchungen zeigen:
„Polizeiliches Handeln basiert zu einem wesentlichen Teil auf Erfahrungswissen der handelnden Beamt*innen. In diesem Wissen vermischen sich eigene berufliche Erfahrungen mit Wissensbeständen aus anderen Quellen. Dazu zählen unter anderem Erfahrungen von Kolleg*innen, Berichte über Erfahrungen Dritter sowie eigene Einstellungen“ (Abdul-Rahman et al. 2020: 33).
Cop Culture gibt also auch Handlungsstrategien vor, die sich aus vermeintlichen Erfahrungswissen von dienstälteren Polizeibeamten speist und somit unreflektiert zum Gruppenkonsens werden kann. Der Polizei wird nach wie vor eine hegemoniale Männlichkeit attestiert wird (vgl. Connell 2015: 128). Dieses Männlichkeitsbild findet ihre wohl stärkste Ausprägung im Männlichkeitsmodell, das von Behr für die Polizei als „Krieger“ beschrieben wird (vgl. Behr 2017: 543). Diese Krieger haben wie alle PVB die Vorstellung, die gute Ordnung zu verteidigen. Um diesen „Kampf“ zu bestreiten, bedient sich der Krieger einer binären Freund-Feind-Dogmatik und ist bereit Gewalt einzusetzen. Ein Mittel, welches für Träger des staatlichen Gewaltmonopols selbstverständlich erscheinen sollte, sich in den Leitbildern der Polizeikultur aber nicht wiederfindet. „An ‚Normalbürger_innen‘ hat die Krieger-Männlichkeit wenig Interesse, sie bevorzugt Einsätze, bei denen die Fronten klar sind. Diese Haltung führt zu einer Polarisierung in klare Freund-Feind-Konstellationen.“ (Behr 2017: 545). Wagner beschreibt in Übereinstimmung mit Behr, dass wenngleich sich der Idealtypus des Kriegers eher bei den geschlossenen spezialisierten Einheiten wie BFE und SEK findet, das Bedürfnis nach außergewöhnlichen Ereignissen in der Motivation aller Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu finden ist (vgl. Wagener 2012: 145). Dieses Erlebnisbedürfnis dürfte auch gerade jungen PVB in den Bereitschaftspolizeien des Bundes und der Länder unterstellt werden, welche in erster Linie Kontakt zu Protestierenden in Rahmen von Versammlungslagen haben. Dergestalt schreibt Behr: „Der junge Polizist ist in erster Linie Novize, und dort entweder Krieger oder unauffälliger Aufsteiger“ (Behr 2006: 43). Gerade diese jungen Polizisten scheinen sich, entsprechend o.g. Ausführungen, nach Einsatzsituationen zu sehnen, in denen sie sich beweisen können. Wie bereits der letzte Abschnitt dargestellt hat, sind das nicht etwa Einsätze, die nach der Façon der Polizeikultur durch tolerante und kommunikative Überzeugungsarbeit bewältigt wurden, sondern gewalttätige Auseinandersetzung, in welcher der Krieger die Möglichkeit hatte, sich altruistisch für die „gute Ordnung“ in den Kampf zu werfen. Dieser hedonistische Heroismus des Kriegers hat im postheroistischen Führungsverständnis, der auf Zivilität betonten modernen Police Culture, jedoch keinen Platz (vgl. Barthel/Heidemann 2017b: 3), zumindest wird dieser nicht nach außen kommuniziert.
Deshalb scheinen sich in der Theorie von Behr die nach außen gerichteten Leitbildern der Police Culture und die nach inneren gerichteten Handlungsmuster der Cop Culture gegenüber zu stehen. Allerdings ergänzt Behr: „Leitbilder können publiziert werden, leiten aber nicht das polizeiliche Handeln an. Handlungsmuster dagegen leiten das polizeiliche Handeln an, können aber nicht publiziert werden“ (Behr 2013: 85). Hier zeigt sich die, eingangs erwähnte, paradoxe Symbiose. Die Police Culture braucht eine handlungsfähige Polizei, die bereit ist, den unansehnlichen Teil der polizeilichen Tätigkeit durchzuführen, über den nicht berichtet wird. Die Cop Culture benötigt eine Führung, welche den Eindruck einer immer toleranten und im Rahmen der rechtlichen Vorgaben agierenden Polizei nach außen wahrt.
3.2 Die Polizei im Umgang mit Extinction Rebellion
Im Folgenden wird das Ethos von XR den kulturellen Bezugssystemen der Polizei, namentlich der Cop Culture und Police Culture gegenübergestellt (s. Anlage 2). XR stellt mit seinem Franchise-Modell und den daraus resultierenden 96 Ortsgruppen auf nationaler Ebene und 1139 Ortsgruppen auf internationaler Ebene eine bedeutende Bewegung dar, mit der sich Polizeien weltweit konfrontiert sehen (vgl. Extinction Rebellion 2021). Deshalb erscheint es paradox, dass sich nur wenige Quellen finden, in denen die deutsche Sicherheitsbehörden öffentlich XR thematisiert, richtet sich die Bewegung doch offen gegen die bestehende Regierung, propagiert zivilen Ungehorsam und strebt sogar einen Systemwandel an. Lediglich Antworten auf kleine Anfragen politischer Parteien deuten darauf hin, dass sich die Polizei und der Verfassungsschutz sehr wohl mit der Bewegung auseinandersetzen. Schließlich weiß man um die Ausmaße der Klimaproteste der Vergangenheit und die Überschneidungspunkte von Umweltprotesten und die Agitationsfeldern des Linksextremismus. Bislang werden XR, in einer Antwort auf eine kleine Anfrage, keine verfassungsfeindlichen Bestrebungen und nur vereinzelte Verbindung zum Linksextremismus attestiert (vgl. Bundestag 2019). Hier zeigt sich, dass der Verfassungsschutz und/oder der polizeiliche Staatsschutz, zwar – offiziell – nur wenige Maßnahmen in Bezug auf XR treffen, diese Bewegung aber sehr wohl wahrgenommen und vermutlich inoffiziell auch thematisiert/beobachtet wird. Ansonsten könnten obige Aussagen im Rahmen kleiner Anfragen wohl nicht gemacht werden.
Wie diese Arbeit bereits gezeigt hat, sind es in erster Linie Aktionen mit Versammlungscharakter, in welchen Akteurinnen und Akteure von XR auf die Polizei treffen. Gerade im Zusammenhang von Klimaprotesten tritt diese nicht nur als Organ der inneren Sicherheit auf, vielmehr repräsentiert sie in Versammlungslagen den Staat bzw. die politische Führung als solches. So schreibt Bauer: „Im Protestzusammenhang treffen Akteur*innen der zivilen und der politischen Gesellschaft aufeinander. Als Akteurin der politischen Gesellschaft tritt dabei vor allem die Polizei in Erscheinung“ (Bauer 2020: 6). Bei diesen Versammlungslagen werden häufig junge PVB der Bereitschaftspolizei eingesetzt, die dem Idealtypus des Kriegers im Sinne der Theorie von Behr entsprechen oder entsprechen wollen. Hier stehen, das von Wagner beschriebene Erlebnisbedürfnis und die Normendurchsetzung im Vordergrund (vgl. Wagener 2012: 145). Aktivistinnen und Aktivisten begegnen PVB allerdings keinesfalls auf Augenhöhe. Behr (2017) dazu: „Im Zentrum der Cop Culture ist der Bürger nicht Kunde, sondern Herrschaftsunterworfener. Und der Polizist ist nicht Dienstleister, sondern Vertreter der Staatsmacht“ (Behr 2017: 543). In diesem Kontext zeichnet sich bereits ein potenzieller Konflikt ab, da XR mit seinen Aktionen offen gegen das herrschende System richtet und ihm mit zivilem Ungehorsam entgegentritt. Bei oberflächlicher Betrachtung könnte als Rezipient jenes zivilen Ungehorsams an dieser Stelle die Polizei ausgemacht werden. Ein Protestverhalten, dass sich vor Ort gegen die Polizei richtet, ist dieser nicht neu und könnte eher als „business as usual“ bezeichnet werden. Allerdings beschreibt Behr bereits 2006:
„Was das Demonstrationsgeschehen anbetrifft, veränderte sich auch das Protestverhalten sowie die Einstellungen zum zivilen Ungehorsam in der Bevölkerung und damit die ‚Träger des Protests‘. Aktionen der Protestierenden wurden unkonventioneller, oft auch disziplinierter, manchmal aber auch spontaner, unlogischer, und ohne Verantwortlichen. Sie richteten sich nicht mehr in erster Linie gegen die Polizisten vor Ort als Repräsentanten des Staatsapparats“ (Behr 2006: 29).
Bei den Swarmings, Lock-on‘s bzw. Glue-on’s richten sich die Aktivistinnen und Aktivisten von XR regelmäßig gegen die Anordnungen und Weisungen der Polizei. Diese Form der Insubordination könnte als Respektlosigkeit aufgefasst werden, die PVB immer wieder im Alltag beklagen und die auch bei anderen Bewegungen zu verzeichnen sind (vgl. Behr 2013: 89). Savelsberg weist zudem darauf hin, dass PVB eher geneigt sind gegen Personen einzuschreiten, bzw. Anzeige zu erstatten, die der Polizei ungehorsam gegenübertreten (vgl. Savelsberg 1994: 27). Wenngleich Extinction Rebellion sich aber gegen die Politik des Staates richtet, entlädt sie ihre Wut eben nicht auf die Polizei als Vertreter des Staates. In den Leitfäden der Bewegung zur Durchführung von Aktionen steht geschrieben:
„Es empfiehlt sich immer höflich und freundlich gegenüber anderen Menschen zu sein, das beinhaltet auch Polizeibeamt*innen. Es ist DNA und Kultur von XR, die Herzen aller zu gewinnen und mit Respekt und Herzlichkeit offen allen Menschen gegenüber zu sein – das schließt ausdrücklich auch Polizei, Behördenmitarbeiter*innen und Beschäftigte in kritisierten Institutionen ein.“ (XR Deutschland/Legal Team Berlin 2020).
Der Polizei soll nicht nur freundlich und respektvoll gegenüber getreten werden, im Handbuch von XR finden sich auch Beiträge, in denen beschrieben wird, dass man Wertschätzung für die Arbeit der Polizei empfindet (vgl. Ebenhöh 2019: 137) und sie sogar bei der Versorgungsplanung mit Lebensmitteln berücksichtigen sollte (vgl. Haque 2019: 143). Berglund und Schmidt beschreiben, dass XR teilweise Sprechchöre mit „We love the police“ anstoßen und Slogans wie ACAB ablehnen, wofür sie insbesondere von anarchistischen Gruppierungen stark kritisiert werden (vgl. Berglund/Schmidt 2020: 14 f.). Allein derartige Ausrufe sind für Umweltbewegungen eher unüblich und finden sich noch seltener bei linksgerichteten politischen Bewegungen. Unklar bleibt, ob diese Mentalität von XR tatsächlich intrinsisch verankert ist oder sich ausschließlich auf das Modell des zivilen Ungehorsams im Sinne von Chenoweth und Stephan bezieht, dem die Bewegung folgt (vgl. ebd.: 15).
Fakt ist jedoch, XR schafft mit seinen Aktionen des gewaltfreien zivilen Ungehorsams gerade keine binären Freund-Feind-Konstellationen, nach denen sich der Krieger der Cop Culture sehnt. Auch die strikte Gewaltlosigkeit der Bewegung führt dazu, dass das heroistische Erlebnisbedürfnis des Kriegers nicht gestillt wird. Hier gibt es kein klares aggressives Feindbild, dem er sich altruistisch entgegenwerfen kann. Allerdings dürfte es aber auch gerade jüngeren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten schwerfallen, mit diesen Formen des Ungehorsams zurechtzukommen. Es zeigt sich, dass gerade jüngere PVB in Widerstandshandlungen verwickelt werden. 2019 richteten sich 47,4 % aller Gewaltdelikte gegen PVB der Altersgruppe der 25- bis unter 35-Jährigen (Bundeskriminalamt 2020: 61).
Die Cop Culture wird XR also mit Desinteresse aufgrund mangelnder Erlebnismöglichkeit, oder aber mit übertriebener Härte, zur Beendigung des Insubordinationsverhaltens und der Wiederherstellung der oben beschriebenen Herrschaftsverhältnisse, begegnen. Vielleicht führt das Novum, der demonstrationsseitig polizeibefürwortenden Einstellung und das, objektiv betrachtete, gute Ziel der Bewegung, aber auch dazu, dass die Cop Culture gerade nicht gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten vorgeht und sie eher duldet/gewähren lässt. Denn interessanterweise gibt es einige Überschneidungen der Vorstellungen des Kriegers mit dem Selbstverständnis der Aktivistinnen und Aktivisten von XR. Beide sehen sich als Verteidiger eines guten Zweckes und streben im Rahmen dieses Kampfes nach der Rolle eines Helden. Frank schreibt zu XR: “Im Kern erinnert diese Ideologie der Dringlichkeit an den Manichäismus, eine spätantike Lehre vom Kampf des Lichts gegen die Dunkelheit“ (Frank 2019).
Auch die Polizeikultur teilt Gemeinsamkeiten mit XR. Demnach finden sich die Bemühung zur Begründung eines Corporate Design, Coporate Identity bzw. der konkreten Vorgabe von Leitbildern auch bei der Police Culture, allerdings ergeben sich hier andere Herausforderungen. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, führt insbesondere die strikte Gewaltlosigkeit zu einem ambivalenten Erschwernis für die Polizei. Berglund und Schmidt schreiben zur Besetzung der fünf Brücken am 17.11.2018 in London: „Most importantly perhaps, it was evidently nonviolent an peaceful, which made the policing of it all more difficult“ (Berglund/Schmidt 2020: 2). Es wurden hier klare Rechtsverstöße begangen, aber durch den friedlichen Charakter der Versammlung fiel es der Polizei schwer gegen die Demonstranten vorzugehen. Der Definition Habermans entsprechend werden Aktionen des zivilen Ungehorsams im Vorhinein den Ordnungsbehörden bekanntgegeben (vgl. Habermas 2015: 35). Dies macht sie für die Polizei zwar kalkulierbar, bietet für XR jedoch den Vorteil, unter dem Schutz des Versammlungsgesetzes zu stehen und setzt die Polizei unter Handlungszwang auf die angekündigten Demonstrationen und damit einhergehenden Normverstöße zu reagieren. Was nicht nur auf das Legalitätsprinzip sondern auch auf die gesellschaftliche Erwartung zurückzuführen ist, dass die Polizei Normenverstöße ahndet. In den Bekanntgaben resp. Anmeldungen der Versammlungen/Aktionen finden sich zwar keine konkreten Ankündigungen zur Begehung von Straftaten, allerdings geht die Bewegung im Rahmen der Darstellung eigener Aktionen keineswegs klandestin vor. Somit dürfte der Polizei nach kurzfristigen Vorfeldrecherchen bewusst sein, dass bei den Aktionsformen des zivilen Ungehorsams auch Normüberschreitungen der Aktivistinnen und Aktivisten zu erwarten sein könnten. Wie anhand Berglund Schmidt bereits ausgeführt wurde, macht es gerade die Gewaltlosigkeit der Aktionen von XR für die Polizei schwer, klare Handlungsstrategien zu entwickeln und gleichzeitig das Narrativ der freundlichen und transparenten Bürgerpolizei beim Vorgehen gegen gewaltfreie Demonstranten aufrechtzuerhalten. Andererseits könnte auch das nachsichtige Vorgehen oder auch die Duldung der Verstöße dem Außenbild der Polizei, gerade bei konservativen Teilen der Bevölkerung, schaden.
Wie kann und sollte also die Polizei auf den zivilen Ungehorsam von XR reagieren? In erster Linie mit Resilienz und auf Augenhöhe mit den Demonstrantinnen und Demonstranten. Tatsächlich scheint die deutsche Polizei hierbei auch auf dem richtigen Weg zu sein. Wie die Presseberichte zur weltweiten Aktionswoche von XR im Oktober 2019 zeigten, reagierte die Berliner Polizei, im Vergleich zu anderen Ländern, auffallend gelassen auf die, im Vorhinein angemeldeten, Blockaden von wichtigen Verkehrsknotenpunkten der Hauptstadt. Erst nach mehrmaliger Ansprache und Verhandlungen mit den Versammlungsleitern kam es zu Räumungen und vereinzelten Festnahmen von Demonstranten. Dieses zurückhaltende Vorgehen scheint mittlerweile bundesweiter Konsens im polizeilichen Einsatzdogma zu sein und spiegelt die Vorgaben der hiesigen Police Culture wider. In anderen Ländern ging die Polizei wesentlich repressiver gegen XR vor. Demnach kam es in London im gleichen Zeitraum zu Festnahmen von 217 Demonstranten und in Paris zu gewaltsamen Räumungen und dabei sogar zum großflächigen Einsatz von Reizgas (vgl. Fuchs 2019). Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Frage aufgeworfen, ob die modernen Klimaproteste von XR und FFF den gleichen Einfluss auf die deutsche Polizei haben könnten, wie seinerzeit „Brokdorf“ oder die Proteste um die „Startbahn West“. Dies scheint nicht oder nur geringfügig der Fall zu sein. Allerdings muss dabei betrachtet werden, dass sich nicht nur die Klimaproteste verändert haben, sondern auch die Polizei. Dementsprechend fand seit den 80er Jahren eine Akademisierung des Polizeiberufes in Deutschland statt und führte zu einer Reflexion des Berufsethos (vgl. Barthel/Heidemann 2017a: 16). Die heutige Polizei tritt sehr wohl toleranter und versammlungsbefürwortender auf. Dabei ist auch anzunehmen, dass viele der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vielleicht sogar die Ziele der Bewegung teilen oder zumindest befürworten, denn schließlich ist der Klimawandel ein globales Problem, dass früher oder später alle betreffen wird. Tatsächlich scheint es, dass XR ist in ambivalenter Weise sogar eher auf die Polizei angewiesen. Einerseits wirbt die Bewegung um Festnahmen, um das Narrativ der Rebellion aufrecht zu erhalten und andererseits kooperieren sie mit den Sicherheitsbehörden, in dem Wissen, dass für einen gesellschaftlichen Wandel Menschen aller Bevölkerungsteile notwendig sind. Darüber hinaus verhilft die Polizei XR auch zu einer erhöhten medialen Reichweite. Denn größere Polizeieinsätze bedeuten vermehrte Medienberichterstattung und wie Raschke bereits 1988 feststellte: „Eine Bewegung, über die nicht berichtet wird, findet nicht statt“ (Raschke 1988: 343).
4 Fazit
Der Polizei wird im Rahmen von Großversammlungslagen häufig unterstellt, sie hätte mit den gewaltbereiten Demonstranten mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes. Meuser beschreibt dies als eine Inszenierung aggressiver Männlichkeit im Kampf um Ehre (vgl. Meuser 1999: 52). Wenngleich diese pauschale Aussage nicht per se zutreffend scheint, lassen sich auch beim Vergleich der Polizei mit XR diverse Überschneidungen feststellen. Ferner sehen sich beide als Verfechter einer guten Ordnung, sind erlebnisorientiert und um eine möglichst gute Außendarstellung bemüht. Diese Aussagen lassen sich jedoch auf diverse andere soziale Bewegungen beziehen. Was XR derzeit einzigartig macht, ist ihre strikte Gewaltlosigkeit in Verbindung mit Aktionen des zivilen Ungehorsams, bei der eben – nicht – die Inszenierung einer aggressiven Männlichkeit nach Meuser im Vordergrund steht. Vielmehr scheint es die Erkenntnis zu sein, dass es zum Erreichen der selbstgesetzten großen Ziele auch notwendig ist, die Unterstützung aller Teile der Bevölkerung zu sichern. Dies schließt auch – und gerade – die Polizei ein, weswegen XR einen kooperativen Umgang mit den Sicherheitsbehörden bestreitet, für den sie vielfach durch andere Bewegungen kritisiert werden. Aber „Wenn beide Pole des politischen Spektrums allergisch reagieren, scheint im öffentlichen Raum etwas Neues entstanden zu sein – nicht nur im Netz, sondern neuerdings auch physisch. Auf der Straße“ (Frank 2019).
In der vorliegenden Arbeit konnten Außendarstellungen und das Selbstverständnis von XR dargestellt und betrachtet werden. Die Corprorate Identity und das Franchise Modell, der Bewegung ermöglichen dabei distanzierte Aussagen auf der Makroebene. Allerdings wäre es denkbar, dass es auch Unterschiede zwischen den selbstgegebenen Leitbildern der Bewegung und den Handlungsstrategien der Aktivistinnen und Aktivisten auf der Mikro- und Mesoebene gibt. Insofern wäre an dieser Stelle weiterer Forschungsbedarf vorhanden. Welche Bedeutung hat XR nun für die Polizei? Einerseits scheint durch die Bewegung ein Paradigmenwechseln in Hinsicht auf die Klimaproteste stattgefunden zu haben. Die Polizei wird durch die Aktivistinnen und Aktivisten nicht als Feind betrachtet, strikte Gewaltlosigkeit praktiziert und gewaltbereite Personen gar ausgeschlossen. Andererseits bekennt sich XR zur Aktionsform des zivilen Ungehorsams, bewegt sich häufig an der Grenze zum Normbruch und nimmt diese, zusammen mit etwaig daraus resultierenden Festnahmen, in Kauf oder sucht sogar, um die Rolle der Rebellion zu unterstreichen. Für den Idealtypus eines Männlichkeitsbildes in Form des Krieges, wie Behr ihn für die Cop Culture beschreibt ergibt sich hierbei ein Dilemma. So gibt es zunächst keine klare Freund-Feind-Konstellation mit dem polizeilichen Gegenüber, da diese sich nicht aktiv gegen die Polizei richten. Darüber hinaus kann das Erlebnisbedürfnis, nach dem sich gerade junge PVB sehnen, nicht befriedigt werden und es bleibt fraglich, inwiefern PVB mit diesen zum Teil offensiven Normverstößen umgehen. An dieser Stelle dürften auch Befürchtung eines Verstoßes gegen das Legalitätsprinzip bzw. die Vorstellung, dass auf Straftaten und Ordnungswidrigkeiten auch Reaktionen der Polizei folgen müssen, stehen. Die Gewaltfreiheit der Bewegung beeinflusst allerdings auch die Police Culture, die beim Vorgehen gegen friedliche Demonstranten nur schwerlich das Bild einer toleranten Bürgerpolizei aufrechterhalten kann. Bei Nichtvorgehen drohen hingegen Imageverluste gerade bei konservativen Bevölkerungsteilen.
Wie soll die Polizei auf XR reagieren? Diese Frage muss sich am Ende, wohl jede Polizistin und jeder Polizist selbst stellen. Begegnen diese aber Demonstrantinnen und Demonstranten auf Augenhöhe und akzeptieren die Ziele und Wertevorstellungen des Gegenübers, scheinen alle Parteien zu gewinnen. Extinction Rebellion ist noch weit davon entfernt, den Systemwandel zu erreichen, nach dem sie streben. Allerdings hat die Bewegung, zumindest auf die globale Verteilung betrachtet, mit ihren gewaltfreien Aktionen des zivilen Ungehorsams bereits jetzt ein Novum geschaffen, dem sich die Polizei bisher nicht gegenübersah. Eine weltweite Graswurzelbewegung, die einerseits die Polizei als wichtigen und immanenten Partner innerhalb der Gesellschaft anerkennt, sich dieser aber andererseits nicht unterwirft und Repressalien dabei willentlich in Kauf nimmt.
I Abkürzungsverzeichnis
ACAB all cops are bastards
BFE Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit
BGH Bundesgerichtshof
FFF Fridays for Future
PVB Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte
SEK Spezialeinsatzkommando
StGB Strafgesetzbuch
XR Extinction Rebellion
II Abbildungsverzeichnis
Diese Abbildung wurde aus urheberrechtlichen Gründen von der Redaktion entfernt.
Abbildung 1: Zeigt die Verteilung der Ortsgruppen von XR weltweit.
Quelle: https://rebellion.global/de/groups/#countrie [07.01.2021]
Diese Abbildugn wurde aus urheberrechtlichen Gründen von der Redaktion entfernt.
Abbildung 2: Das sog. „Extinction Symbol“ stellt eine abstrakte Sanduhr innerhalb eines Kreises (Planet) dar. Durch diese Zusammenstellung soll die ablaufende Zeit für die Erde dargestellt werden. Das Logo wurde 2011 durch den unbekannten Londoner Straßenkünstler „Goldfrog ESP“ designt und XR zur Verfügung gestellt.
Quelle:https://extinctionrebellion.nz/wp-content/uploads/2019/08/XR-design-programme-v1.1.pdf
III Anlagenverzeichnis
Diese Abbildung wurde aus urheberrechtlichen Gründen von der Redaktion entfernt.
Anlage 1: Zeigt die Kurzfassung der Prinzipien und Werte von XR Quelle:https://extinctionrebellion.de/wer-wir-sind/prinzipien-und-werte/ [07.01.2021]
Unter gleicher URL kann auch die Langfassung des Dokuments eingesehen werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anlage 2: Gegenüberstellung von individuellen Merkmalen von XR und ihrer
Bedeutung für die Police- und Cop Culture (eigene Darstellung)
Literaturverzeichnis
Abdul-Rahman, Laila/Grau, Hannah E./Singelnstein, Tobias (2020): Rassismus und Diskriminierungserfahrungen im Kontext polizeilicher Gewaltausübung. Zweiter Zwischenbericht zum Forschungsprojekt „Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamt*innen“ (KviAPol). Online: https://kviapol.rub.de/images/pdf/KviAPol_Zweiter_Zwischenbericht.pdf [06.02.2021].
Alten, Saara von (2021): Klimaproteste in Berlin: Extinction Rebellion besetzt Haus der Wirtschaft in Charlottenburg - Berlin - Tagesspiegel. Online: https://www.tagesspiegel.de/berlin/klimaproteste-in-berlin-extinction-rebellion-besetzt-haus-der-wirtschaft-in-charlottenburg/26248450.html [18.02.2021].
Barthel, Christian/Heidemann, Dirk (2017b): Einleitung: Entwicklungsphasen und Perspektiven des polizeilichen Führungsdiskurses. In: Barthel, Christian/Heidemann, Dirk [Hrsg.]: Führung in der Polizei. Springer Fachmedien Wiesbaden: Wiesbaden, S. 3–20.
Barthel, Christian/Heidemann, Dirk [Hrsg.] (2017b): Führung in der Polizei. Springer Fachmedien Wiesbaden: Wiesbaden.
Bauer, Mareike F. (2020): #HambacherForst. Polizeiliche Social-Media-Nutzung im Kontext von Protesten. Online: https://schoolsforfuture.net/m/ext/xr-de/XR-Talk_Auf%20dem%20Weg%20zum%20Aussterben_Script%20V2.0.pdf [10.03.2021].
Behr, Rafael (2006): Polizeikultur. Routinen, Rituale, Reflexionen Bausteine zu einer Theorie der Praxis der Polizei. VS Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden.
Behr, Rafael (2013): Polizei.Kultur.Gewalt. Die Bedeutung von Organisationskultur für den Gewaltdiskurs und die Menschenrechtsfrage in der Polizei. In: .SIAK-Journal – Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis, 1/2013.
Behr, Rafael (2017): Maskulinität in der Polizei: Was Cop Culture mit Männlichkeit zu tun hat. Ein Essay. In: Juridikum, 04/2017, S. 541–551.
Berglund, Oscar/Schmidt, Daniel [Hrsg.] (2020): Extinction Rebellion and Climate Change Activism. Breaking the Law to Change the World. Springer International Publishing; SPRINGER NATURE: Cham.
Bundesamt für Verfassungsschutz (2018): Linksextremisten instrumentalisieren „Klimaschutz“-Proteste. Online: https://www.verfassungsschutz.de/de/aktuelles/schlaglicht/schlaglicht-2018-08-linksextremisten-instrumentalisieren-klimaschutz-proteste [28.02.2021].
Bundeskriminalamt (2020): Bundeslagebild Gewalt gegen Polzeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte 2019. Online: https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/GewaltGegenPVB/gewaltGegenPVB_node.html [10.03.2021].
Bundestag, Deutscher (2019): Antwortder Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Beatrix von Storch,Dr. Bernd Baumann, Dr. Gottfried Curio, weiterer Abgeordneter undder Fraktion der AfD– Drucksache 19/14724 –. „Extinction Rebellion“ und Linksextremismus.
Connell, Raewyn (2015): Der gemachte Mann. Springer Fachmedien Wiesbaden: Wiesbaden.
Deutsches Klima-Konsortium, Deutsche Meteorologische Gesellschaft, Deutscher Wetterdienst, Extremwetterkongress Hamburg, Helmholtz-Klima-Initiative, klimafakten.de (2020): Was wir heute übers Klima wissen. Basisfakten zum Klimawandel, die in der Wissenschaft unumstritten sind. Online: https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/aktuelle_meldungen/200910/dkk_faktensammlung.pdf?__blob=publicationFile&v=2 [02.01.2021].
Ebenhöh, Eva (2019): Gewaltfreiheit: "The Revolution is Love". In: Kaufmann, Sina K./Timmermann, Michael/Botzki, Annemarie [Hrsg.]: Wann wenn nicht wir*. Ein Extinction Rebellion Handbuch. S. Fischer: Frankfurt a. M., S. 135–139.
Extinction Rebellion (2019): XR-design-programme-v1.1. Online: https://extinctionrebellion.nz/wp-content/uploads/2019/08/XR-design-programme-v1.1.pdf [08.01.2021].
Extinction Rebellion (2020): Prinzipien und Werte extinction rebellion. - Langfassung -. Online: https://extinctionrebellion.nz/wp-content/uploads/2019/08/XR-design-programme-v1.1.pdf [02.01.2021].
Extinction Rebellion (2021): Finde deine XR-Gruppe | extinction rebellion. Online: https://rebellion.global/de/groups/#countries [07.01.2021].
Extinction Rebellion UK (2019): Extinction Rebellion spray fake blood on Treasury using fire engine - Extinction Rebellion UK. Online: https://extinctionrebellion.uk/2019/10/03/extinction-rebellion-spray-fake-blood-on-treasury-using-fire-engine/ [17.03.2021].
Frank, Arno (2019): "Extinction Rebellion": So einfach, so ausweglos. Online: https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/extinction-rebellion-analyse-der-klima-rebellen-a-1290401.html [07.01.2021].
Fuchs, Carry-Ann (2019): Extinction Rebellion in Berlin : Friedliche Blockierer und eine unaufgeregte Polizei - Berlin - Tagesspiegel. Online: https://www.tagesspiegel.de/berlin/extinction-rebellion-in-berlin-friedliche-blockierer-und-eine-unaufgeregte-polizei/25095156.html [19.02.2021].
Gewerkschaft der Polizei (2020): Auch Mensch. Online: https://www.auchmensch.de/ [31.01.2021].
Griffiths, J. (2019): Festnahmen herausfordern. In: Kaufmann, Sina K./Timmermann, Michael/Botzki, Annemarie [Hrsg.]: Wann wenn nicht wir*. Ein Extinction Rebellion Handbuch. S. Fischer: Frankfurt a. M., S. 113–117.
Habermas, Jürgen (2015): Ziviler Ungehorsam – Testfall für den demokratischen Rechtsstaat. In: Glotz, Peter [Hrsg.]: Ziviler Ungehorsam im Rechtsstaat. Suhrkamp: Frankfurt am Main.
Hallam, R. (2019): Das Modell des zivilen Widerstandes. In: Kaufmann, Sina K./Timmermann, Michael/Botzki, Annemarie [Hrsg.]: Wann wenn nicht wir*. Ein Extinction Rebellion Handbuch. S. Fischer: Frankfurt a. M., S. 118–121.
Haque, Momo (2019): Nahrung für die Rebellion. In: Kaufmann, Sina K./Timmermann, Michael/Botzki, Annemarie [Hrsg.]: Wann wenn nicht wir*. Ein Extinction Rebellion Handbuch. S. Fischer: Frankfurt a. M., S. 143–145.
Harrabin, Roger (2018): Extinction Rebellion protests block London bridges. Online: https://www.bbc.com/news/uk-england-london-46247339 [03.01.2021].
Heidemann, Dirk (2020): Fehler macht man (am besten) nur einmal! Eine organisationssoziologische Perspektive auf das Lernen aus Fehlern in der Polizei. In: Barthel, Christian [Hrsg.]: Managementmoden in der Verwaltung. Springer Fachmedien Wiesbaden: Wiesbaden, S. 94–115.
Henning von Freeden (2021): XR-Talk_Auf dem Weg zum Aussterben_Script V2.0.
Jacout, Tina/Boardman, Robin (2019): Eine Aktion organisieren. In: Kaufmann, Sina K./Timmermann, Michael/Botzki, Annemarie [Hrsg.]: Wann wenn nicht wir*. Ein Extinction Rebellion Handbuch. S. Fischer: Frankfurt a. M., S. 140–142.
Jager, Janine/Klatt, Thimna/Bliesener, Thomas (2013): NRW-Studie Gewalt gegen PVB - Abschlussbericht.
Kaufmann, Sina K./Timmermann, Michael/Botzki, Annemarie [Hrsg.] (2019): Wann wenn nicht wir*. Ein Extinction Rebellion Handbuch. S. Fischer: Frankfurt a. M.
Manemann, J. (2019): Unser Fokus liegt auf dem Erreichen des Notwendigen: Die 3,5 Prozent der Bevölkerung zu mobilisieren, die nötig sind, um Systemveränderungen zu erreichen. In: Extinction Rebellion Hannover/Hannover, Extinction R. [Hrsg.]: "Hope dies-action begins" // »Hope dies - Action begins«. Stimmen einer neuen Bewegung. Transcript; transcript Verlag: Bielefeld.
Manemann, Jürgen (2019): Wir müssen die Katastrophe fühlen! In: Extinction Rebellion Hannover/Hannover, Extinction R. [Hrsg.]: "Hope dies-action begins" // »Hope dies - Action begins«. Stimmen einer neuen Bewegung. Transcript; transcript Verlag: Bielefeld, S. 19–26.
Meuser, M. (1999): Gewalt, hegemoniale Männlichkeit und „doing masculinity". In: Kriminologisches Journal, 7. Begleitheft, S. 49–65.
Pabst, Andrea (2012): Ziviler Ungehorsam: Annäherung an einen umkämpften Begriff | APuZ. Online: https://www.bpb.de/apuz/138281/ziviler-ungehorsam-ein-umkaempfter-begriff?p=0 [15.02.2021].
Raschke, Joachim (1988): Soziale Bewegungen: Ein historisch- systematischer Grundriss: Frankfurt a. M.
Savelsberg, Hans-W. (1994): Der Prozeß der polizeilichen Entscheidungsfindung. Ein Beitrag zur Soziologie der Polizei. Springer Fachmedien Wiesbaden; Deutscher Universitätsverlag: Wiesbaden.
Scholzen, Reinhard (2014): BFE - Beweisen und Festnehmen. In: veko-online Vernetzte Kompetenz im Sicherheitsmanagement, 04/2014.
Stephan, Maria/Chenoweth, Erica (2008): Why Civil Resistance Works. The Strategic Logic of Nonviolent Conflict. In: Miller, Steven [Hrsg.]: International Security. MIT Press for the Belfer Center for Science and International Affairs: Cambridge.
Stern, Verena (2020): Corona-Krise: Was bedeuten die Proteste gegen staatliche Maßnahmen zur Pandemieeindämmung? | bpb. Online: https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/coronavirus/311575/protest [01.03.2021.963Z].
Thorwarth, Katja (2019): Jutta Ditfurth: „Extinction Rebellion ist eine Weltuntergangssekte“. Online: https://www.fr.de/politik/jutta-ditfurth-extinction-rebellion-eine-weltuntergangssekte-13116627.html [17.01.2021].
Wagener, Ulrike (2012): Heroismus als moralische Ressource rechtserhaltender Gewalt? ethische Reflexionen zu heroischen und postheroischen Elementen in der polizeilichen Organisationskultur. In: Meireis, Torsten [Hrsg.]: Gewalt und Gewalten. Zur Ausübung, Legitimität und Ambivalenz rechtserhaltender Gewalt. Mohr Siebeck: Tübingen, S. 133–160.
XR Deutschland (2019a): How to: Ortsgruppengründung. Online: https://extinctionrebellion.de/mitmachen/ortsgruppe-gruenden/ [07.01.2021].
XR Deutschland (2019b): SOS-Handbuch (work in progress, stand: 01.08.2019). Online: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjc1arhsoTuAhWKCewKHSQgDDwQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fextinctionrebellion.de%2Fdocuments%2F170%2FSOS-Handbuch-20190801_4.pdf&usg=AOvVaw2Gkx7A4V1z9sABBhf2MNym [05.01.2021].
XR Deutschland/Legal Team Berlin (2020): Tipps und Hinweise zu XR Aktionen aus rechtlicher Sicht. Online: https://extinctionrebellion.de/documents/461/Tipps_und_Hinweise_zu_rechtlicher_Sicht_Sept_2020.pdf [07.01.2021].
Häufig gestellte Fragen zu "Inhalt"
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Dieses Dokument analysiert die Rolle der Polizei im Spannungsfeld der Klimaproteste, insbesondere im Umgang mit der Bewegung Extinction Rebellion (XR). Es untersucht, wie die Polizei, geprägt von ihrer "Police Culture" und "Cop Culture", auf die Aktionen von XR reagiert, die durch zivilen Ungehorsam und Gewaltlosigkeit gekennzeichnet sind.
Was ist Extinction Rebellion (XR)?
Extinction Rebellion ist eine dezentralisierte, globale Umweltbewegung, die durch gewaltfreien zivilen Ungehorsam auf die Klimakrise aufmerksam machen und politische Veränderungen erzwingen will. Sie fordert Regierungen auf, die Wahrheit über den Klimanotstand zu sagen, sofort Maßnahmen zur Reduzierung von Emissionen und zum Schutz der Artenvielfalt zu ergreifen und Bürgerversammlungen zur Entwicklung von Klimastrategien einzuberufen.
Wie ist Extinction Rebellion organisiert?
XR ist dezentral organisiert, mit lokalen Ortsgruppen, nationalen Arbeitsgruppen und einer internationalen Ebene. Diese Struktur ermöglicht es, Aktionen lokal anzupassen und gleichzeitig eine globale Bewegung aufrechtzuerhalten. Die Gründung einer Ortsgruppe ist vergleichsweise einfach und folgt den vorgegebenen Prinzipien und Werten der Bewegung.
Welche Aktionsformen nutzt Extinction Rebellion?
XR nutzt eine Vielzahl von Aktionsformen, die von Informationsveranstaltungen und "Die-Ins" bis hin zu Blockaden (Swarmings) und "Lock-ons" reichen. Ziel ist es, Störung zu verursachen, Reichweite zu erzielen und Visionen einer nachhaltigen Zukunft zu vermitteln. Die Aktionen sind in der Regel gewaltfrei und zielen darauf ab, die Öffentlichkeit auf die Dringlichkeit der Klimakrise aufmerksam zu machen.
Was ist der Unterschied zwischen "Police Culture" und "Cop Culture"?
Laut Behr (2013) unterscheidet man zwischen "Police Culture" (Polizeikultur), der offiziellen Darstellung der Polizei nach außen als bürgernahe und tolerante Institution, und "Cop Culture" (Polizistenkultur), dem informellen Wertesystem und den Handlungsmustern der Polizeibeamten im täglichen Dienst. Die Cop Culture kann von einer "Krieger"-Mentalität geprägt sein, die Freund-Feind-Schemata bevorzugt und Gewalt als Mittel zur Durchsetzung der Ordnung betrachtet.
Wie beeinflusst die Gewaltlosigkeit von XR die Reaktion der Polizei?
Die Gewaltlosigkeit von XR stellt die Polizei vor ein Dilemma. Einerseits erschwert es die Eskalation und den Einsatz von Gewalt, da die Aktionen friedlich sind. Andererseits fordern Rechtsverstöße durch zivilen Ungehorsam ein Einschreiten der Polizei, um das Legalitätsprinzip aufrechtzuerhalten und gesellschaftliche Erwartungen zu erfüllen. Die Polizei muss daher einen Mittelweg finden, um die Balance zwischen der Wahrung der Ordnung und der Achtung der Versammlungsfreiheit zu gewährleisten.
Welche Rolle spielt die Polizei im Spannungsfeld der Klimaproteste?
Die Polizei befindet sich im Spannungsfeld zwischen der Durchsetzung staatlicher Umweltpolitik und der Achtung der Grundrechte der Protestierenden. Sie muss das Legalitätsprinzip wahren, gleichzeitig aber auch deeskalierend wirken und die Versammlungsfreiheit gewährleisten. Dies erfordert eine differenzierte Betrachtung der jeweiligen Situation und eine flexible Anpassung der Einsatzstrategien.
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwischen XR und der Polizei?
Sowohl XR als auch die Polizei sehen sich als Verfechter einer guten Ordnung und sind um eine positive Außendarstellung bemüht. Allerdings gibt es auch deutliche Unterschiede. Die Polizei repräsentiert den Staat und seine Gesetze, während XR sich gegen das bestehende System richtet. Die Polizei übt das staatliche Gewaltmonopol aus, während XR auf gewaltfreien zivilen Ungehorsam setzt.
Wie sollte die Polizei auf den zivilen Ungehorsam von XR reagieren?
Die Polizei sollte mit Resilienz und auf Augenhöhe mit den Demonstranten reagieren. Ein offener Dialog und die Anerkennung der Ziele der Bewegung können dazu beitragen, Eskalationen zu vermeiden und ein konstruktives Verhältnis zu fördern. Gleichzeitig muss die Polizei Rechtsverstöße ahnden und die öffentliche Sicherheit gewährleisten.
Gibt es Hinweise darauf, dass deutsche Sicherheitsbehörden XR thematisieren?
Obwohl öffentliche Verlautbarungen spärlich sind, deuten Antworten auf kleine Anfragen politischer Parteien darauf hin, dass sich Polizei und Verfassungsschutz mit XR auseinandersetzen, insbesondere im Hinblick auf mögliche Verbindungen zum Linksextremismus. Bislang werden XR jedoch keine verfassungsfeindlichen Bestrebungen attestiert.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Welche Bedeutung hat Extinction Rebellion für die Polizei?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1278558