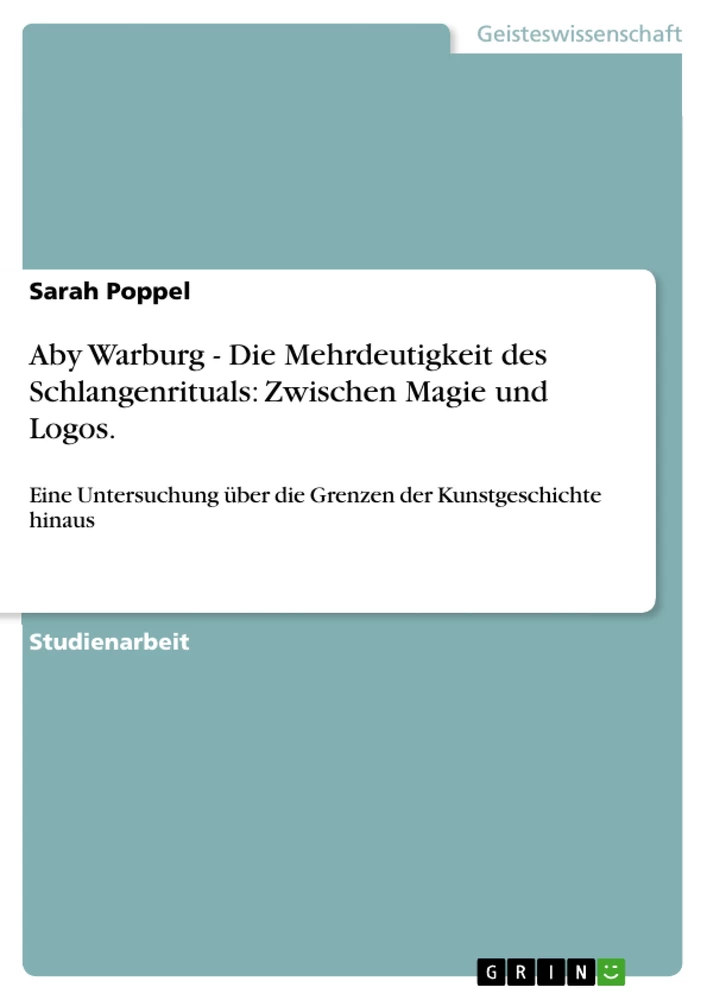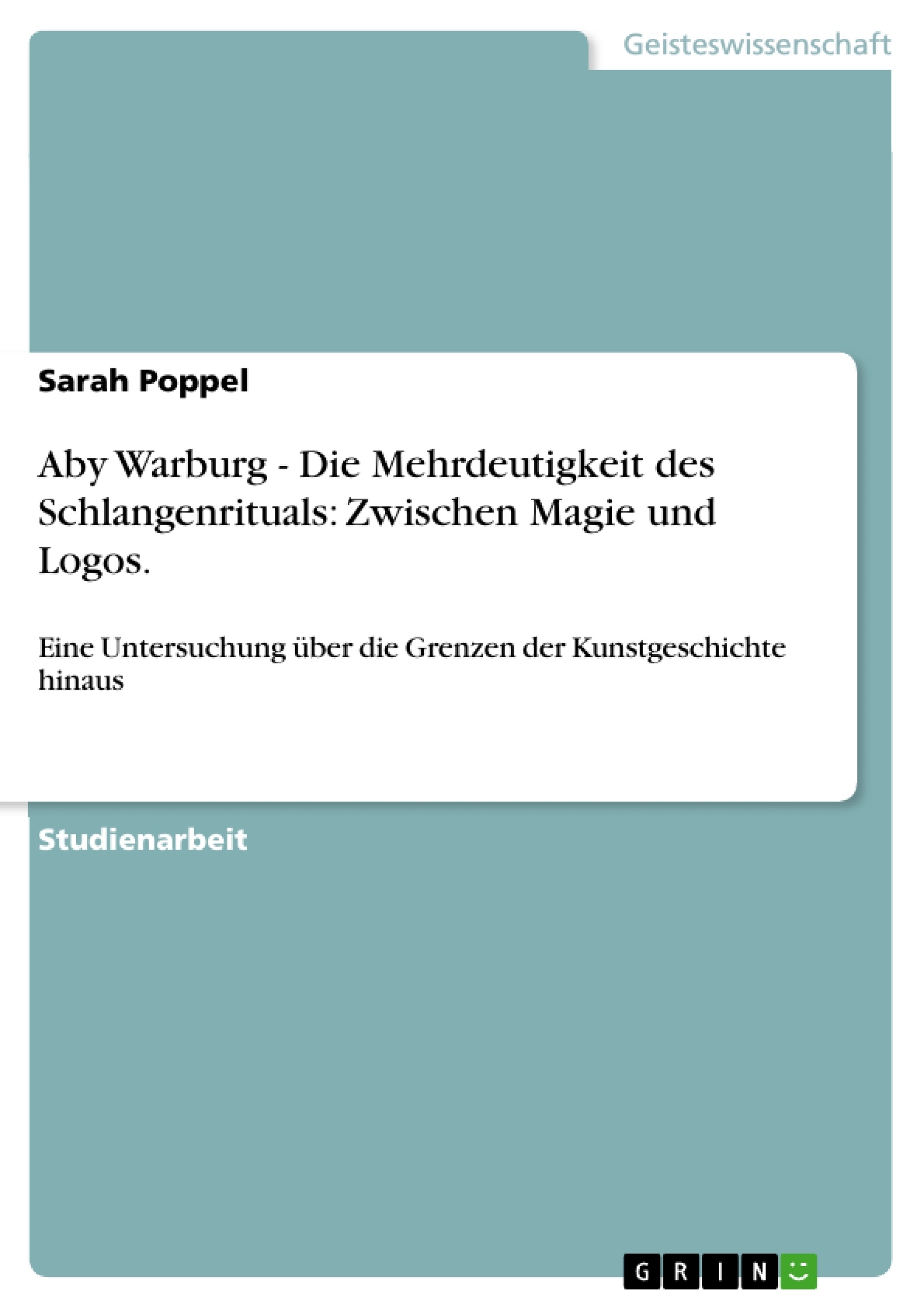Es ist ein altes Buch zu blättern, Athen, Oraibi – alles Vettern. Mit diesen Worten – darin zum Ausdruck gebracht ein mutmaßlicher Verwandtschaftsgrad zwischen dem kulturpolitischen Bildungszentrum der Antike und dem am Rande der Zivilisation, in New-Mexico, gelegenen Hopi-Dorf, eröffnete Aby Warburg 1923 in Kreuzlingen seinen Vortrag Bilder aus dem Gebiet der Pueblo-Indianer. Dabei handelt es sich um eine, basierend auf 1895/96 gesammelten Reiseerfahrungen verfasste Abhandlung über die Kultgewohnheiten dieses Stammes, daraus gewonnene Erkenntnisse, was die Psyche des primitiven und dessen Entwicklung zum modernen Menschen betrifft, vor allem, dass zwischen diesen beiden Entwicklungsstufen der symbolschaffende Mensch steht und dieses Entwicklungsphänomen sich gleichermaßen im Denken des Primitiven Amerikas und des heidnischen Griechen Europas zeigt: „Athen, Oraibi – alles Vettern“.
Das Schlangenritual – handelt repräsentiert schließlich einen Lebensabschnitt Warburgs, über den „[...] mehr veröffentlicht worden [ist], als über alle anderen Aspekte seines Lebens“(Gombrich,1981:119) – und sehr rasch stellt sich heraus, dass das Schlangenritual weniger ein in sich geschlossenes Forschungsdokument darstellt, sondern vielmehr „[...] ein[en] komplexe[en] Knoten, in dem zahlreiche von Warburg im Laufe seiner Forschungen entwickelte Themen zusammen kommen“.
Es wird schnell klar, dass der Vortrag Eines und Vieles zugleich in sich birgt: „[...] ein Höhepunkt seiner Bemühungen [...] dem engen Kreis der Kunstgeschichte“ zu Gunsten der Kulturpsychologie zu entweichen, die Fähigkeit „die europäische Geschichte mit den Augen eines Anthropologen zu sehen“, um zu einem tieferen Verständnis der Bedeutung antiker Formen und ihres Nachlebens in der europäischen Kultur vorzudringen, „eine gedrängte Theorieskizze über kultische Ursprünge der Symbolbildung“ und schließlich „der gelungene Versuch einer Selbstheilung“ – der Erlösungsversuch eines im Inferno Gemarterten.
Ersichtlich wird sodann, dass man sich im Vorhaben einer Analyse dieses vielschichtigen „Rätsels der Sphinx“ nur über konkrete Vergleichspunkte nähern sollte, um nicht in einem undurchdringlichen Chaos von Wissensrelationen letztlich den Überblick zu verlieren. Deshalb wird im Folgenden, nach einführendem Resümee der Reiseumstände von 1895 und des Vortrags von 1923, den oben erwähnten Lesarten von Ernst Gombrich, Fritz Saxl, Ulrich Raulff und Karl Königseder als vermittelnde Interpretationsstränge zu folgen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Reiseumstände
- 3. Der Vortrag von 1923
- 3.1. Die äußeren Bedingungen
- 3.2. Zusammenfassung des Vortrags
- 4. Gombrich: Kulturpsychologie
- 4.1. Ursprünge der Symbolbildung
- 4.2. Aufklärung
- 4.3. Der moderne Mensch
- 5. Saxl: Anthropologie – Nachleben der Symbole
- 5.1. Das Nachleben der Antike
- 5.2. „Athen, Oraibi - alles Vettern“
- 5.3. Polarität
- 6. Raulff: Polyvalenz der Schlange – Das Symbol
- 7. Königseder: Selbstheilung
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Aby Warburgs Vortrag „Bilder aus dem Gebiet der Pueblo-Indianer (Das Schlangenritual)“ von 1923. Ziel ist es, die Vielschichtigkeit des Vortrags und seine Bedeutung für Warburgs Gesamtwerk zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Interpretation des Schlangenrituals als komplexen Knotenpunkt verschiedener Forschungsstränge Warburgs.
- Warburgs interdisziplinärer Ansatz und seine Kritik an der traditionellen Kunstgeschichte
- Die Bedeutung des Schlangenrituals als Beispiel für kulturvergleichende Studien
- Die Rolle von Symbolen und deren Nachleben in verschiedenen Kulturen
- Warburgs Konzept der Kulturpsychologie und seine anthropologische Perspektive
- Die Entwicklung des modernen Menschen im Kontext kulturhistorischer Prozesse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt Aby Warburgs Vortrag über das Schlangenritual von 1923 in den Mittelpunkt der Untersuchung. Warburgs unkonventioneller Ansatz in der Kunstgeschichte, seine Methode der Gesamtkultur und sein Streben nach einer monistischen Kunst- und Kulturpsychologie werden hervorgehoben. Die zentrale These des Vortrags – die Verwandtschaft zwischen antiker und primitiver Kultur – wird eingeführt, und der methodische Ansatz der Arbeit, der auf den Interpretationen von Gombrich, Saxl, Raulff und Königseder aufbaut, wird skizziert.
2. Reiseumstände: Dieses Kapitel beschreibt Warburgs Reise nach New Mexico im Jahr 1895. Angetrieben von einer Abneigung gegen die damalige „ästhetisierende Kunstgeschichte“ und beeinflusst durch Kontakte zur Smithsonian Institution, insbesondere zu Persönlichkeiten wie Cyrus Adler, Frank Hamilton Cushing und James Mooney, begab sich Warburg auf die Reise, um die Kultur der Pueblo-Indianer zu studieren. Die Reise wird als Flucht vor der „Leerheit der Zivilisation“ und als Suche nach authentischen kulturellen Erfahrungen dargestellt. Das Kapitel betont Warburgs Motivation, die Bedeutung des prähistorischen Amerika zu verstehen und seine Faszination für anthropologische Forschung.
3. Der Vortrag von 1923: Dieses Kapitel analysiert Warburgs Vortrag über das Schlangenritual. Es beleuchtet die äußeren Bedingungen der Entstehung des Vortrags und fasst dessen Kernaussagen zusammen. Der Vortrag wird als Höhepunkt von Warburgs Bemühungen um eine kulturpsychologische Perspektive interpretiert, die die europäische Geschichte mit den Augen eines Anthropologen betrachtet. Der Versuch, die Bedeutung antiker Formen und deren Nachleben in der europäischen Kultur zu verstehen, wird als zentrales Thema des Vortrags hervorgehoben.
4. Gombrich: Kulturpsychologie: Dieses Kapitel präsentiert Gombrichs Interpretation von Warburgs Arbeit. Es beschreibt Gombrichs Sichtweise auf die Ursprünge der Symbolbildung, die Aufklärung und die Entwicklung des modernen Menschen. Gombrichs Analyse beleuchtet Warburgs Bemühungen, die Grenzen der Kunstgeschichte zu überwinden und eine umfassendere kulturpsychologische Perspektive einzunehmen.
5. Saxl: Anthropologie – Nachleben der Symbole: Dieses Kapitel beschreibt Saxls Interpretation von Warburgs Werk, insbesondere seine anthropologische Perspektive und die Betrachtung des Nachlebens antiker Symbole in verschiedenen Kulturen. Saxls Analyse der Polarität und des Konzepts „Athen, Oraibi – alles Vettern“ wird diskutiert.
6. Raulff: Polyvalenz der Schlange – Das Symbol: Dieses Kapitel behandelt Raulffs Interpretation des Schlangenrituals und seiner Bedeutung als vielschichtiges Symbol. Raulffs Analyse beleuchtet die Polyvalenz des Schlangensymbols und seine Rolle in Warburgs kulturpsychologischen Überlegungen.
7. Königseder: Selbstheilung: Dieses Kapitel präsentiert Königseders Sichtweise auf Warburgs Vortrag als einen Versuch der Selbstheilung. Königseder interpretiert das Schlangenritual im Kontext von Warburgs persönlicher Entwicklung und seinen geistigen Kämpfen.
Schlüsselwörter
Aby Warburg, Schlangenritual, Kulturpsychologie, Symbol, Anthropologie, Kunstgeschichte, Gesamtkultur, Pueblo-Indianer, Antike, Moderne, Symbolbildung, Interdisziplinarität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Bilder aus dem Gebiet der Pueblo-Indianer (Das Schlangenritual)" von Aby Warburg
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Aby Warburgs Vortrag „Bilder aus dem Gebiet der Pueblo-Indianer (Das Schlangenritual)“ von 1923. Sie untersucht die Vielschichtigkeit des Vortrags und seine Bedeutung für Warburgs Gesamtwerk, wobei der Fokus auf der Interpretation des Schlangenrituals als komplexen Knotenpunkt verschiedener Forschungsstränge liegt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Warburgs interdisziplinären Ansatz und seine Kritik an der traditionellen Kunstgeschichte, die Bedeutung des Schlangenrituals für kulturvergleichende Studien, die Rolle von Symbolen und deren Nachleben in verschiedenen Kulturen, Warburgs Kulturpsychologie und anthropologische Perspektive sowie die Entwicklung des modernen Menschen im Kontext kulturhistorischer Prozesse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Reiseumstände (Warburgs Reise nach New Mexico 1895), Der Vortrag von 1923 (Analyse des Vortrags und seiner Entstehung), Gombrich: Kulturpsychologie (Interpretation von Warburgs Arbeit durch Gombrich), Saxl: Anthropologie – Nachleben der Symbole (Saxls Interpretation, Fokus auf Anthropologie und Symbolen), Raulff: Polyvalenz der Schlange – Das Symbol (Raulffs Interpretation des Schlangensymbols), Königseder: Selbstheilung (Königseders Interpretation im Kontext von Warburgs persönlicher Entwicklung) und Fazit.
Was ist die zentrale These des Vortrags von 1923?
Die zentrale These von Warburgs Vortrag ist die Verwandtschaft zwischen antiker und primitiver Kultur, die er anhand des Schlangenrituals der Pueblo-Indianer illustriert.
Welche Rolle spielt die Kulturpsychologie in der Arbeit?
Die Kulturpsychologie bildet den zentralen methodischen Rahmen der Arbeit. Warburgs interdisziplinärer Ansatz, der Kunstgeschichte, Anthropologie und Kulturgeschichte verbindet, wird im Detail untersucht. Die Interpretationen von Gombrich, Saxl, Raulff und Königseder beleuchten verschiedene Facetten dieser kulturpsychologischen Perspektive.
Welche Bedeutung haben die Interpretationen von Gombrich, Saxl, Raulff und Königseder?
Die Interpretationen dieser Gelehrten bilden die Grundlage der Analyse. Sie bieten unterschiedliche Perspektiven auf Warburgs Vortrag und seine Bedeutung, beleuchten Aspekte der Symbolbildung, des Nachlebens antiker Symbole, der Polyvalenz des Schlangensymbols und den Bezug zu Warburgs persönlicher Entwicklung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Aby Warburg, Schlangenritual, Kulturpsychologie, Symbol, Anthropologie, Kunstgeschichte, Gesamtkultur, Pueblo-Indianer, Antike, Moderne, Symbolbildung, Interdisziplinarität.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf Aby Warburgs Vortrag „Bilder aus dem Gebiet der Pueblo-Indianer (Das Schlangenritual)“ von 1923 und den Interpretationen von Gombrich, Saxl, Raulff und Königseder zu diesem Vortrag.
- Quote paper
- Sarah Poppel (Author), 2006, Aby Warburg - Die Mehrdeutigkeit des Schlangenrituals: Zwischen Magie und Logos., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127796