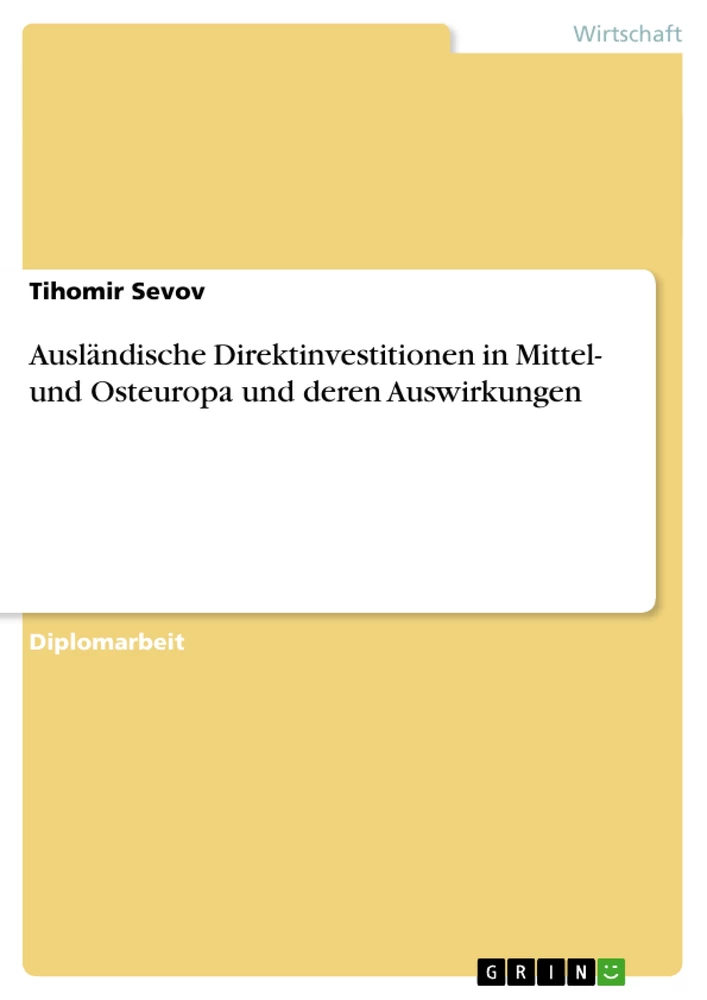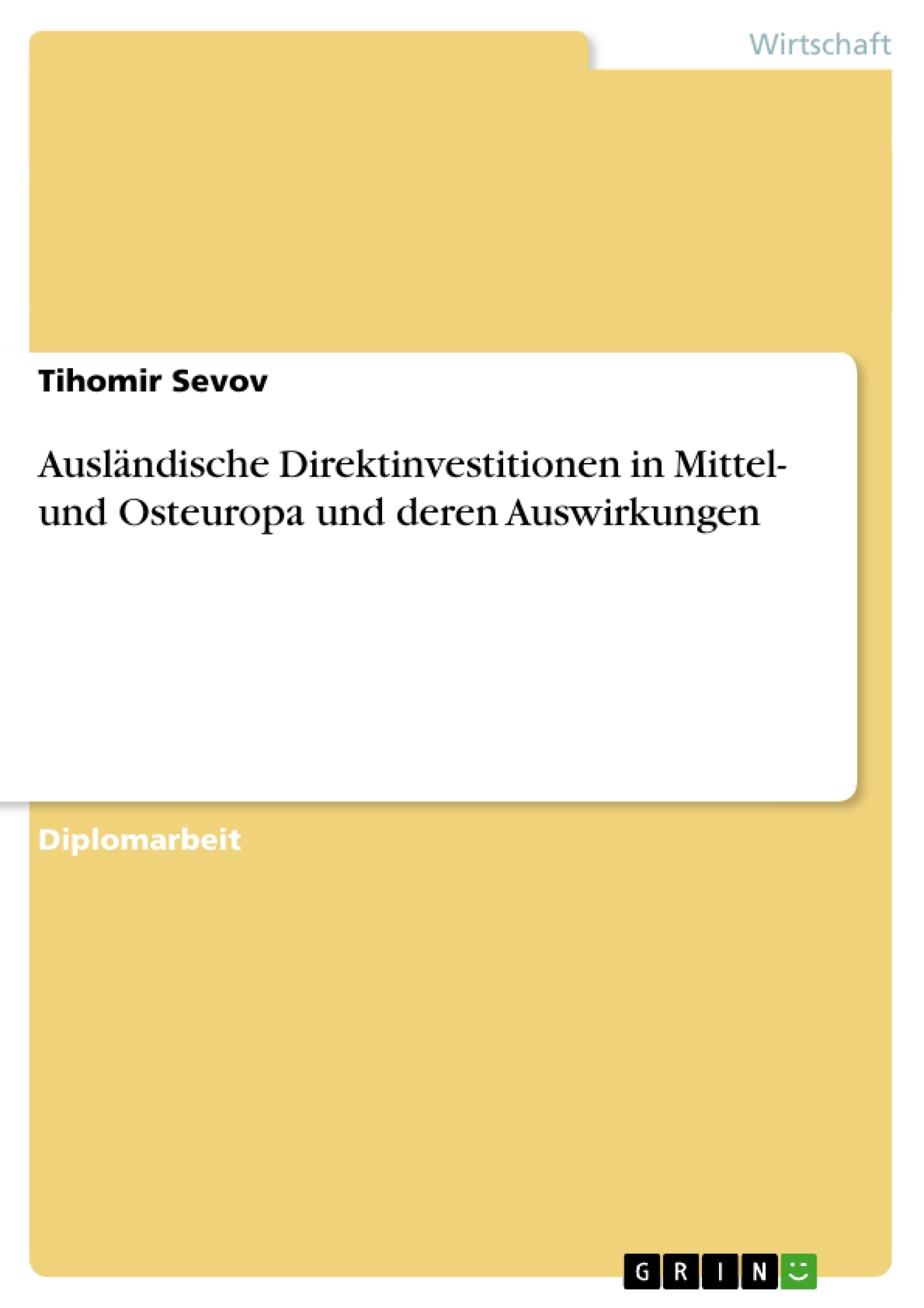Fast 50 Jahre war Europa in zwei Systeme geteilt: Das Wirtschafts- und das Ge-sellschaftssystem. Im November 1989 kam es mit dem Fall der Berliner Mauer in den Staaten Mittel- und Osteuropas zu fundamentalen Umbrüchen, die wenige Jahre zuvor völlig undenkbar waren. Eine außergewöhnliche Systemtransformati-on von sozialistischer Planwirtschaft hin zur marktwirtschaftlichen Wirtschafts-ordnung steht im Mittelpunkt dieses ökonomischen Transformationsprozess. Diese Umwandlung war eine große Herausforderung für die Staaten Mittelosteuropas und die damit verbundenen Aufgaben bezogen sich besonders auf die binnen- und außenwirtschaftliche Liberalisierung der Märkte, die Schaffung eines neuen wirtschaftspolitischen Ordnungsrahmens, Modernisierung, Strukturierung sowie Privatisierung von ganzen Unternehmenssektoren. Dieser ökonomische Trans-formationsprozess in Mittel- und Osteuropa (MOE) stellt einen historischen Prä-zendenzfall dar und förderte die Stabilisierung und Weiterentwicklung dieser Staaten.
Gleich nach dem Transformationsprozess am Anfang der 90er Jahre hatten viele Bürger eine optimistische Einstellung und erwarteten schnelle fundamentale Ver-besserungen der ökonomischen Situation in den jeweiligen Volkswirtschaften MOEs. Die Erwartungen auf schnellen Fortschritt sowie das Erreichen eines Wohlstandsniveaus westlicher Staaten wurde jedoch im Laufe der Zeit nicht er-füllt, sondern vielmehr mit ökonomischen Problemen, die durch den Transforma-tionsprozess entstanden, verbunden. Nach dem Zusammenbruch des planwirt-schaftlichen Wirtschaftssystems MOEs, verlief der Transformationsprozess, ab-hängig von der Ausgangssituation des jeweiligen Landes, unterschiedlich. Dieser Zusammenbruch führte zu nicht marktgemäßen Preisen in den MOE-Staaten ge-genüber der westlichen Länder. Eine ineffiziente Waren- und Regionalstruktur des Handels und eine geringe Tiefe der internationalen Arbeitsteilung war die Folge dieser Abschottung von den westlichen Absatzmärkten.
Nach dieser Transformationskrise nahmen die mittel- und osteuropäischen Länder (MOEL) vermehrt an die internationale Arbeitsleistung teil und wurden immer stärker in die internationale Kapitalverflechtung einbezogen. MOEL strebten mehr und mehr nach einer näheren Anpassung an die Weltwirtschaft. Seit dem haben die ausländischen Direktinvestitionen (ADI) in MOE einen enormen Wachstums-schub der jeweiligen Volkswirtschaften bewirkt...............
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Ausgangssituation
- 1.2 Ziel und Vorgehensweise der Arbeit
- 2 Theoretische Grundlage der ausländischen Direktinvestitionen
- 2.1 Definition ausländischer Direktinvestitionen
- 2.1.1 Direktinvestitionen und multinationalen Unternehmungen
- 2.1.2 Formen der Direktinvestitionen
- 2.2 Klassifikation der Direktinvestitionen
- 2.2.1 Horizontale, vertikale und konglomerate Direktinvestitionen
- 2.2.2 Additive und substitutive Direktinvestitionen
- 2.3 Ökonomische Aspekte und Motive von ausländischen Direktinvestitionen
- 2.3.1 Beschaffungsorientierte Motive
- 2.3.2 Absatzmarktorientierte Motive
- 2.3.3 Effizienzorientierte Motive
- 2.3.4 Strategische Motive
- 2.4 Erklärungsansätze von Direktinvestitionen
- 2.5 Der Eklektische Ansatz von Dunning
- 3 Intensität der ausländischen Direktinvestitionen in Mittel- und Osteuropa
- 3.1 Förderung und Anreize ausländischer Direktinvestitionen
- 3.2 Standortfaktoren als Determinanten von ausländischen Direktinvestitionen
- 3.2.1 Allgemeine Standortfaktoren
- 3.2.1.1 Geographische Entfernung und soziokulturelle Standortfaktoren
- 3.2.1.2 Infrastruktur in den MOEL
- 3.2.2 Wirtschaftliche Standortfaktoren
- 3.2.2.1 Inflation und Wechselkursstabilität
- 3.2.2.2 Zahlungsbilanz und Auslandsverschuldung
- 3.2.2.3 Lohnkosten und Humankapital
- 3.2.2.4 Größe und Wachstum des Marktes
- 3.2.3 Politische Standortfaktoren
- 3.2.3.1 Länderrisiko
- 3.2.3.2 Rechtliche Unsicherheit
- 3.2.3.3 Außenhandelspolitik
- 3.2.3.4 Privatisierung und Restrukturierung
- 3.3 Umfang und Entwicklung der ausländischen Direktinvestitionen in MOE
- 3.3.1 Ziel- und Herkunftsländer
- 3.3.2 Sektorale Verteilung ausländischer Direktinvestitionen in MOEL
- 4 Ökonomische Auswirkungen der ausländischen Direktinvestitionen auf Gast- und Geberländer
- 4.1 Auswirkungen von ausländischen Direktinvestitionen auf mittelosteuropäischen Ländern
- 4.1.1 Allgemeine Auswirkungen
- 4.1.2 Auswirkungen auf die EU-Beitrittsländer 2004
- 4.1.3 Auswirkungen auf die EU-Beitrittsländer 2007
- 4.2 Auswirkungen von ausländischen Direktinvestitionen auf die Geberländer
- 5 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht ausländische Direktinvestitionen in Mittel- und Osteuropa und deren Auswirkungen. Ziel ist es, die Intensität dieser Investitionen zu analysieren und deren ökonomische Folgen für sowohl Gast- als auch Geberländer zu beleuchten.
- Definition und Klassifizierung ausländischer Direktinvestitionen
- Standortfaktoren, die Direktinvestitionen beeinflussen
- Umfang und Entwicklung der Direktinvestitionen in Mittel- und Osteuropa
- Ökonomische Auswirkungen auf Gastländer (Mittel- und Osteuropa)
- Ökonomische Auswirkungen auf Geberländer
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der ausländischen Direktinvestitionen in Mittel- und Osteuropa ein und beschreibt die Ausgangssituation sowie die Ziele und die Vorgehensweise der Arbeit. Es legt den Rahmen für die nachfolgende detaillierte Analyse fest.
2 Theoretische Grundlage der ausländischen Direktinvestitionen: Dieses Kapitel liefert die theoretische Basis für die Untersuchung. Es definiert ausländische Direktinvestitionen, klassifiziert sie nach verschiedenen Kriterien (horizontal, vertikal, konglomerat; additiv, substitutiv) und beleuchtet die ökonomischen Motive dahinter (beschaffungs-, absatzmarkt-, effizienz- und strategisch orientierte Motive). Ein besonderer Fokus liegt auf dem eklektischen Ansatz von Dunning als Erklärungsmodell für Direktinvestitionen.
3 Intensität der ausländischen Direktinvestitionen in Mittel- und Osteuropa: Dieser Abschnitt analysiert die Intensität ausländischer Direktinvestitionen in Mittel- und Osteuropa. Es werden fördernde Maßnahmen und Anreize betrachtet, sowie die Rolle von Standortfaktoren (geographische Lage, soziokulturelle Faktoren, Infrastruktur, wirtschaftliche Bedingungen wie Inflation und Lohnkosten, politische Stabilität und Risikofaktoren). Der Umfang und die Entwicklung der Investitionen werden anhand von Daten und Statistiken untersucht, inklusive der Betrachtung von Herkunfts- und Zielländern sowie der sektoralen Verteilung.
4 Ökonomische Auswirkungen der ausländischen Direktinvestitionen auf Gast- und Geberländer: Das Kapitel untersucht die ökonomischen Auswirkungen der Direktinvestitionen sowohl auf die mittel- und osteuropäischen Gastländer als auch auf die Geberländer. Es wird differenziert zwischen allgemeinen Auswirkungen und den spezifischen Folgen für EU-Beitrittsländer (2004 und 2007). Die Analyse umfasst positive und negative Effekte auf die jeweiligen Volkswirtschaften.
Schlüsselwörter
Ausländische Direktinvestitionen, Mittel- und Osteuropa, Standortfaktoren, ökonomische Auswirkungen, Wirtschaftswachstum, EU-Beitritt, Multinationale Unternehmen, Investitionsmotive, Länderrisiko, Humankapital.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Ausländische Direktinvestitionen in Mittel- und Osteuropa
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht ausländische Direktinvestitionen in Mittel- und Osteuropa (MOE) und deren ökonomische Auswirkungen auf sowohl die Gast- als auch die Geberländer. Sie analysiert die Intensität dieser Investitionen und beleuchtet die damit verbundenen Folgen.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Schwerpunkte: Definition und Klassifizierung ausländischer Direktinvestitionen; die Analyse von Standortfaktoren, die Direktinvestitionen beeinflussen (geographische Lage, soziokulturelle Faktoren, Infrastruktur, wirtschaftliche Bedingungen, politische Stabilität); den Umfang und die Entwicklung der Direktinvestitionen in MOE; die ökonomischen Auswirkungen auf die Gastländer (MOE) und die Geberländer; sowie die Betrachtung des eklektischen Ansatzes von Dunning als Erklärungsmodell.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Ausgangssituation, Zielsetzung und Vorgehensweise); Theoretische Grundlagen ausländischer Direktinvestitionen (Definitionen, Klassifizierungen, Motive, Dunnings Eklektischer Ansatz); Intensität der ausländischen Direktinvestitionen in MOE (Fördermaßnahmen, Anreize, Standortfaktoren, Umfang und Entwicklung); Ökonomische Auswirkungen auf Gast- und Geberländer; und eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
Welche Arten von Direktinvestitionen werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen horizontalen, vertikalen und konglomeraten Direktinvestitionen sowie zwischen additiven und substitutiven Direktinvestitionen. Die verschiedenen Formen werden im theoretischen Teil detailliert erläutert.
Welche Standortfaktoren spielen eine Rolle?
Die Arbeit analysiert eine Vielzahl von Standortfaktoren, darunter geographische Entfernung, soziokulturelle Faktoren, Infrastruktur, wirtschaftliche Bedingungen (Inflation, Wechselkursstabilität, Lohnkosten, Humankapital, Marktgröße), und politische Faktoren (Länderrisiko, Rechtliche Unsicherheit, Außenhandelspolitik, Privatisierung).
Wie wird der Umfang der Direktinvestitionen in MOE untersucht?
Der Umfang und die Entwicklung der ausländischen Direktinvestitionen in MOE werden anhand von Daten und Statistiken untersucht. Dabei werden die Herkunfts- und Zielländer sowie die sektorale Verteilung der Investitionen betrachtet.
Welche ökonomischen Auswirkungen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die ökonomischen Auswirkungen der Direktinvestitionen sowohl auf die mittel- und osteuropäischen Gastländer als auch auf die Geberländer. Es werden sowohl allgemeine Auswirkungen als auch spezifische Folgen für EU-Beitrittsländer (2004 und 2007) betrachtet. Die Analyse umfasst sowohl positive als auch negative Effekte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ausländische Direktinvestitionen, Mittel- und Osteuropa, Standortfaktoren, ökonomische Auswirkungen, Wirtschaftswachstum, EU-Beitritt, Multinationale Unternehmen, Investitionsmotive, Länderrisiko, Humankapital.
Welchen Ansatz verwendet die Arbeit zur Erklärung von Direktinvestitionen?
Die Arbeit verwendet den eklektischen Ansatz von Dunning als ein zentrales Erklärungsmodell für ausländische Direktinvestitionen.
- Citar trabajo
- Tihomir Sevov (Autor), 2008, Ausländische Direktinvestitionen in Mittel- und Osteuropa und deren Auswirkungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127681