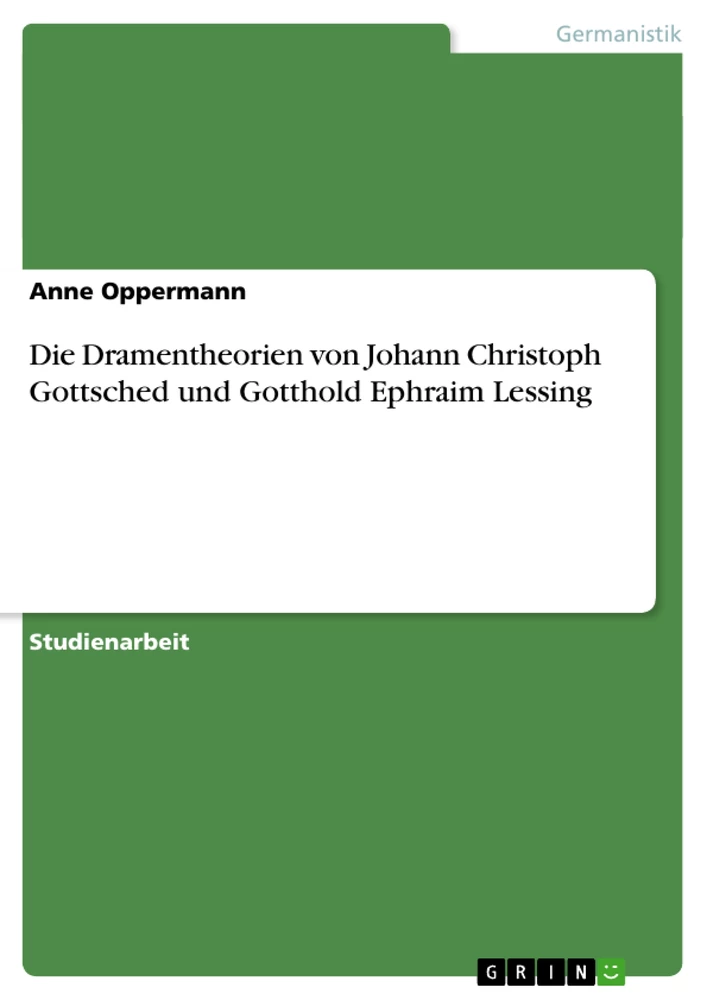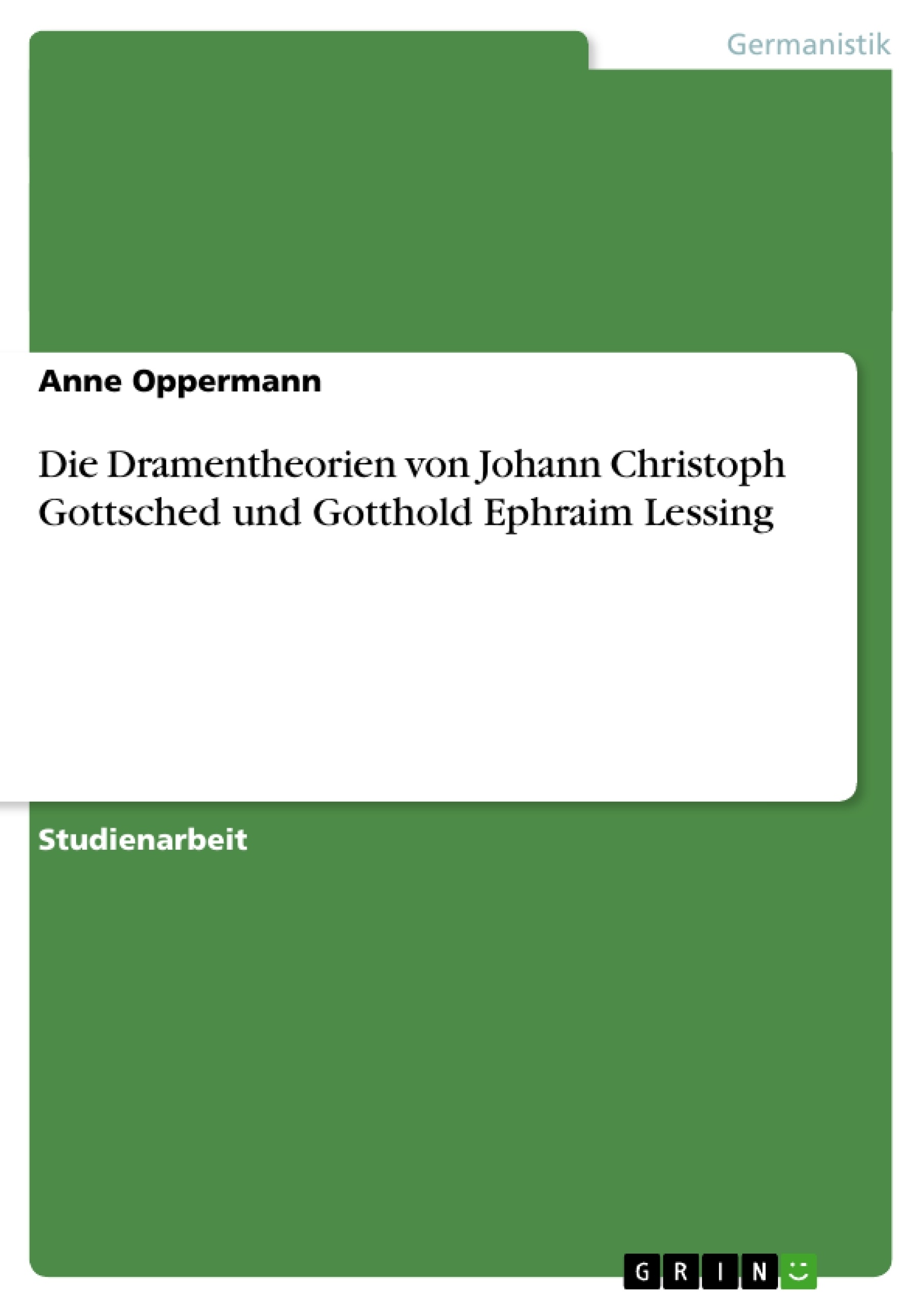Im 18. Jahrhundert befand sich die Theaterkunst in Deutschland auf einem Tiefpunkt. Die Zersplitterung Deutschlands in kleine Herrschaftsbereiche stand der Entwicklung eines einheitlichen und starken Bürgertums und dem Wachsen größerer Städte (mit wenigen Ausnahmen) entgegen. Dadurch war an den meisten Orten das Publikumspotential schnell erschöpft, was die Einrichtung eines stehenden Theaters praktisch unmöglich machte. Das Theaterleben wurde deshalb von Wandertruppen dominiert, die auf Märkten vorwiegend zur Belustigung des niederen Volkes spielten. Das Wanderbühnenrepertoire war sehr uneinheitlich; blutrünstige Historien, derbe Possenspiele, verballhornte englische und französische Literatur waren vorherrschend. Ebenso üblich war das Stehgreifspiel, bei dem lediglich der Szenenablauf festgelegt wurde. Daneben existierte noch das Hoftheater, das der aristokratischen Hofgesellschaft vorbehalten war. Dort gastierten hauptsächlich französische und italienische Truppen, auch Opernaufführungen waren sehr beliebt.
Insgesamt galt das Theater im 18. Jahrhundert in erster Linie als unmoralisch oder Unmoralisches verbreitend. Die Vertreter des neuen, literarisierten und bürgerlichen Theaters wollten sich von dieser Unmoral distanzieren und stellten die Gegenbehauptung auf: das Theater sei ein Erziehungsinstrument und nütze der Moral, eben die „moralische Anstalt“, die Schiller später (1784) fordert. Die große Bedeutung, die die Aufklärung und der Sturm und Drang dem Theater zumaß, ist an der Fülle von theoretischen Abhandlungen zu erkennen, wie zum Beispiel Johann Christoph Gottsched: „Versuch einer Critischen Dichtkunst vor die Deutschen“ 1730, Helferich Peter Sturz: „Brief über das deutsche Theater“ 1767, Jakob Michael Reinhold Lenz: „Anmerkungen, das Theater betreffend“ 1774, Heinrich Leopold Wagner: „Neuer Versuch über die Schauspielkunst“ 1776, Gotthold Ephraim Lessing: „Hamburgische Dramaturgie“ 1767 und Friedrich Schiller: „Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet“ 1784.
Im folgenden werde ich auf Gottsched und Lessing und ihre Dramentheorien und Theaterreformen näher eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- Die deutsche Theatersituation im 18. Jahrhundert
- Johann Christoph Gottsched
- Biographie Gottscheds
- Gottsched und das Theater
- Gottscheds Dramentheorie
- Die Tragödie
- Die Komödie
- Gotthold Ephraim Lessing
- Biographie Lessings
- Lessing und Gottsched
- Lessings Dramentheorie
- Die Tragödie
- Die Komödie
- Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Dramentheorien von Johann Christoph Gottsched und Gotthold Ephraim Lessing im Kontext der deutschen Theatersituation des 18. Jahrhunderts. Ziel ist es, die Entwicklung der deutschen Dramatik in dieser Epoche nachzuzeichnen und die gegensätzlichen Ansätze beider Autoren zu beleuchten.
- Die deutsche Theatersituation im 18. Jahrhundert
- Gottscheds Dramentheorie und ihre Rezeption
- Lessings Dramentheorie als Gegenentwurf zu Gottsched
- Der Einfluss der Aufklärung auf die Entwicklung des deutschen Theaters
- Der Wandel des Theaterpublikums und seiner Erwartungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die deutsche Theatersituation im 18. Jahrhundert: Das 18. Jahrhundert stellte für das deutsche Theater einen Tiefpunkt dar. Die politische Zersplitterung Deutschlands hinderte die Entwicklung eines einheitlichen Bürgertums und größerer Städte, was zu einem geringen Publikumspotential führte und das Theaterleben von Wandertruppen dominieren ließ. Diese Trupps spielten ein uneinheitliches Repertoire, bestehend aus blutrünstigen Historien, Possenspielen und adaptierten ausländischen Stücken, oft mit improvisierten Elementen und stereotypen Figuren wie dem Hanswurst. Im Gegensatz dazu existierten Hoftheater mit hauptsächlich französischen und italienischen Truppen. Schauspieler genossen wenig gesellschaftliche Anerkennung und waren abhängig vom Geschmack des Publikums, was Innovationen hemmte. Das Theater galt als unmoralisch, jedoch sahen Vertreter des aufkommenden bürgerlichen Theaters darin ein Erziehungsinstrument und propagierten es als "moralische Anstalt", was eine Fülle theoretischer Abhandlungen hervorbrachte, darunter Werke von Gottsched und Lessing.
Johann Christoph Gottsched: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Biografie Gottscheds, beginnend mit seiner Geburt und akademischen Laufbahn in Königsberg bis hin zu seiner Professur in Leipzig und seiner Zusammenarbeit mit Friederike Caroline Neuber. Es beschreibt seine kritische Haltung gegenüber dem Zustand des Theaters seiner Zeit, gekennzeichnet durch vulgäres Schauspiel und mangelnde literarische Qualität. Gottscheds Bemühungen um eine Reform des Theaters, die auf der Grundlage von Regeln und aristotelischen Prinzipien beruhte, werden detailliert dargestellt. Seine Ansichten zur Tragödie und Komödie werden beleuchtet, wobei die Betonung auf der Einhaltung strenger Regeln und der moralischen Erbauung liegt. Sein Einfluss auf die Entwicklung des deutschen Theaters wird hier deutlich herausgestellt.
Schlüsselwörter
Dramentheorie, Johann Christoph Gottsched, Gotthold Ephraim Lessing, 18. Jahrhundert, Deutsches Theater, Aufklärung, bürgerliches Theater, Hoftheater, Wandertruppen, Tragödie, Komödie, Moral, Reformen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Dramentheorien Gottscheds und Lessings
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Dramentheorien von Johann Christoph Gottsched und Gotthold Ephraim Lessing im Kontext des deutschen Theaters des 18. Jahrhunderts. Sie untersucht die Entwicklung der deutschen Dramatik in dieser Epoche und vergleicht die gegensätzlichen Ansätze beider Autoren. Der Text beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die deutsche Theatersituation des 18. Jahrhunderts, einschließlich der Rolle von Wandertruppen und Hoftheatern. Sie untersucht Gottscheds Biografie, seine Dramentheorie (Tragödie und Komödie) und seinen Einfluss auf das Theater. Ebenso wird Lessings Biografie, sein Verhältnis zu Gottsched, seine Dramentheorie und der Einfluss der Aufklärung auf die Entwicklung des deutschen Theaters behandelt. Die Veränderungen im Theaterpublikum und dessen Erwartungen werden ebenfalls thematisiert.
Wie wird die deutsche Theatersituation des 18. Jahrhunderts beschrieben?
Das 18. Jahrhundert wird als Tiefpunkt für das deutsche Theater dargestellt, geprägt von politischer Zersplitterung, mangelndem Publikum und der Dominanz von Wandertruppen mit einem uneinheitlichen Repertoire. Hoftheater mit hauptsächlich französischen und italienischen Truppen bildeten einen Kontrast. Schauspieler genossen wenig Anerkennung und Innovationen wurden gehemmt. Das aufkommende bürgerliche Theater sah im Theater ein Erziehungsinstrument und propagierte es als "moralische Anstalt", was zu theoretischen Abhandlungen führte.
Welche Rolle spielt Johann Christoph Gottsched in der Arbeit?
Die Arbeit bietet eine umfassende Biografie Gottscheds, beschreibt seine kritische Haltung gegenüber dem bestehenden Theater und seine Bemühungen um eine Reform basierend auf aristotelischen Prinzipien. Seine Ansichten zur Tragödie und Komödie, mit Betonung auf Regeln und moralischer Erbauung, werden detailliert dargestellt, ebenso sein Einfluss auf die Entwicklung des deutschen Theaters.
Wie wird Gotthold Ephraim Lessing in Bezug zu Gottsched dargestellt?
Die Arbeit vergleicht Lessings Dramentheorie mit der Gottscheds, wobei Lessings Ansatz als Gegenentwurf zu Gottsched betrachtet wird. Der Einfluss der Aufklärung auf Lessings Theorie und die Entwicklung des deutschen Theaters wird ebenfalls thematisiert. Die Arbeit beleuchtet das Verhältnis zwischen Lessing und Gottsched.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Dramentheorie, Johann Christoph Gottsched, Gotthold Ephraim Lessing, 18. Jahrhundert, Deutsches Theater, Aufklärung, bürgerliches Theater, Hoftheater, Wandertruppen, Tragödie, Komödie, Moral, Reformen.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text umfasst Kapitel über die deutsche Theatersituation im 18. Jahrhundert, Johann Christoph Gottsched (inklusive Biografie, Dramentheorie und Einfluss), Gotthold Ephraim Lessing (inklusive Biografie, Verhältnis zu Gottsched, Dramentheorie und Einfluss der Aufklärung) und eine Schlussbetrachtung.
Für welche Art von Leser ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich akademisch mit der deutschen Dramatik des 18. Jahrhunderts, den Dramentheorien Gottscheds und Lessings und dem Kontext der Aufklärung auseinandersetzen möchten. Sie eignet sich für Studenten, Wissenschaftler und alle, die sich für Theatergeschichte und Literaturwissenschaft interessieren.
- Quote paper
- M.A. Anne Oppermann (Author), 2003, Die Dramentheorien von Johann Christoph Gottsched und Gotthold Ephraim Lessing, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127665