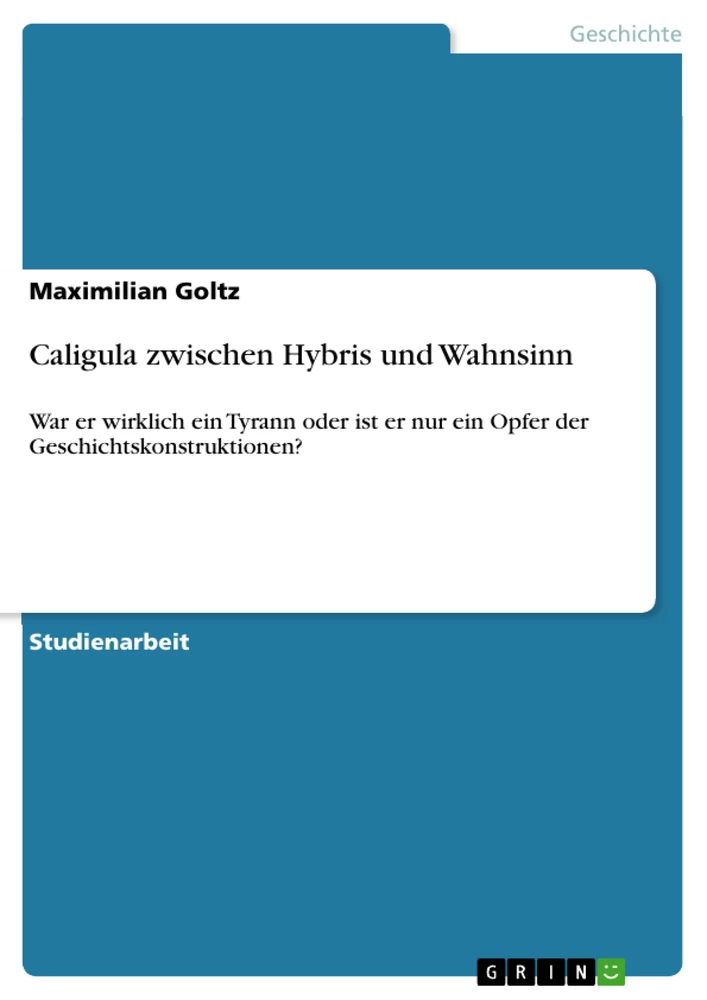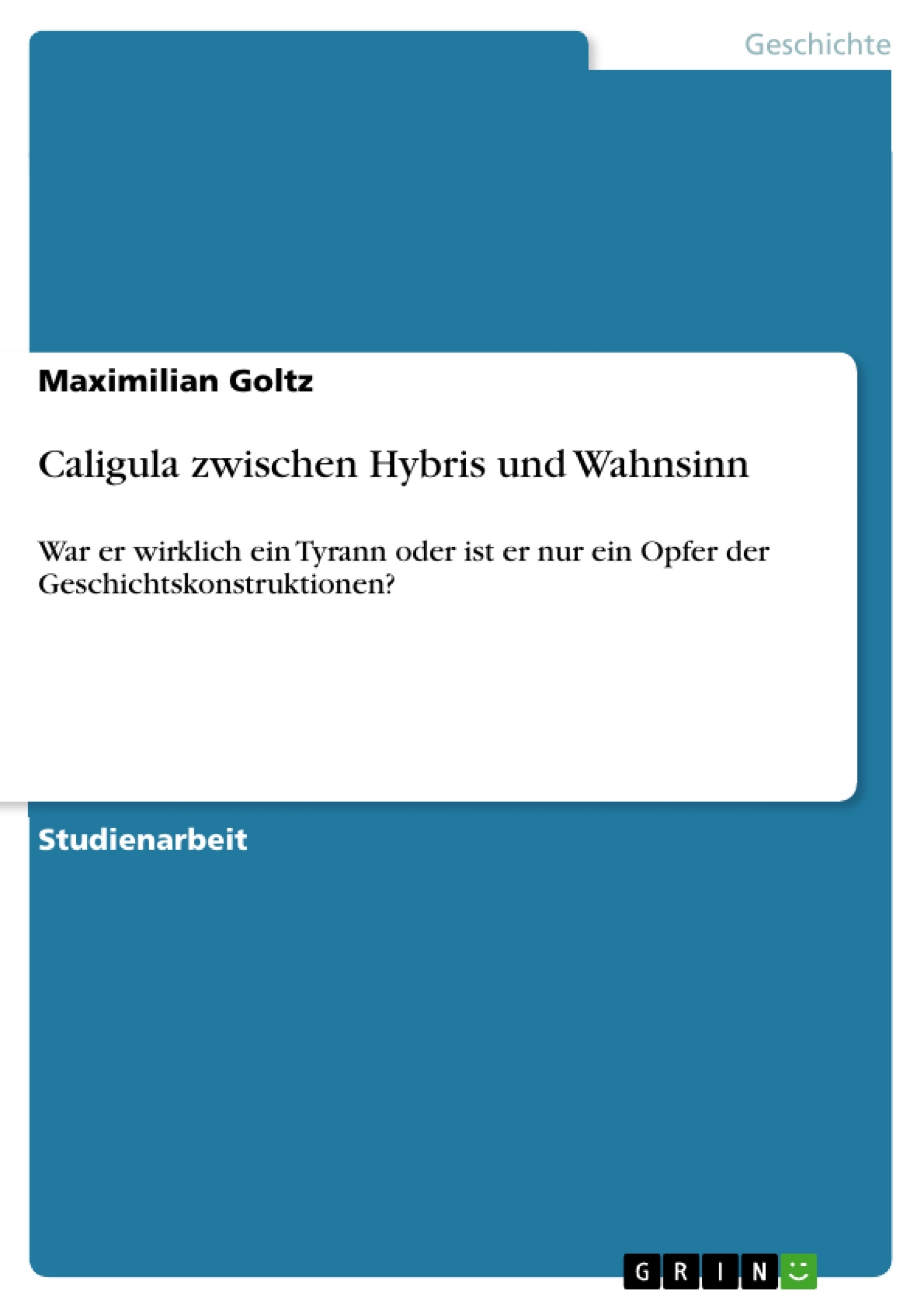Viele bestialische Geschichten und Erzählungen tummeln sich um die Kaiser der res publica, aber einer sticht in puncto Grausamkeit besonders heraus: Gaius Caesar Augustus Germanicus - er ist bekannt als der grausamste und wahnsinnigste Kaiser in der römischen Geschichte. Dabei stellt sich die Frage, ob Caligula tatsächlich der grausame und wahnsinnige Kaiser, wie es in den Geschichtsschreibungen steht, oder nur ein Opfer der Geschichtskonstruktionen ist. Um diese Frage zu beantworten wird am Anfang der Begriff „Geschichtskonstruktionen“ genauer erläutert. Anschließend wird der Anfang Caligulas Amtszeit beschrieben. Das Hauptaugenmerk liegt dabei darauf, wie Caligula der Nachfolger von Tiberius werden konnte und was er politisch am Anfang durchsetzte. Danach werden verschiedene drakonische Taten Caligulas vorgestellt, die er während seiner Amtszeit als Kaiser durchführte. Folglich wird sein Umgang mit seinen Schwestern und dem Senat beschrieben.
Kein anderer Kaiser der res publica ging mit dem Senat so um, wie Caligula es tat. Ebenfalls außergewöhnlich war sein Umgang mit seinen Schwestern, weshalb er öfters mit Inzucht in Verbindung gebracht wird. Hierbei wird vor allem sein Verhältnis zu seiner Schwester Drusilla genauer untersucht. Im zweiten Teil beschäftigt sich diese Arbeit mit dem Kaiser Caligula selbst. Dabei entfernen sich die Untersuchungen von seiner Grausamkeit und legen einen Fokus auf mögliche Gründe seiner Taten, sowie auf eine mögliche Geisteskrankheit von Caligula. Als Quellengrundlage dienen für diese Aspekte die Abschnitte 24-35 aus dem Werk des Historikers und Geschichtsschreibers Sueton. Für die Beantwortung der Fragestellung ist es wichtig zu klären, wie glaubhaft die vorliegenden Quellen von Sueton sind, deshalb wird im Rahmen dieser Seminararbeit diese Frage untersucht. Ziel dabei ist es, die Glaubwürdigkeit des Werkes von Sueton über Caligula zu untersuchen und daraus Schlüsse zu ziehen, die die Fragestellung, ob Caligula ein Tyrann war oder nur ein Opfer der Geschichtskonstruktionen ist, so präzise wie möglich beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- GESCHICHTSKONSTRUKTIONEN
- CALIGULA WIRD KAISER
- CALIGULAS GRAUSAME TATEN
- UMGANG MIT SENAT UND SCHWESTERN
- MÖGLICHE GRÜNDE FÜR CALIGULAS TATEN
- GLAUBWÜRDIGKEIT SUETONS GESCHICHTSSCHREIBUNGEN
- FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
- QUELLENVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit setzt sich zum Ziel, die Figur des römischen Kaisers Caligula zu untersuchen und zu ergründen, ob er tatsächlich ein Tyrann war oder lediglich ein Opfer der Geschichtskonstruktionen. Der Fokus liegt auf der Analyse von Caligulas Taten, seinem Umgang mit dem Senat und seinen Schwestern, sowie auf möglichen Gründen für sein Verhalten.
- Analyse der Geschichtskonstruktionen als einflussreicher Faktor auf die Wahrnehmung historischer Figuren
- Die Rolle von Caligula im römischen Reich, insbesondere seine Machtergreifung und seine politische Entscheidungen
- Untersuchung von Caligulas Grausamkeiten und deren Kontextualisierung
- Beurteilung des Umgangs Caligulas mit dem Senat und seinen Schwestern
- Analyse möglicher Ursachen für Caligulas Taten, einschließlich einer möglichen Geisteskrankheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Thematik der Seminararbeit vor und beleuchtet die kontroverse Figur des Kaisers Caligula. Sie thematisiert die Frage nach Caligulas angeblicher Grausamkeit und stellt die historische Bedeutung des Begriffs "Geschichtskonstruktionen" in den Vordergrund.
- Geschichtskonstruktionen: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Geschichtskonstruktionen" und erörtert dessen Einfluss auf die Interpretation historischer Ereignisse. Es verdeutlicht, dass historische Interpretationen subjektiv geprägt sind und von den Perspektiven und Vorurteilen der Historiker beeinflusst werden.
- Caligula wird Kaiser: Dieses Kapitel untersucht die Machtergreifung Caligulas nach dem Tod von Tiberius. Es analysiert Caligulas Abstammung, seine Beziehung zu Tiberius und seinen Einfluss auf den Senat, um die politischen und familiären Hintergründe seiner Position als Kaiser zu beleuchten.
- Caligulas grausame Taten: Dieses Kapitel widmet sich einer detaillierten Analyse von Caligulas grausigen Taten während seiner Herrschaft. Es stellt verschiedene drakonische Maßnahmen und Entscheidungen vor, die er im römischen Reich ergriff und die ihm den Ruf eines Tyrannen einbrachten.
- Umgang mit Senat und Schwestern: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Caligulas Umgang mit dem Senat und seinen Schwestern. Es beleuchtet seine Konflikte mit den Senatoren und sein besonderes Verhältnis zu seiner Schwester Drusilla.
- Mögliche Gründe für Caligulas Taten: Dieses Kapitel erörtert mögliche Gründe für Caligulas Taten, die über den bloßen Tyrannen-Begriff hinausgehen. Es untersucht, ob Caligula an einer Geisteskrankheit litt, und beleuchtet verschiedene Theorien, die sein Verhalten erklären könnten.
- Glaubwürdigkeit Suetons Geschichtschreibungen: Dieses Kapitel analysiert die Glaubwürdigkeit der Geschichtswerke von Sueton, die als primäre Quelle für Informationen über Caligula dienen. Es hinterfragt die Objektivität von Suetons Schilderungen und beleuchtet mögliche Verzerrungen aufgrund seiner Perspektive und der Zeit, in der er lebte.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit befasst sich mit den Themen Caligula, Tyrannenbild, Geschichtskonstruktionen, Suetons Geschichtsschreibungen, römische Kaiserzeit, römischer Senat, politische Macht, Familie, Geisteskrankheit und historische Interpretation. Diese Schlüsselwörter spiegeln die zentralen Aspekte der Arbeit wider und dienen als Ausgangspunkt für die Analyse von Caligulas Leben und seiner Rolle im römischen Reich.
- Quote paper
- Maximilian Goltz (Author), 2021, Caligula zwischen Hybris und Wahnsinn, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1275354