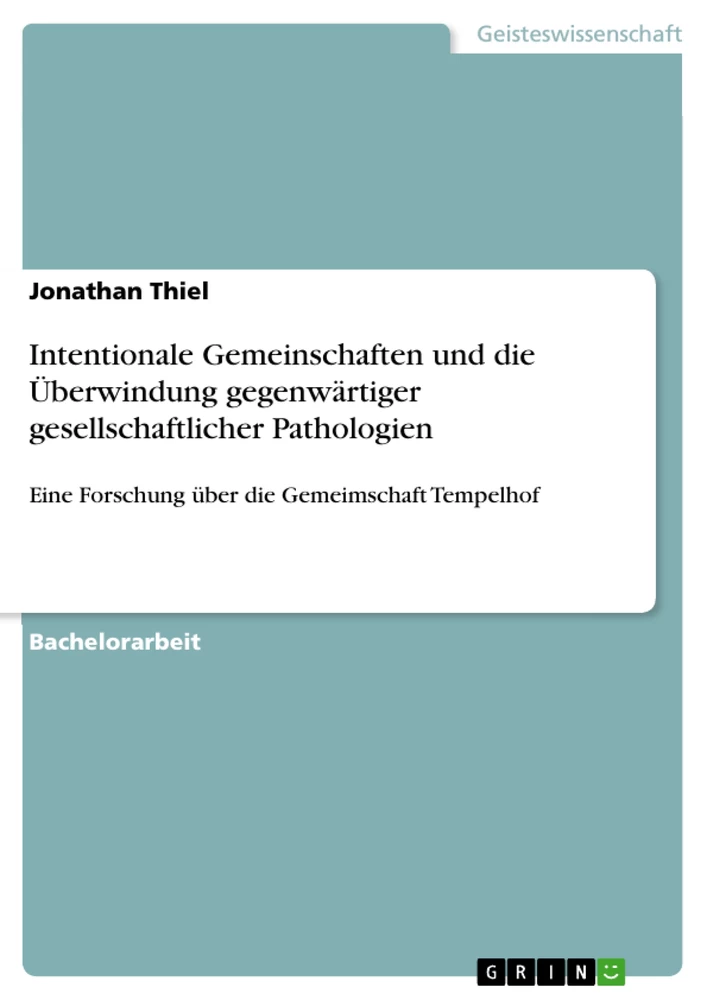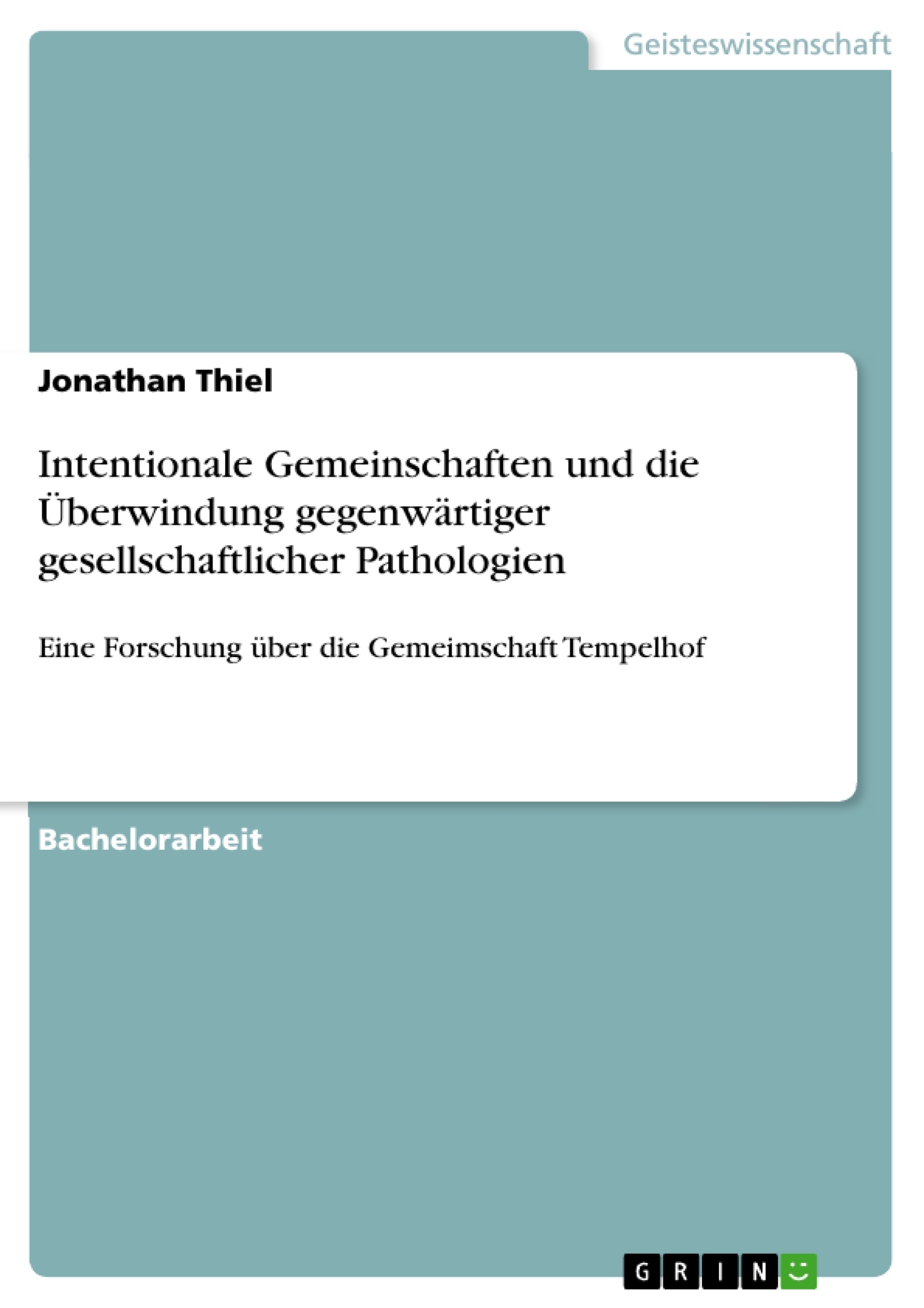In einer Welt, die sich zunehmend entfremdet und von gesellschaftlichen Pathologien gezeichnet zeigt, stellt sich die dringende Frage: Bieten intentionale Gemeinschaften einen Ausweg aus der Krise der Moderne? Diese Bachelorarbeit begibt sich auf die Suche nach Antworten, indem sie das faszinierende Phänomen intentionaler Gemeinschaften am Beispiel der Gemeinschaft Schloss Tempelhof untersucht. Im Fokus steht die Analyse der Mechanismen der Vergemeinschaftung, der Funktionen, die Gemeinschaften in diesem Kontext erfüllen, und ihres potenziellen Beitrags zur Überwindung der uns umgebenden gesellschaftlichen Herausforderungen. Die Arbeit beleuchtet zunächst die historische Entwicklung des Gemeinschaftsbegriffs von Aristoteles bis zu modernen soziologischen Theorien, um ein fundiertes Verständnis des Themas zu gewährleisten. Darauf aufbauend werden die theoretischen Grundlagen intentionaler Gemeinschaften und die vielschichtigen Pathologien der Moderne erörtert. Der empirische Teil der Arbeit widmet sich der Gemeinschaft Schloss Tempelhof, wobei durch narrative Interviews und die Anwendung der Grounded Theory Methodologie tiefe Einblicke in die gelebte Praxis gewonnen werden. Die Ergebnisse werden im Reflexionsteil kritisch hinterfragt und mit bestehenden Forschungsergebnissen verglichen, insbesondere unter Berücksichtigung der Theorien von Zygmunt Bauman. Abschließend wird die Bedeutung intentionaler Gemeinschaften für einen umfassenden gesellschaftlichen Transformationsprozess diskutiert, wobei die zentrale Erkenntnis lautet, dass der Wandel im Kleinen beginnt – durch das Engagement und die bewusste Gestaltung des Einzelnen. Diese Arbeit ist ein Beitrag zur aktuellen Debatte um alternative Lebensmodelle und die Suche nach einer zukunftsfähigen Gesellschaft, die auf Werten wie Gemeinschaft, Solidarität und Nachhaltigkeit basiert. Schlüsselwörter wie Gemeinschaftstheorie, Vergemeinschaftung, Freiheit und Sicherheit, sowie die Analyse der Modernisierungsprozesse und die Rolle von Schloss Tempelhof als konkretes Beispiel, machen diese Arbeit zu einer wertvollen Ressource für alle, die sich für die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft interessieren und nach Wegen suchen, gesellschaftliche Pathologien zu überwinden. Es wird deutlich, dass intentionale Gemeinschaften nicht nur Orte des Rückzugs sind, sondern auch als Laboratorien für neue Formen des Zusammenlebens dienen können, die das Potenzial haben, positive Veränderungen in der gesamten Gesellschaft anzustoßen und so einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Transformation leisten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Der Weg zum verlorenen Gleichgewicht
- Theorieteil
- Eine Historie der Gemeinschaftstheorie
- Aristoteles und die Vorläufer der modernen Gemeinschafts-Theorien
- Das begriffliche Auseinandertreten von Gemeinschaft und Gesellschaft im 19. Jahrhundert
- Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft (1887) Das klassische Basiswerk
- Weiterentwicklung des Gemeinschaftsbegriffs bei den soziologischen Klassikern
- Helmut Plessner: Die Grenzen der Gemeinschaft (1924)
- Renaissance des Gemeinschaftsbegriffs in der Wissenschaft ab den 1980ern: Posttraditionale Vergemeinschaftung, Neo-Tribes und Intentionale Gemeinschaften
- Zwischen-Fazit: der Gemeinschaftsbegriff – ein komplexes Feld
- Weitere wichtige Aspekte der Gemeinschafts-Theorie
- Mechanismen der Vergemeinschaftung
- Funktionen von Gemeinschaft
- Freiheit und Sicherheit im Kontext von Gemeinschaften: Vom Wandel gemeinschaftlicher Beziehungen
- Hintergrundinformationen zur Bedeutung Intentionaler Gemeinschaften für die Überwindung gesellschaftlicher Pathologien
- Das Phänomen Intentionaler Gemeinschaften
- Die Pathologien der Moderne (entsprechend den 4 Dimensionen der Modernisierung)
- Praxisteil
- Forschungsdesign und Methodologie der Felderschließung
- Das Verhältnis zum Untersuchungsgegenstand: Persönliche Eindrücke mischen sich mit der Grounded Theory Methodologie
- Narrative Interviews als Methode zur Datenerhebung
- Grounded Theory Methodologie zur Datenauswertung
- Zur Wahl des Untersuchungsgegenstands: Die Gemeinschaft Schloss Tempelhof
- Vorstellung der Gemeinschaft Schloss Tempelhof
- Grundlegende Fakten
- Vision und Werte
- Lage und Gebäude
- Betriebe und Projekte
- Organisationale Struktur
- Der Weg zum Gemeinschaftsmitglied
- Vorstellung prägender Methoden und Ideen der Gemeinschaftskultur in Tempelhof
- Vorstellung der Forschungsergebnisse
- Autoethnographische Fragmente des Besuchs in Tempelhof
- Vorstellung der Interviews
- Weitere Meilensteine im Forschungsprozesses
- Theorievorschlag und Schlussfolgerungen
- Reflexionsteil
- Inhaltliche Reflexion der Forschungsergebnisse
- Intentionale Gemeinschaften im Kontext geschichtlicher Prägungen des Gemeinschaftsbegriffes
- Mechanismen der Vergemeinschaftung in der Gemeinschaft Tempelhof
- Funktionen der Vergemeinschaftung in der Gemeinschaft Tempelhof
- Zygmunt Baumann und die Reintegration von Freiheit und Sicherheit in der Gemeinschaft Tempelhof
- Parallelen zwischen den Untersuchungsergebnissen dieser Arbeit und der Literatur zu Intentionalen Gemeinschaften
- Die Überwindung gesellschaftlicher Pathologien durch Intentionale Gemeinschaften
- Die Bedeutung Intentionaler Gemeinschaften für die Überwindung gesellschaftlicher Pathologien innerhalb eines gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozesses
- Gedanken zum Entstehungsprozess der Arbeit: persönliche und prozessorientierte Reflexion
- Abschließendes Fazit: Der Wandel vollzieht sich durch den Einzelnen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Relevanz intentionaler Gemeinschaften für die Bewältigung gegenwärtiger gesellschaftlicher Herausforderungen. Sie fokussiert sich auf die Gemeinschaft Schloss Tempelhof als Fallbeispiel. Die Arbeit zielt darauf ab, die Mechanismen der Vergemeinschaftung, die Funktionen von Gemeinschaft in diesem Kontext und deren Beitrag zur Überwindung gesellschaftlicher Pathologien zu analysieren.
- Historische Entwicklung des Gemeinschaftsbegriffs
- Theorie intentionaler Gemeinschaften
- Gesellschaftliche Pathologien der Moderne
- Fallstudie Gemeinschaft Schloss Tempelhof
- Beitrag intentionaler Gemeinschaften zur gesellschaftlichen Transformation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Der Weg zum verlorenen Gleichgewicht: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den aktuellen gesellschaftlichen Zustand als geprägt von Pathologien. Sie begründet die Wahl der Forschung und legt die methodische Vorgehensweise dar, indem sie auf die zentrale Fragestellung und das gewählte Forschungsobjekt, die Gemeinschaft Schloss Tempelhof, eingeht. Die Einleitung dient als Brücke zwischen der Problemstellung und dem theoretischen wie auch empirischen Teil der Arbeit.
Theorieteil: Dieser Abschnitt bietet einen umfassenden Überblick über die Geschichte und Theorie des Gemeinschaftsbegriffs, von Aristoteles bis hin zu modernen Ansätzen. Er analysiert verschiedene soziologische Perspektiven, wie Tönnies und Plessner, und untersucht die Entstehung und Entwicklung intentionaler Gemeinschaften. Er analysiert zudem Mechanismen und Funktionen von Gemeinschaften und verbindet diese mit dem Konzept der gesellschaftlichen Pathologien der Moderne, um den theoretischen Rahmen für die anschließende empirische Untersuchung zu schaffen. Der Theorieteil bildet die fundierte Grundlage für die spätere Interpretation der empirischen Daten aus der Fallstudie.
Praxisteil: Dieser Teil beschreibt die Methodik der Forschung, einschließlich der Wahl der Grounded Theory als analytisches Verfahren und der Durchführung narrativer Interviews mit Mitgliedern der Gemeinschaft Schloss Tempelhof. Die Darstellung der Gemeinschaft selbst, ihre Struktur, Vision und Aktivitäten bietet den Kontext für die Interpretation der Forschungsergebnisse. Der Abschnitt gliedert sich in die Vorstellung der Methodik, der Vorstellung der Gemeinschaft Schloss Tempelhof und der Vorstellung der Ergebnisse. Die Darstellung der Interviews und der daraus gewonnenen Erkenntnisse bildet den Kern dieses Teils.
Reflexionsteil: In diesem Abschnitt werden die Forschungsergebnisse im Lichte des theoretischen Hintergrunds reflektiert. Die Analyse der Mechanismen und Funktionen der Vergemeinschaftung in Schloss Tempelhof wird mit theoretischen Konzepten abgeglichen. Der Bezug zu Zygmunt Bauman und seinen Theorien zur Modernität und den Herausforderungen der Gesellschaft wird hergestellt. Es werden Parallelen zwischen den Ergebnissen und bestehenden Studien zu intentional Gemeinschaften gezogen. Schließlich wird der Beitrag der Gemeinschaft zur Überwindung gesellschaftlicher Pathologien und deren Rolle im gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess diskutiert. Der Reflexionsteil dient der kritischen Auseinandersetzung mit den Forschungsergebnissen und ihrer Einordnung in den bestehenden Forschungsstand.
Schlüsselwörter
Intentionale Gemeinschaften, Gemeinschaftstheorie, Gesellschaftliche Pathologien, Modernisierung, Schloss Tempelhof, Grounded Theory, Narrative Interviews, Vergemeinschaftung, Freiheit, Sicherheit, gesellschaftliche Transformation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Schwerpunkt der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Relevanz intentionaler Gemeinschaften für die Bewältigung gegenwärtiger gesellschaftlicher Herausforderungen, wobei die Gemeinschaft Schloss Tempelhof als Fallbeispiel dient. Sie analysiert die Mechanismen der Vergemeinschaftung, die Funktionen von Gemeinschaft und ihren Beitrag zur Überwindung gesellschaftlicher Pathologien.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Gemeinschaftsbegriffs, die Theorie intentionaler Gemeinschaften, gesellschaftliche Pathologien der Moderne, eine Fallstudie zur Gemeinschaft Schloss Tempelhof und den Beitrag intentionaler Gemeinschaften zur gesellschaftlichen Transformation.
Was ist das Ziel der Einleitung "Der Weg zum verlorenen Gleichgewicht"?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, beschreibt den aktuellen gesellschaftlichen Zustand als von Pathologien geprägt, begründet die Wahl der Forschung und legt die methodische Vorgehensweise dar. Sie dient als Brücke zwischen der Problemstellung und dem theoretischen sowie empirischen Teil der Arbeit.
Was beinhaltet der Theorieteil?
Der Theorieteil bietet einen umfassenden Überblick über die Geschichte und Theorie des Gemeinschaftsbegriffs, von Aristoteles bis zu modernen Ansätzen. Er analysiert verschiedene soziologische Perspektiven, Mechanismen und Funktionen von Gemeinschaften und verbindet diese mit dem Konzept der gesellschaftlichen Pathologien der Moderne.
Was wird im Praxisteil untersucht?
Der Praxisteil beschreibt die Methodik der Forschung, einschließlich der Wahl der Grounded Theory und der Durchführung narrativer Interviews mit Mitgliedern der Gemeinschaft Schloss Tempelhof. Er stellt die Gemeinschaft Schloss Tempelhof vor und präsentiert die Forschungsergebnisse.
Was wird im Reflexionsteil gemacht?
Im Reflexionsteil werden die Forschungsergebnisse im Lichte des theoretischen Hintergrunds reflektiert. Die Analyse der Mechanismen und Funktionen der Vergemeinschaftung in Schloss Tempelhof wird mit theoretischen Konzepten abgeglichen. Der Beitrag der Gemeinschaft zur Überwindung gesellschaftlicher Pathologien wird diskutiert.
Welche Schlüsselwörter werden in der Arbeit verwendet?
Die Schlüsselwörter sind: Intentionale Gemeinschaften, Gemeinschaftstheorie, Gesellschaftliche Pathologien, Modernisierung, Schloss Tempelhof, Grounded Theory, Narrative Interviews, Vergemeinschaftung, Freiheit, Sicherheit, gesellschaftliche Transformation.
Welche Methodik wurde zur Datenauswertung verwendet?
Die Grounded Theory Methodologie wurde zur Datenauswertung verwendet.
Welche Methode wurde zur Datenerhebung verwendet?
Narrative Interviews wurden als Methode zur Datenerhebung eingesetzt.
Was ist der abschließende Fokus der Arbeit?
Der abschließende Fokus der Arbeit betont, dass der Wandel durch den Einzelnen vollzogen wird.
- Quote paper
- Jonathan Thiel (Author), 2022, Intentionale Gemeinschaften und die Überwindung gegenwärtiger gesellschaftlicher Pathologien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1275203