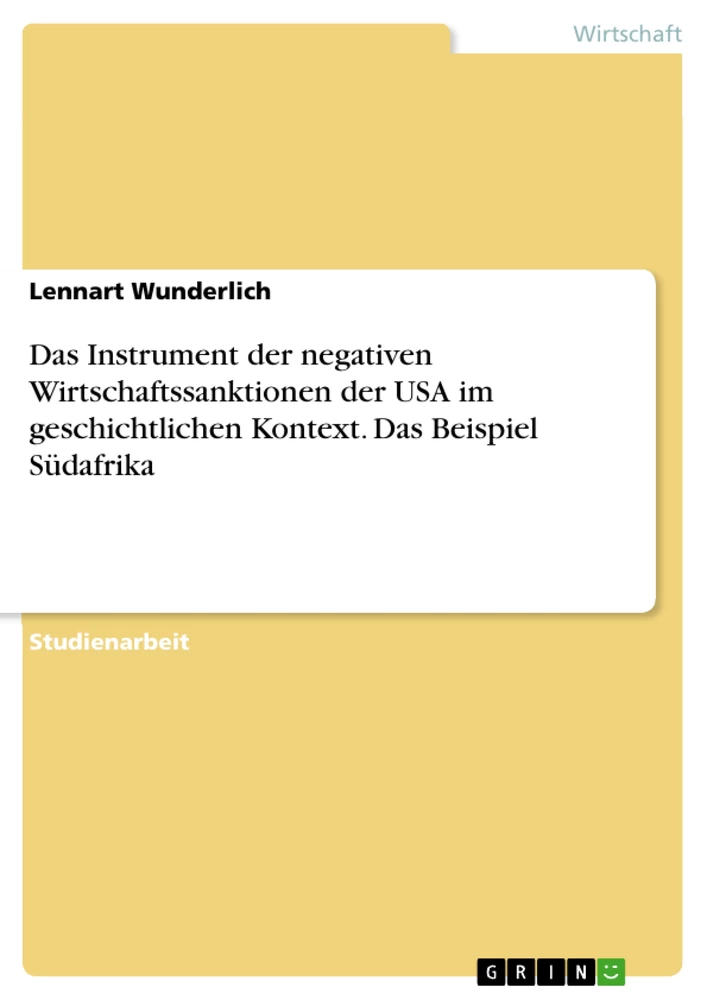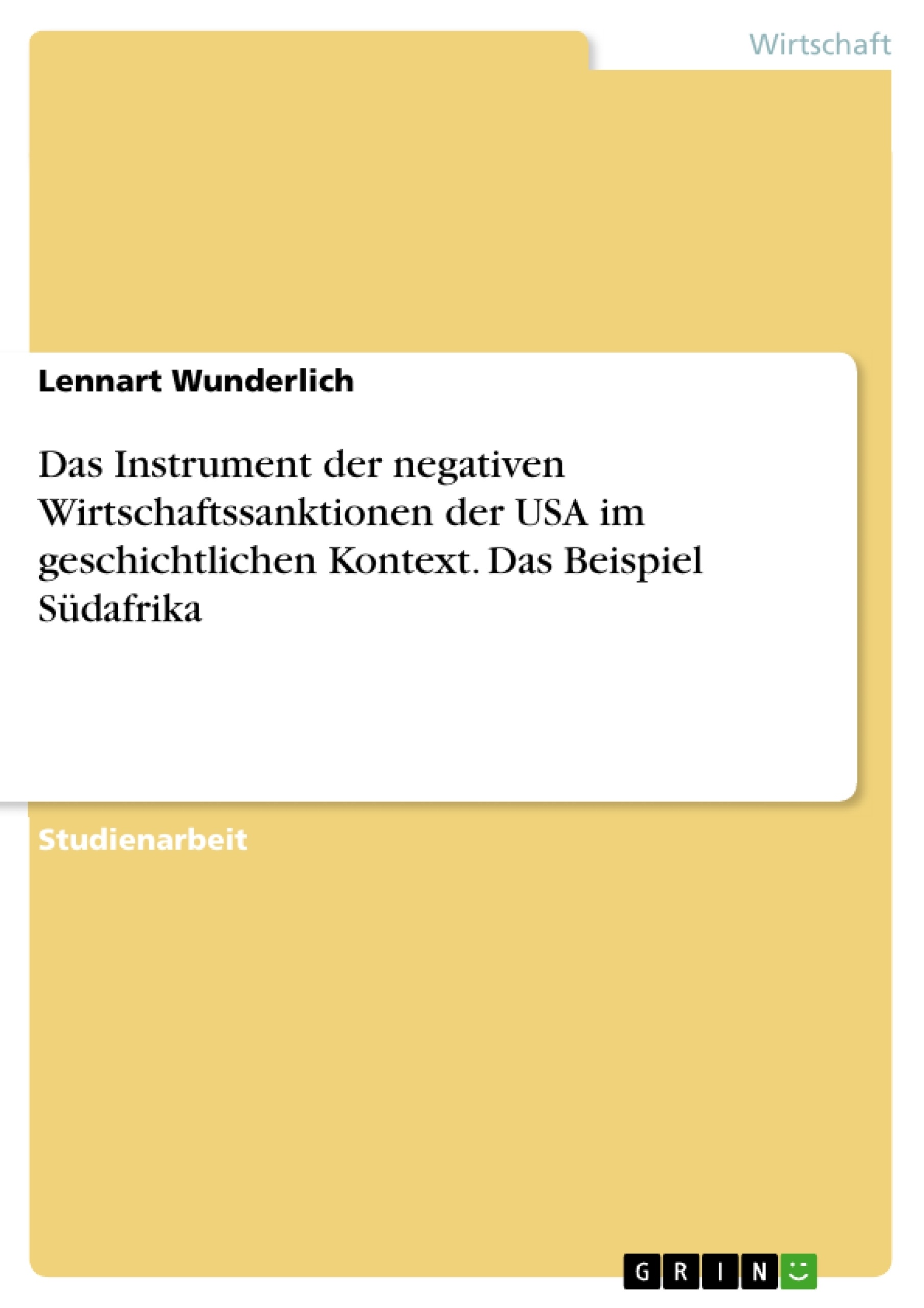Als Instrument der politischen Einflussnahme sind Wirtschaftssanktionen stark umstritten. Viele Politik- und Wirtschaftsforscher glauben längst, die universellen Anwendungsmöglichkeiten dieser widerlegt zu haben. So beispielsweise auch der US-amerikanische Politikwissenschaftler Robert A. Pape in seinem bekannten Aufsatz "Why Economic Sanctions Do Not Work", der 1997 erschien. Dennoch ist sein Heimatland der wohl stärkste Verfechter dieser Methodik der politischen Einflussnahme.
Darunter war lange Zeit auch Südafrika. Zwischen 1963 und 1993 waren Wirtschaftssanktionen gegen den damals von der Apartheid geprägten Staat aktiv. Zwar genießen die Maßnahmen gegen die afrikanische Republik einerseits den Ruf, zum Ende der Apartheid im Jahr 1994 beigetragen zu haben, so stehen diesem aber auch viele kritische Stimmen gegenüber. Levy argumentiert beispielsweise, dass die Maßnahmen gegen das Apartheid-Regime für dessen Fortbestand eher förderlich als hinderlich gewesen wären. Diese These könnte durch die Annahme gestützt werden, dass Interessensgruppen, auch aus der freien Wirtschaft, in den sanktionierenden Staaten treibende Kräfte bei der Ausübung der Maßnahmen gegen einen Zielstaat sein können. Eine solche Lobby setzte sich im Jahr 1986 auch in den USA gegen die Regierung Ronald Reagans durch und war schließlich auch an einer Intensivierung der Wirtschaftssanktionen gegen Südafrika beteiligt.
Diesen Prozess haben Kaempfer und Lowenberg in einem mikrofundierten Public-Choice-Ansatz erfasst und anhand dessen erklärt, wie Sanktionsentscheidungen durch Interessensgruppen in Sender- und Zielstaat in Hinblick auf Ausmaß und Wirkung der Maßnahmen beeinflusst werden.
Diese Arbeit soll zeigen, inwieweit die Ergebnisse dieses Modells auf die Wirtschaftssanktionen der USA gegen Südafrika zwischen 1986 und 1993 angewandt werden können und auf diesem Wege die Treibkräfte hinter den Wirkungen der Sanktionen beschreiben. Zuvor wird dafür die Methodik von Wirtschaftssanktionen mit dem Schwerpunkt auf Finanz- und Handelssanktionen erläutert. Der im Anschluss erläuterte Public-Choice Ansatz nach Kaempfer und Lowenberg (1988, S. 786-793) soll im letzten Schritt im Rahmen einer Fallstudie exemplarisch auf die Sanktionen der USA gegen Südafrika angewandt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Methodik von Wirtschaftssanktionen
- Ziele von Wirtschaftssanktionen
- Arten von Wirtschaftssanktionen
- Handelssanktionen
- Finanzsanktionen
- Public-Choice-Ansatz: Entstehung und Wirkung von Sanktionen
- Im sanktionierenden Staat
- Im sanktionierten Staat
- Fallstudie: Wirtschaftssanktionen der USA am Beispiel Südafrikas
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Wirkung von Wirtschaftssanktionen am Beispiel Südafrikas. Dabei soll der Public-Choice-Ansatz von Kaempfer und Lowenberg (1988) auf die Wirtschaftssanktionen der USA gegen Südafrika zwischen 1986 und 1993 angewendet werden, um die Treibkräfte hinter den Wirkungen der Sanktionen zu beschreiben. Die Arbeit fokussiert auf negative Wirtschaftssanktionen und erläutert zunächst die Methodik von Wirtschaftssanktionen, mit besonderem Augenmerk auf Finanz- und Handelssanktionen. Der Public-Choice-Ansatz soll im Rahmen einer Fallstudie die Effektivität von Wirtschaftssanktionen beleuchten und mögliche Zielkonflikte aufzeigen.
- Die Wirkung von Wirtschaftssanktionen und ihre unterschiedlichen Arten
- Der Public-Choice-Ansatz zur Analyse von Sanktionsentscheidungen
- Die Anwendung des Public-Choice-Modells auf die Wirtschaftssanktionen der USA gegen Südafrika
- Die Rolle von Interessensgruppen bei der Gestaltung und Durchsetzung von Sanktionen
- Mögliche Effekte und Zielkonflikte von Wirtschaftssanktionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit der umstrittenen Wirksamkeit von Wirtschaftssanktionen als Instrument der politischen Einflussnahme. Sie stellt den Fall Südafrikas als Beispiel für die Anwendung von Sanktionen durch die USA vor und beleuchtet die gegensätzlichen Perspektiven auf deren Wirksamkeit. Das zweite Kapitel erläutert die Methodik von Wirtschaftssanktionen, darunter die Ziele und verschiedenen Arten von Sanktionen. Besondere Aufmerksamkeit wird den Finanz- und Handelssanktionen gewidmet. Der Public-Choice-Ansatz, der in diesem Kapitel vorgestellt wird, soll im dritten Kapitel im Rahmen einer Fallstudie angewendet werden.
Schlüsselwörter
Wirtschaftssanktionen, Public-Choice-Ansatz, Südafrika, Apartheid, Finanzsanktionen, Handelssanktionen, Interessensgruppen, politische Einflussnahme, Wirksamkeit, Fallstudie, Zielkonflikt.
- Quote paper
- Lennart Wunderlich (Author), 2019, Das Instrument der negativen Wirtschaftssanktionen der USA im geschichtlichen Kontext. Das Beispiel Südafrika, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1274827